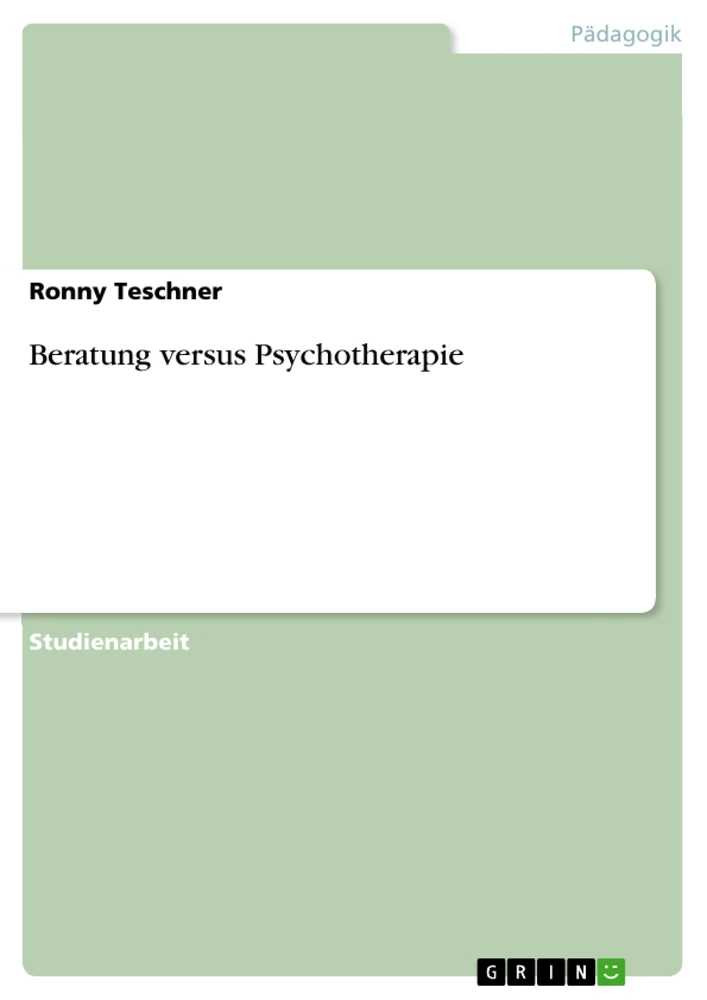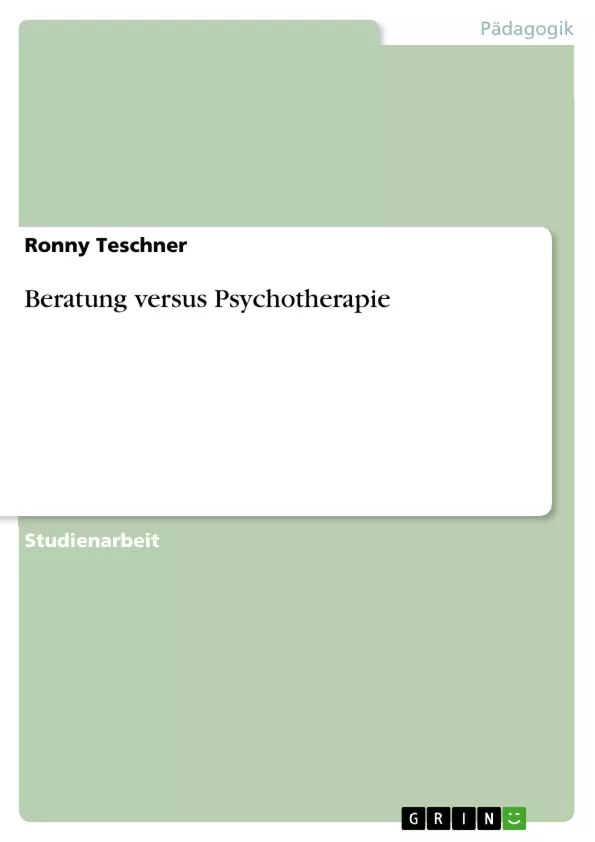Wieso gibt es dieses Thema überhaupt? Für jemanden der sich mit diesem Thema nicht beschäftigt hat (so z.B. S.K.), stellt sich diese Frage nahezu zwingend. Um einen ersten Einblick in dieses Thema zu geben, stelle ich Beratung im zweiten Kapitel in all ihrer Breite (gemeint sind psychologische, soziale und sozialpädagogische, sowie psychosoziale Beratung) vor. Allem voran ist da psychologische Beratung, insbesondere durch die Ausführung dieser, geht unmissverständlich hervor, dass Beratung stark an psychotherapeutische Modelle anlehnt. So dass ihr z.T. noch bis heute der Ruf anhaftet „Therapie des kleinen Mannes“ (Heil & Scheller 1984, 396, zit. n. Zygowski 1989, S. 175) zu sein. Ziel der Beratung ist es also, eine eigene Identität zu entwickeln und das vor allem durch die Loslösung, besser Abgrenzung, von der Therapie. Aber was unterscheidet denn nun Beratung von Therapie und was für Gemeinsamkeiten haben sie? Dies führe ich im dritten Kapitel aus. Durch diese, von allen Seiten betrachtende, Darstellung wird vor allem deutlich, dass man bei dem Versuch Beratung von Therapie zu trennen, nicht von einer klaren Grenzziehung, sondern von einem Kontinuum sprechen sollte, in welchem sich beide Disziplinen, z.T. stark, überschneiden. Welche Fragen und Schwierigkeiten dies aufwirft, mache ich dann im vierten Kapitel deutlich, um schließlich im fünften Kapitel die vielleicht aufkommende Frage nach ihrer trotzdem bestehenden Akzeptanz aufzuklären.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Beratung in ihrer ganzen Breite
- (Psycholog.) Beratung = (Psycho-) Therapie!?
- Soziale Beratung - eine andere Seite
- Sozialpädagogische und psychosoziale Beratung
- Was macht den Unterschied
- Gemeinsamkeiten
- Der formale Unterschied
- Der inhaltliche Unterschied
- So what?
- Wie kam Beratung zu so hoher Akzeptanz?
- Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Beziehung zwischen Beratung und Psychotherapie, mit dem Ziel, die Eigenständigkeit der Beratung als eigenständiges Berufsfeld zu verdeutlichen. Dabei wird die Entwicklung der Beratung von ihren frühen Anfängen bis hin zu den aktuellen Diskussionen um ihre Abgrenzung von der Psychotherapie beleuchtet.
- Die historische Entwicklung der Beratung und ihre Anlehnung an psychotherapeutische Modelle
- Die Abgrenzungsdebatten zwischen Beratung und Psychotherapie
- Die verschiedenen Formen der Beratung (psychologische, soziale, sozialpädagogische, psychosoziale)
- Die Bedeutung der lebensweltorientierten Beratung in der Sozialpädagogik
- Die Herausforderungen und Chancen der Beratung als eigenständiges Berufsfeld
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einleitung stellt die Fragestellung des Textes vor und gibt einen kurzen Überblick über die verschiedenen Formen der Beratung.
- Beratung in ihrer ganzen Breite: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Formen der Beratung, insbesondere die psychologische Beratung und ihre Anlehnung an psychotherapeutische Modelle. Es wird deutlich, dass die Beratung lange Zeit als „Therapie des kleinen Mannes“ betrachtet wurde.
- Was macht den Unterschied: In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Beratung und Therapie betrachtet. Es wird argumentiert, dass die Abgrenzung zwischen beiden Disziplinen schwierig ist und eher ein Kontinuum darstellt.
- So what?: Das Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die sich aus der Abgrenzungsdebatte zwischen Beratung und Therapie ergeben.
- Wie kam Beratung zu so hoher Akzeptanz?: Dieses Kapitel untersucht die Gründe für die hohe Akzeptanz der Beratung in der Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind Beratung, Psychotherapie, Sozialpädagogik, lebensweltorientierte Beratung, Abgrenzung, Eigenständigkeit, Berufsfeld, Akzeptanz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen Beratung und Psychotherapie?
Die Abgrenzung ist oft schwierig; die Arbeit beschreibt beide Disziplinen eher als ein Kontinuum mit starken Überschneidungen statt als strikt getrennte Felder.
Warum wurde Beratung früher als 'Therapie des kleinen Mannes' bezeichnet?
Dieser Ruf rührte daher, dass Beratung oft stark an psychotherapeutische Modelle angelehnt war, aber weniger formalisiert und niederschwelliger zugänglich erschien.
Welche Formen der Beratung gibt es?
Es wird zwischen psychologischer, sozialer, sozialpädagogischer und psychosozialer Beratung unterschieden.
Was bedeutet 'lebensweltorientierte Beratung' in der Sozialpädagogik?
Dieser Ansatz stellt die alltägliche Lebenswelt des Klienten in den Fokus und versucht, Lösungen innerhalb seines sozialen Kontextes zu erarbeiten.
Wie hat Beratung eine so hohe gesellschaftliche Akzeptanz erreicht?
Die Arbeit untersucht die Gründe für diesen Erfolg, der unter anderem in der Loslösung von rein medizinischen Krankheitsmodellen liegt.
- Citar trabajo
- Ronny Teschner (Autor), 2001, Beratung versus Psychotherapie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162871