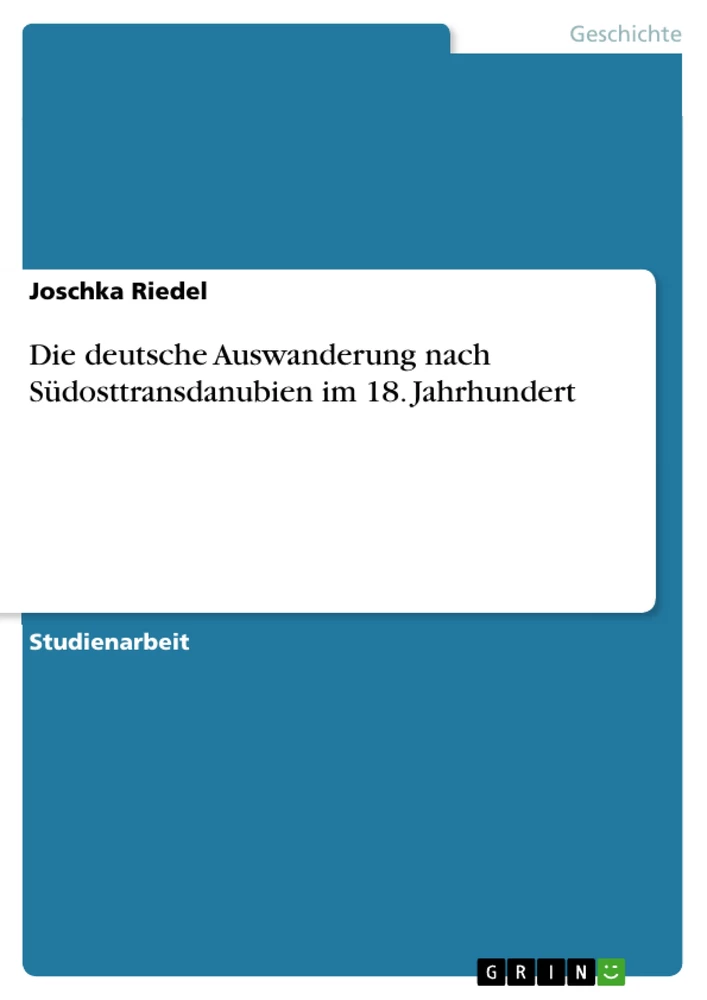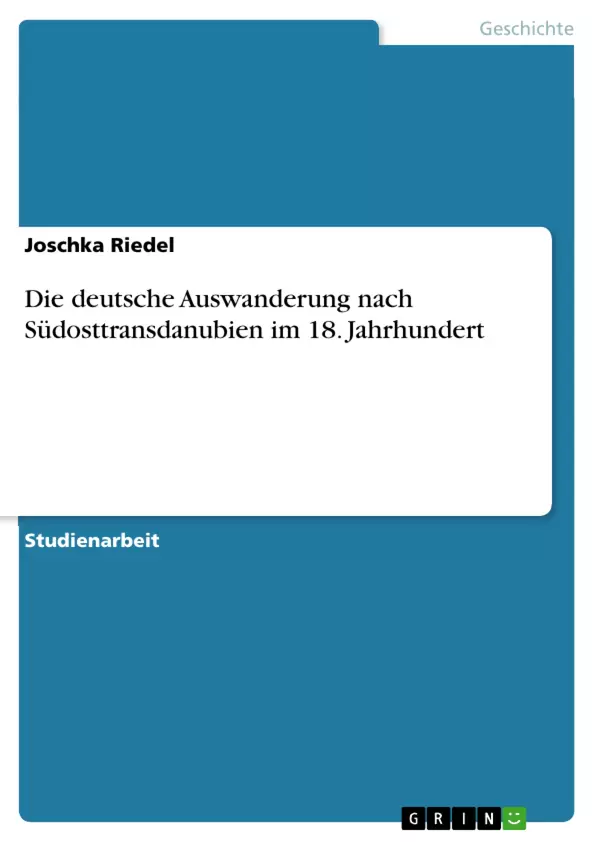Der Untersuchungsraum des südöstlichen Transdanubiens, das in die deutsche Sprache übersetzt das Gebiet „jenseits der Donau“ bedeutet, befindet sich im Südwesten Ungarns, umfasst die Komitate Baranya (Branau), Tolna (Tolnau) und Somogy (Schomodei) mit einer gesamten Fläche von ca. 15.000 km² und soll im weiteren Verlauf der Arbeit nur noch als Transdanubien benannt sein. Es wird geografisch begrenzt durch den Plattensee im Norden und die Flüsse Donau und Drau im Osten bzw. Süden. Das Gebiet wird auch als „Schwäbische Türkei“ bezeichnet. Diese Terminologie lässt sich erstens dadurch erklären, dass die Bevölkerung dieses Areal im 18. Jahrhundert im Gedenken an die Zeit unter der türkischen Hegemonie im Verlauf der Türkenkriege „Türkei“ genannt hatte, und zweitens im 18. Jahrhundert schwäbische Deutsche als Siedler im Untersuchungsgebiet überhand nahmen. Geologisch betrachtet bildet die Schwäbische Türkei die Donau-Drau-Platte, das transdanubische Nachbargebiet der Großen Ungarischen Tiefebene. Es handelt sich hier um ein von einzelnen Wäldern durchsetztes Hügelland. Die wirtschaftliche Struktur der Schwäbischen Türkei ist gekennzeichnet durch das Vorherrschen von Landwirtschaft, für die die natürlichen Voraussetzungen gegeben sind. Die 20 bis 100 cm dicke Lößdecke der Hügellandschaft liefert fruchtbaren Ackerboden und auch die klimatischen Verhältnisse ermöglichen intensiven Weizen- und Mais-, aber auch Reis-, Wein- und Tabakanbau, da sich das Gebiet im Übergang von Gebirgs- zu Flachlandklima befindet. Welchen Anteil deutsche Siedler an diesen durchaus günstigen geografischen und ökonomischen Faktoren in Transdanubien hatten, soll im Folgenden untersucht werden.
Zunächst sollen die Voraussetzungen für die Ansiedlung deutscher Kolonisten im Untersuchungsgebiet unmittelbar nach den Türkenkriegen beschrieben werden, bevor der eigentliche Zulauf deutscher Einwanderer im 18. Jarhundert, unterteilt in zwei Siedlungsetappen, genauere Beachtung findet. Schließlich soll das Ergebnis der Ansiedlung anhand der Lebensbedingungen der Siedler in ihrer neuen Heimat gedeutet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Voraussetzungen für deutsche Siedlungsunternehmungen
- Die Situation nach den Türkenkriegen
- Die Landnutzung nach den Türkenkriegen
- Die deutsche Einwanderung in Transdanubien
- Die Einwanderung der Deutschen von 1689 bis 1720
- Die Einwanderung der Deutschen von 1720 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
- Lebensbedingungen der deutschen Siedler und Gemeindestruktur in der Schwäbischen Türkei im 18. Jahrhundert
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der deutschen Einwanderung nach Südosttransdanubien im 18. Jahrhundert, wobei der Fokus auf den Bedingungen, dem Verlauf und dem Ergebnis der Ansiedlung liegt. Die Arbeit untersucht die Situation in der Schwäbischen Türkei nach den Türkenkriegen, die Bedingungen für deutsche Siedler, den Verlauf der Einwanderung und die Lebensbedingungen der Siedler.
- Die Situation in der Schwäbischen Türkei nach den Türkenkriegen
- Die Bedingungen für deutsche Siedler in Transdanubien
- Der Verlauf der deutschen Einwanderung in zwei Siedlungsetappen
- Die Lebensbedingungen der deutschen Siedler und die Gemeindestruktur
- Das Ergebnis der deutschen Ansiedlung in Transdanubien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit analysiert die deutsche Einwanderung nach Südosttransdanubien im 18. Jahrhundert, die auch als „Schwäbische Türkei“ bezeichnet wird. Das Gebiet umfasst die Komitate Baranya, Tolna und Somogy und zeichnet sich durch seine fruchtbare Landschaft und die wirtschaftlichen Möglichkeiten in der Landwirtschaft aus.
Voraussetzungen für deutsche Siedlungsunternehmungen
Die Situation nach den Türkenkriegen
Transdanubien war durch die Türkenkriege stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Bevölkerung war zu dieser Zeit hauptsächlich ungarisch, slawisch oder slawisch-ungarisch, und die Dörfer waren verwüstet. Die Ackerböden waren zerstört und die Felder und Weinberge brachten nur noch geringe Erträge. Das Gebiet war auch finanziell durch die Kriegsleistungen unter der Türkenherrschaft ausgepresst.
Die Landnutzung nach den Türkenkriegen
Nach den Türkenkriegen gingen die meisten Güter in den Besitz des Staates über. Die Kameraladministration verpachtete die Besitzungen an Pächter, unter denen sich auch Deutsche befanden. Die Ungarische Hofkammer gab die Besitzungen zeitlich unbegrenzt an Adelsfamilien ab, die durch kaiserliche Schenkungsurkunden zu Grundherren wurden.
Die deutsche Einwanderung in Transdanubien
Die Einwanderung der Deutschen von 1689 bis 1720
Die Einwanderung der Deutschen begann im späten 17. Jahrhundert. Die Ansiedlung erfolgte zunächst vor allem im Komitat Baranya, wo viele Dörfer entvölkert waren. Die ersten Siedler waren überwiegend Bauern, Handwerker und Kaufleute. Der Schwerpunkt der Einwanderung lag in der Zeit von 1720 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Die Siedler kamen vor allem aus dem südwestlichen Deutschland und aus Österreich. Die Einwanderung wurde durch die Politik der Habsburger gefördert, die durch die Ansiedlung deutscher Siedler die wirtschaftliche Entwicklung des Landes stärken wollten.
Die Einwanderung der Deutschen von 1720 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
Die Einwanderung der Deutschen setzte sich im 18. Jahrhundert fort. Die Zahl der deutschen Siedler stieg stark an, und die deutsche Sprache und Kultur verbreiteten sich in der Schwäbischen Türkei. Die deutschen Siedler spielten eine wichtige Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Sie brachten neue Anbaumethoden und verbesserte landwirtschaftliche Techniken mit, und sie trugen zur Entwicklung des Handels und der Industrie bei.
Lebensbedingungen der deutschen Siedler und Gemeindestruktur in der Schwäbischen Türkei im 18. Jahrhundert
Die Lebensbedingungen der deutschen Siedler in der Schwäbischen Türkei waren schwierig. Die Siedler mussten die zerstörten Dörfer wiederaufbauen und die Ackerböden kultivieren. Sie hatten mit Hunger, Krankheiten und Armut zu kämpfen. Die deutschen Siedler organisierten sich in Gemeinden, die sich um die Verwaltung und die wirtschaftliche Entwicklung kümmerten. Die Gemeinden entwickelten eigene Regeln und Gesetze, und sie spielten eine wichtige Rolle im kulturellen und sozialen Leben der deutschen Siedler.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der deutschen Auswanderung, der Siedlungsgeschichte, der Schwäbischen Türkei, den Türkenkriegen, den Lebensbedingungen der deutschen Siedler, der Gemeindestruktur, der Landwirtschaft, dem Wirtschaftsleben und der Kultur in Transdanubien im 18. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff Schwäbische Türkei?
Es bezeichnet ein Gebiet in Südwestungarn (Komitate Baranya, Tolna, Somogy), das im 18. Jahrhundert massiv von deutschen (vorwiegend schwäbischen) Siedlern kolonisiert wurde und zuvor unter türkischer Herrschaft stand.
Warum wanderten Deutsche im 18. Jahrhundert nach Transdanubien aus?
Nach den Türkenkriegen war das Land entvölkert und verwüstet. Die Habsburger förderten die Ansiedlung deutscher Bauern und Handwerker, um die Region wirtschaftlich wieder aufzubauen und steuerlich nutzbar zu machen.
In welchen Etappen verlief die deutsche Einwanderung?
Die Arbeit unterscheidet zwei Hauptphasen: Die erste von 1689 bis 1720 und die zweite, intensivere Phase von 1720 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.
Welchen Einfluss hatten die Siedler auf die Landwirtschaft?
Die deutschen Siedler brachten neue Anbaumethoden und Techniken mit, die einen intensiven Weizen-, Mais-, Wein- und Tabakanbau ermöglichten und die Region zu einem fruchtbaren Ackerland machten.
Wie waren die Lebensbedingungen der Siedler?
Die Bedingungen waren anfangs extrem schwierig; die Siedler kämpften mit Hunger, Krankheiten und Armut während sie die zerstörten Dörfer wiederaufbauten und das Land urbar machten.
- Quote paper
- Joschka Riedel (Author), 2006, Die deutsche Auswanderung nach Südosttransdanubien im 18. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162872