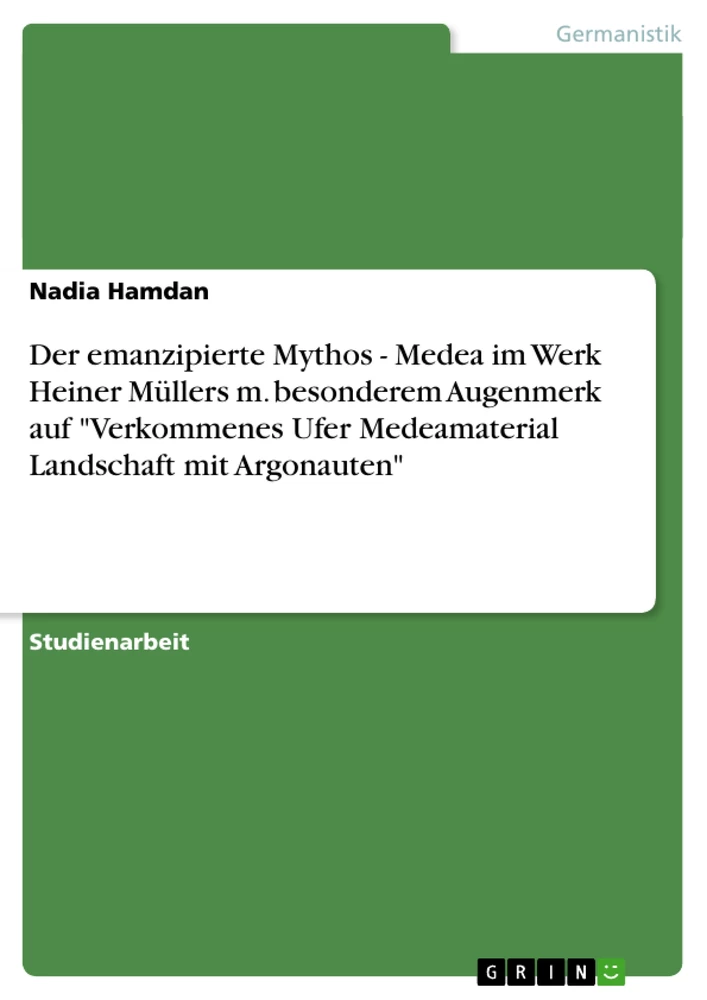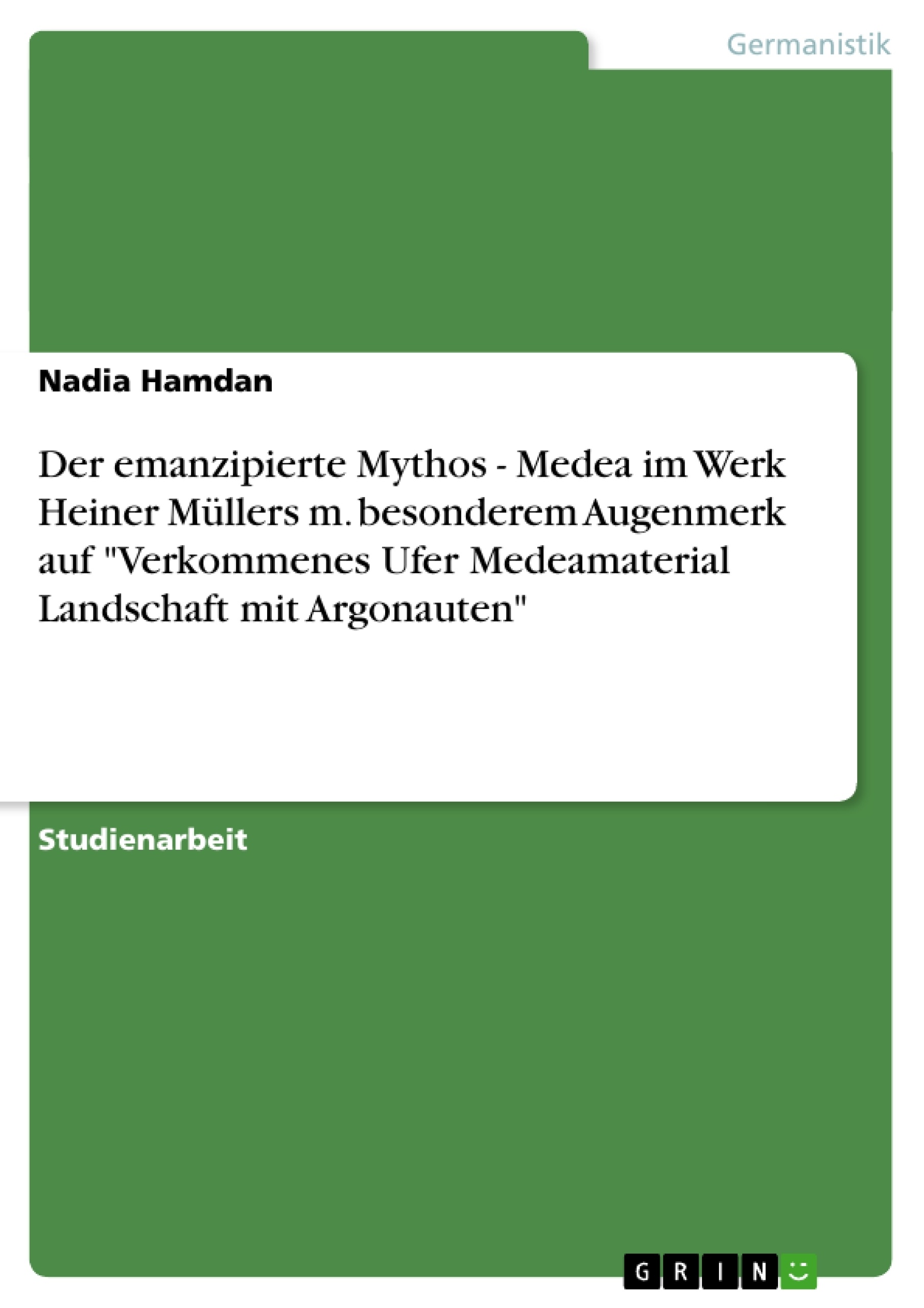Antike Stoffe und ihre Rezeptionen haben bis heute nichts von ihrer Faszination verloren.
Nach wie vor steht der Mensch im Bannkreis der mythologischen, meist in der griechischen
Antike wurzelnden, Überlieferung.
„Mythos“ – ein Wort das heute in vielerlei Zusammenhang gebraucht wird. Es gibt eine
Vielzahl moderner Mythen, die ebenso schnell verschwinden, wie sie die Gesellschaft
beschäftigen. Jede Epoche hatte seine eigenen Mythen – die Suche nach dem heilige Gral im
Mittelalter, die Formel der Alchimisten zur Herstellung von Gold, der Mythos des
sagenhaften Atlantis, der bis heute fortbesteht, universelle, religiöse Mythen wie das „Fatum“,
das Schicksal im Islam. Heutige Mythen lassen sich schwer zusammenfassen – eben weil sie
so schnell wieder in Vergessenheit geraten und jede Generation, jede individuelle
Gruppierung, seine eigenen Mythen hat.
Die Kenntnis der antiken Mythologie trägt wesentlich dazu bei, Eingang zu einer Vielzahl
von moderner Literatur zu finden – auch wenn diese sich nicht sofort ersichtlich mit einem
antiken Topos beschäftigt.
In vielfacher Gestalt haben antike Mythen per se Eingang in die moderne Literatur gefunden,
wurden und werden von modernen Autoren übernommen und in abgewandelter Form in die
moderne Zeit adaptiert. Dabei verliert sich aber nie das antike „Ur“- Thema, es wird in ein
modernes Kleid gesteckt, aber die Fragen nach dem Schicksal, dem Gesetz, der Liebe und
menschlichen Problemen bleiben dieselben wie vor 3000 Jahren, sie sind dem heutigen Leser
- und Zuschauer - so bekannt und vertraut wie dem Damaligen.
Sei es der Zweifel am Rechtsstaat, wie ihn Antigone äußert, oder das Leiden und die Erlösung
durch den Tod, sowie das Verhältnis einer Frau zur Mutter bei Elektra.
Der bekannte Mythos des Ödipus thematisiert die Suche eines Menschen nach seiner
Herkunft, die Geschichte von Medea und Jason – ein Teil der Argonautensage – beschreibt
den Betrug eines Mannes an seiner Frau.
Das Gesetz, seelisches Leiden, Identitätssuche, Betrug – Themen die die Literatur noch heute
beherrschen und die Leser faszinieren. Als Konsens bleibt die Einsicht, dass die Menschen
nur Spielbälle des Schicksals sind – sie können es nicht beeinflussen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung Mythos
- Der Medea Mythos in der Literatur
- Der kolchisch-jolkische und der korinthische Mythos
- Medeas universelle Charakterzüge
- Heiner Müllers dramatisches Werk
- Schrecken und Katastrophe
- Intertextuelle Elemente
- Geschichte und Mythos
- Medea in Müllers Werk
- Medeakommentar
- Medeaspiel
- Verkommenes Ufer, Medeamaterial, Landschaft mit Argonauten
- Medeamaterial, Landschaft mit Argonauten
- Landschaft mit Argonauten
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rezeption des Medea-Mythos im Werk Heiner Müllers, insbesondere mit seinem Stück „Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten“. Sie analysiert, wie Müller den antiken Mythos in ein modernes Kleid steckt und welche zeitgenössischen Bezüge er in seinem Werk herstellt.
- Die Bedeutung des Mythos im Kontext der modernen Gesellschaft
- Die Rezeption des Medea-Mythos in der Literaturgeschichte
- Heiner Müllers besondere Dramaturgie und die Verwendung von Intertextualität
- Die Verknüpfung von antiker Mythologie und moderner Geschichte im Werk Heiner Müllers
- Die Rolle der Frau und die Themen von Betrug, Rache und Verzweiflung im Medea-Mythos
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „Antike Stoffe und ihre Rezeptionen“ im Kontext der modernen Literatur dar und erläutert die Bedeutung des Mythos als wiederkehrendes Motiv in der Literaturgeschichte.
- Begriffserklärung Mythos: In diesem Kapitel wird der Begriff „Mythos“ definiert und es wird auf die Vielfältigkeit des Mythos-Begriffes eingegangen, sowohl im antiken Kontext als auch in der modernen Gesellschaft.
- Der Medea Mythos in der Literatur: Dieses Kapitel beleuchtet die Rezeption des Medea-Mythos in der Literaturgeschichte, angefangen bei Euripides, über Grillparzer bis hin zu Heiner Müller. Es werden die verschiedenen Aspekte des Mythos und die unterschiedlichen Interpretationen von Medeas Charakter und Handlungsmotive hervorgehoben.
- Heiner Müllers dramatisches Werk: Hier wird Heiner Müllers Werk im Allgemeinen betrachtet und seine Arbeitsweise im Kontext der Bearbeitung antiker Stoffe erläutert. Es werden seine Methoden, die Verwendung von Intertextualität und die Verknüpfung von antiker Mythologie und moderner Geschichte in seinen Werken beleuchtet.
- Medea in Müllers Werk: In diesem Kapitel werden die spezifischen Bearbeitungen des Medea-Mythos durch Heiner Müller analysiert, insbesondere die Stücke „Medeakommentar“ und „Medeaspiel“. Es wird untersucht, wie Müller die Thematik des Betruges, der Rache und der Verzweiflung in seinen Dramen umsetzt.
- Verkommenes Ufer, Medeamaterial, Landschaft mit Argonauten: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Stück „Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten“ und analysiert Müllers Interpretation des Medea-Mythos im Kontext der modernen Gesellschaft. Es wird die Bedeutung des Stückes für die Analyse von Müllers Werk im Allgemeinen und für die Rezeption des Medea-Mythos in der heutigen Zeit erläutert.
Schlüsselwörter
Heiner Müller, Medea-Mythos, antike Stoffe, Rezeption, Intertextualität, modernes Drama, Betrug, Rache, Verzweiflung, Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten, Gastarbeiterfrage, Asylgesetzgebung, Geschichte und Mythos, zeitgenössische Bezüge.
Häufig gestellte Fragen
Wie interpretiert Heiner Müller den Medea-Mythos?
Heiner Müller adaptiert den antiken Stoff in Werken wie „Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten“, indem er ihn mit modernen Katastrophenerfahrungen und intertextuellen Elementen verknüpft.
Was bedeutet „Medeamaterial“?
Der Begriff deutet darauf hin, dass Müller den Mythos als Rohstoff („Material“) nutzt, um Themen wie Verrat, Rache und die Zerstörung von Identität in einer modernen, oft verkommenen Landschaft darzustellen.
Welche zeitgenössischen Bezüge stellt Müller her?
Müller nutzt den Medea-Stoff, um auch auf moderne politische Fragen wie die Gastarbeiterproblematik, Asylgesetzgebung und das Scheitern großer geschichtlicher Entwürfe anzuspielen.
Warum faszinieren antike Mythen heute noch?
Die grundlegenden menschlichen Probleme wie Schicksal, Betrug und Identitätssuche sind zeitlos. Moderne Autoren stecken diese „Ur-Themen“ lediglich in ein neues, zeitgemäßes Gewand.
Was ist das Besondere an Müllers Dramaturgie?
Müllers Werk ist geprägt durch eine fragmentarische Struktur, den Einsatz von Schrecken und Katastrophen sowie eine dichte intertextuelle Vernetzung mit anderen literarischen Werken.
- Quote paper
- Nadia Hamdan (Author), 2003, Der emanzipierte Mythos - Medea im Werk Heiner Müllers m. besonderem Augenmerk auf "Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16289