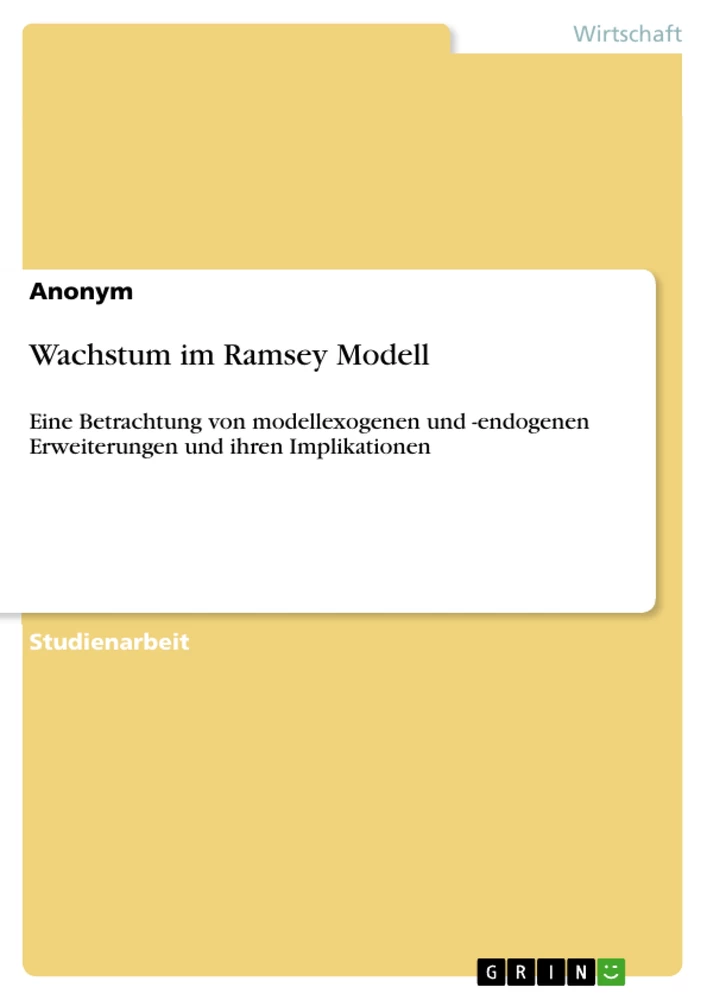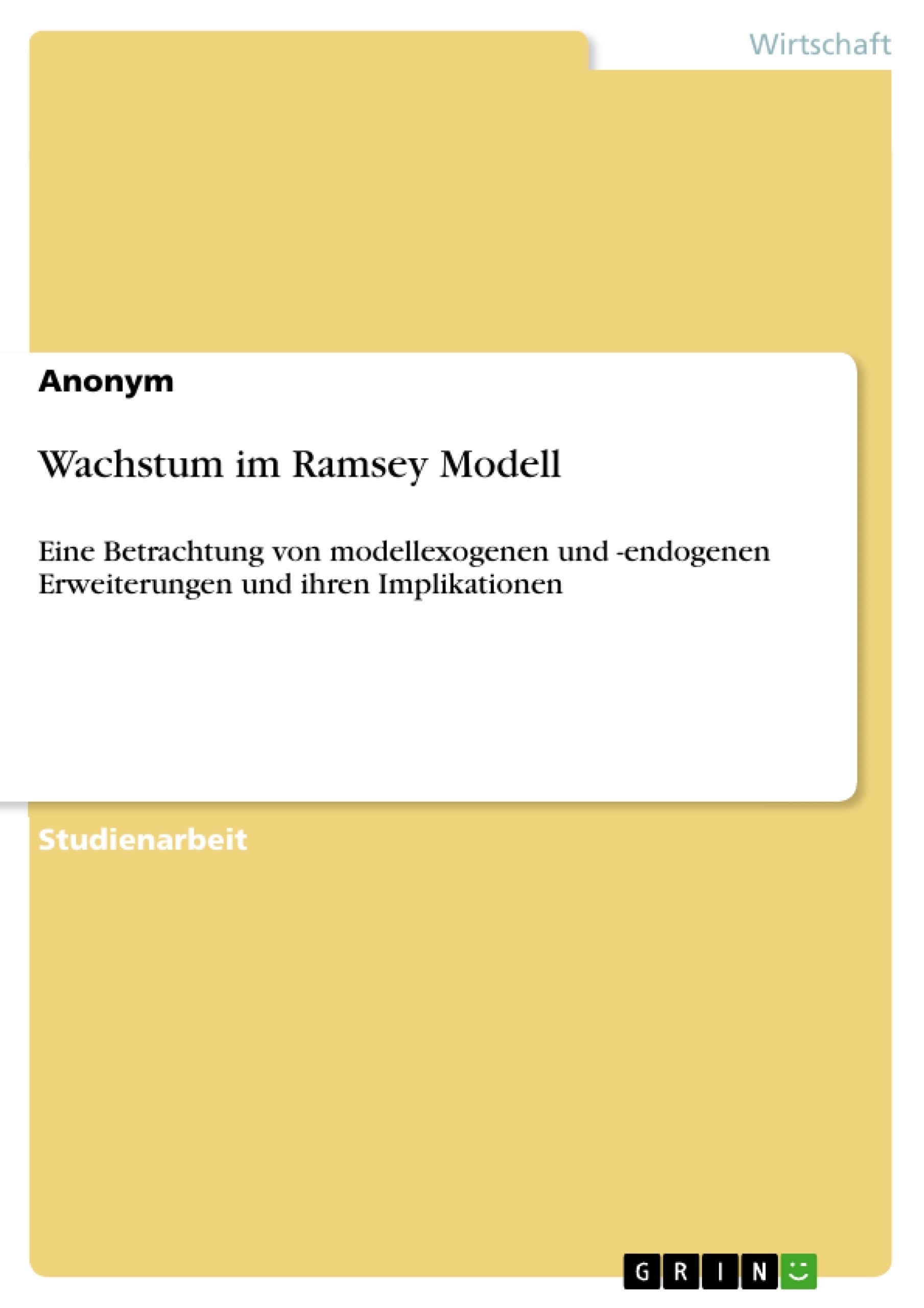In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Ansätze vorgestellt, die wirtschaftliches Wachstum in das Ramsey Modell integrieren.
„Wirtschaftswachstum … ist der Teil der Makroökonomik auf den es wirklich ankommt.“ Dieser Aussage wird in dem zweiten Kapitel auf den Grund gegangen, indem die Bedeutung wirtschaftlichen Wachstums für eine Volkswirtschaft und seine Ursachen kurz herausgearbeitet werden. Es wird deutlich, dass die jährliche Wachstumsrate einer Volkswirtschaft über einen längeren Zeitraum, einen exorbitanten Einfluss auf das Wohlstandsniveau hat.
Darauf folgt eine Einführung in das Ramsey Modell. „Aus chronologischer Sicht bildet der klassische Artikel von Ramsey (1928) den Startpunkt der modernen Wachstumstheorie, eine Arbeit, die ihrer Zeit mehrere Jahrzehnte voraus gewesen ist.“ Mit Hilfe des Ramsey Modells werden die Entwicklungen makroökonomischer Variablen, vor dem Hintergrund eines repräsentativen Wirtschaftssubjekts, das nutzenmaximierend handelt, betrachtet.
In den 50-60er Jahren wurde technischer Fortschritt als exogen gegeben vorausgesetzt. Mit dieser Modellerweiterung konnten dann konstante langfristige Wachstumsraten aufgezeigt werden. Im vierten Kapitel wird diese Idee genauer vorgestellt. Desweiteren wird Bevölkerungswachstum als exogener Einflussfaktor analysiert.
Mitte der 80er setzten Romer und Lucas den Grundstein für Modelle in denen Wachstum auf die ein oder andere Weise modellendogen erklärt wird. Zwei Ansätze werden im fünften Kapitel beispielhaft herausgegriffen. Dabei handelt es sich einmal um technischen Fortschritt in Abhängigkeit von der Kapitalakkumulation und zweitens um technischen Wandel durch zunehmende Produktvielfalt.
Im Fazit werden dann zusammenfassend die Implikationen dieser exogenen und endogenen Ansätze auf die Wirtschaftspolitik diskutiert. Werden die Einflussfaktoren für wirtschaftliches Wachstum als exogen gegeben betrachtet, so bedeute dies für die Wirklichkeit, dass wirtschaftspolitische Maßnahmen keinen Einfluss auf die Wachstumsrate aufwiesen. Bei modellendogenen Ansätzen kann der Wirtschaftspolitik aber durchaus eine steuernde Rolle zugewiesen werden und internationale Unterschiede können erklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutung und Ursachen wirtschaftlichen Wachstums
- Ramsey Model
- Exogenes Wachstum
- Bevölkerungswachstum
- Technischer Fortschritt
- Endogenes Wachstum
- Technischer Fortschritt in Abhängigkeit der Kapitalakkumulation
- Technologischer Wandel durch zunehmende Produktvielfalt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Integration von wirtschaftlichem Wachstum in das Ramsey Modell. Sie analysiert verschiedene Ansätze, die exogenes und endogenes Wachstum in das Modell einbeziehen und diskutiert die Implikationen dieser Ansätze für die Wirtschaftspolitik.
- Bedeutung von wirtschaftlichem Wachstum für eine Volkswirtschaft
- Ursachen für wirtschaftliches Wachstum, insbesondere Kapitalakkumulation, Arbeitseinsatz und technischer Fortschritt
- Das Ramsey Modell und seine Grundannahmen
- Exogenes Wachstum durch Bevölkerungswachstum und technischen Fortschritt
- Endogenes Wachstum durch Kapitalakkumulation und technologischen Wandel
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Zielsetzung der Arbeit vor und gibt einen Überblick über die behandelten Themen.
- Bedeutung und Ursachen wirtschaftlichen Wachstums: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von wirtschaftlichem Wachstum und analysiert die wichtigsten Einflussfaktoren, die sich auf das Wachstum einer Volkswirtschaft auswirken.
- Ramsey Modell: Das Kapitel erläutert die grundlegenden Annahmen des Ramsey Modells und zeigt, wie es verwendet werden kann, um die Entwicklung makroökonomischer Variablen zu analysieren.
- Exogenes Wachstum: Dieses Kapitel behandelt Modelle, die technischem Fortschritt und Bevölkerungswachstum als exogene Einflussfaktoren auf das Wachstum betrachten.
- Endogenes Wachstum: Das Kapitel stellt Ansätze vor, die Wachstum endogen erklären, indem sie technischen Fortschritt von der Kapitalakkumulation oder der Produktvielfalt abhängig machen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte der Arbeit sind: Ramsey Modell, wirtschaftliches Wachstum, exogenes Wachstum, endogenes Wachstum, technischer Fortschritt, Kapitalakkumulation, Produktvielfalt, Wirtschaftspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern des Ramsey-Modells in der Wachstumstheorie?
Es betrachtet die Entwicklung makroökonomischer Variablen basierend auf einem repräsentativen, nutzenmaximierenden Wirtschaftssubjekt.
Was unterscheidet exogenes von endogenem Wachstum?
Exogenes Wachstum wird durch äußere Faktoren wie Bevölkerungswachstum erklärt; endogenes Wachstum entsteht innerhalb des Modells durch Faktoren wie Kapitalakkumulation.
Welche Rolle spielt der technische Fortschritt im Ramsey-Modell?
Technischer Fortschritt ermöglicht langfristig konstante Wachstumsraten und wird je nach Modellerweiterung exogen oder endogen modelliert.
Warum ist wirtschaftliches Wachstum für den Wohlstand so wichtig?
Schon kleine jährliche Wachstumsraten haben über einen langen Zeitraum einen exorbitanten Einfluss auf das Wohlstandsniveau einer Volkswirtschaft.
Welche wirtschaftspolitischen Implikationen ergeben sich?
Bei endogenem Wachstum kann die Politik durch Förderung von Bildung oder Innovation das Wachstum aktiv steuern, während sie bei exogenem Wachstum kaum Einfluss hat.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2009, Wachstum im Ramsey Modell, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162946