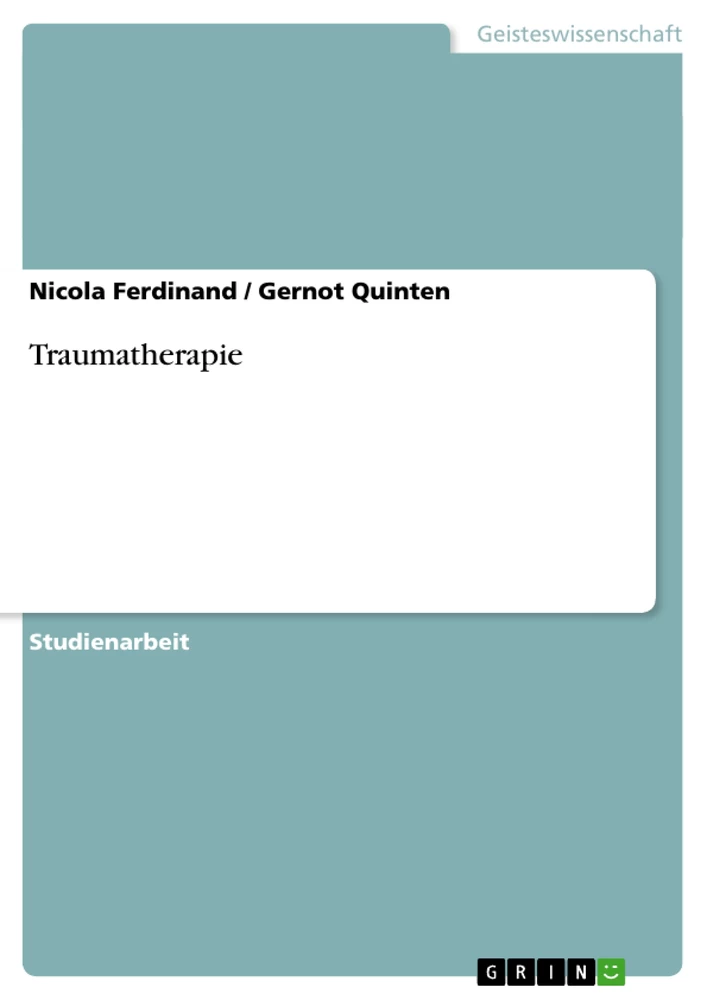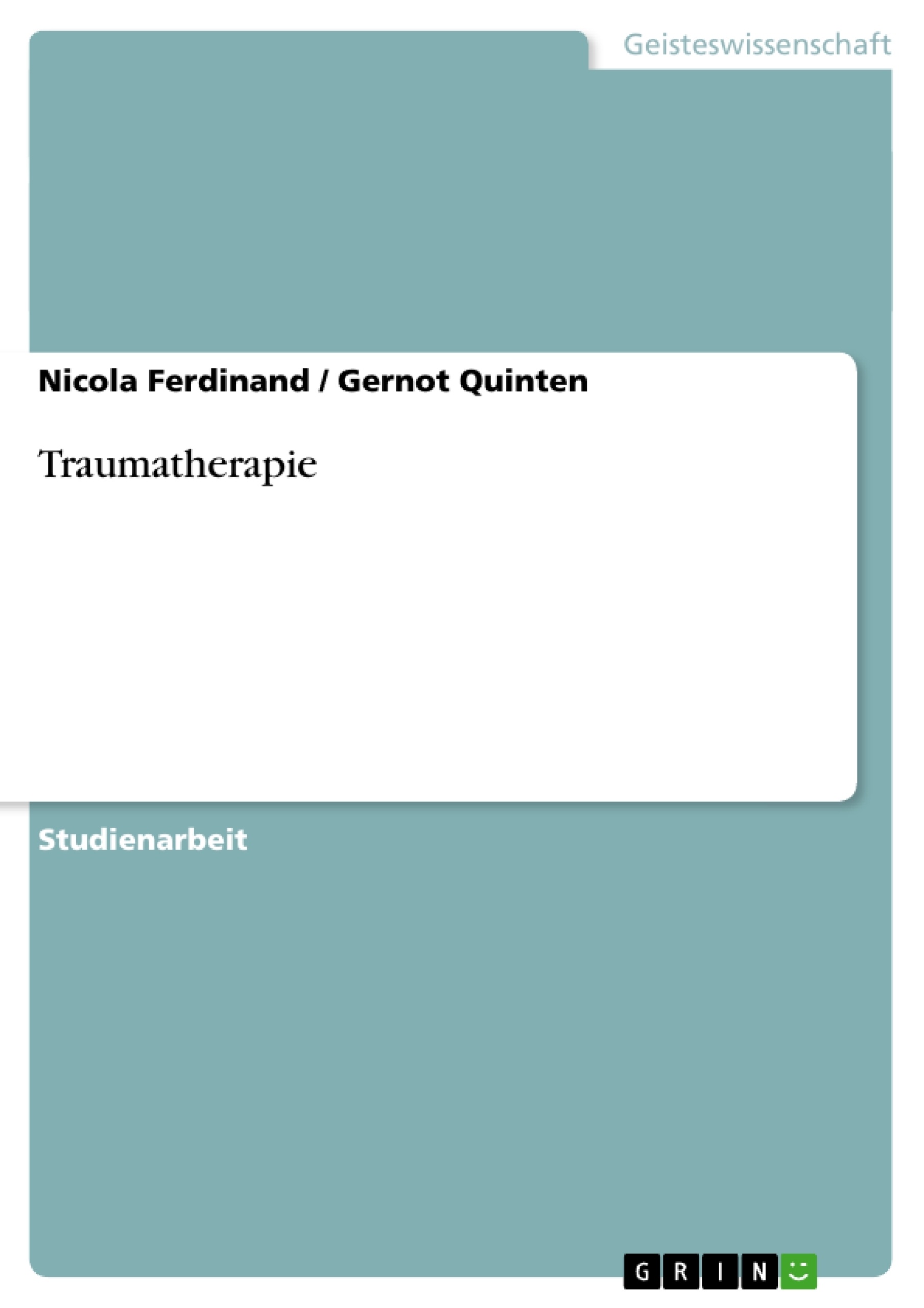FISCHER und RIEDESSER unterscheiden in ihrem "Lehrbuch der Psychotraumatologie" (1998)
zwischen postexpositorischer Traumatherapie und Therapie traumatischer Prozesse. Unter
postexpositorischer Traumatherapie verstehen sie eine Trauma-Akuttherapie, die möglichst
bald nach der Einwirkungsphase des Traumas stattfinden sollte, also dann, wenn die
Betroffenen sich von der direkten Einwirkung der traumatischen Situation zu erholen
beginnen. Sinn dieser Art von Therapie ist es, streßreduzierend zu wirken, verzögert
auftretende posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) oder Chronifizierungen zu mindern
und die Fixierung pathologischer Reaktionen zu vermeiden. Bei den traumatischen Prozessen
hingegen hat sich die Persönlichkeit an die traumatische Erfahrung angepaßt und hat gelernt
mit ihr zu leben. Die traumatischen Ereignisse liegen längere Zeit zurück und unterliegen oft
einer Erinnerungsverzerrung. Manchmal sind sie verdrängt oder zwar erinnerbar, jedoch ohne
die zugehörige emotionale Bedeutung, also abgespalten. Dies hat meist dazu geführt, daß sich
Persönlichkeitsstrukturen wie ein Schutzwall um die "Wunde" herum organisiert haben. Die
Psychotherapie traumatischer Prozesse besteht hier in der Bearbeitung der verzerrten
Abwehrstrukturen in Verbindung mit einer Stärkung der gesunden Strukturen und zielt auf
Wiedererleben, Durcharbeiten und die Integration der traumatischen Erfahrung ab. In der
Praxis lassen sich diese beiden Arten der Therapie jedoch kaum trennen, meist befinden sich
die Therapien wohl irgendwo zwischen diesen beiden Polen. In den folgenden Betrachtungen
werden hauptsächlich Verfahren vorgestellt, die man eher der akuten Traumatherapie
zuordnen würde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeines zur Traumatherapie
- 2.1 Widerstände und Abwehrprozesse bei der Therapie traumatisierter Patienten
- 2.2 Regeln der Traumatherapie
- 3. Psychodynamische Therapien
- 3.1 Beschreibung allgemeiner Therapieansätze
- 3.2 Indikation
- 3.3 Forschungsergebnisse
- 3.4 Psychoanalytische Fokaltherapie der PTBS nach Lindy
- 3.5 Psychodynamische Therapie nach Horowitz
- 4. Kognitive Verhaltenstherapien
- 4.1 Theoretischer Rahmen
- 4.2 Kognitiv-behaviorale Behandlungstechniken
- 4.3 Forschungsbelege für die verschiedenen Behandlungstechniken
- 4.4 Breitspektrum-Therapie nach Scrignar
- 4.5 Die dialektisch-behaviorale Therapie bei Borderline-Patienten
- 5. Gruppentherapie
- 5.1 Definition
- 5.2 Gruppenpsychotherapie traumatisierter Patienten in homogenen Gruppen
- 5.3 Supportive Gruppentherapien
- 5.4 Psychodynamische Gruppentherapien
- 5.5 Kognitiv-behaviorale Gruppentherapien
- 5.6 Ergebnisse empirischer Studien
- 5.7 Das Göttinger Modell
- 6. Ehe- und Familientherapie
- 6.1 Theoretischer Rahmen
- 6.2 Systemische Therapieansätze
- 6.3 Supportive Therapieansätze
- 6.4 Indikation
- 6.5 Forschungsergebnisse
- 7. Kreative Therapien
- 7.1 Definition
- 7.2 Klinische Bedingungen für den Einsatz kreativer Verfahren zur Traumatherapie
- 7.3 Behandlungskonzepte
- 7.4 Indikation
- 7.5 Techniken
- 7.6 Empirische und klinische Befunde
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit gibt einen Überblick über verschiedene Therapieansätze in der Traumatherapie. Ziel ist es, die verschiedenen Methoden, ihre theoretischen Grundlagen und empirischen Befunde darzustellen und zu vergleichen. Der Fokus liegt auf der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS).
- Vergleich verschiedener Therapiemethoden (psychodynamisch, kognitiv-behavioral, kreativ)
- Widerstände und Abwehrmechanismen bei traumatisierten Patienten
- Theoretische Grundlagen und Behandlungstechniken
- Empirische Forschungsergebnisse zu den jeweiligen Therapiemethoden
- Rollen von Ehe- und Familientherapie im Kontext von Traumata
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung differenziert zwischen postexpositorischer Traumatherapie (akut nach dem Trauma) und der Therapie traumatischer Prozesse (längere Zeit nach dem Trauma, oft mit Persönlichkeitsveränderungen). Sie betont die Schwierigkeit, diese beiden Ansätze in der Praxis strikt zu trennen und kündigt die Fokussierung auf Verfahren der akuten Traumatherapie an.
2. Allgemeines zur Traumatherapie: Dieses Kapitel behandelt zunächst die Herausforderungen in der Traumatherapie, insbesondere die Bedeutung der Auseinandersetzung des Therapeuten mit der eigenen Traumageschichte, um Verzerrungen im Therapieprozess zu vermeiden. Es wird der Einfluss von Egozentrismus und die Tendenz, Opfern die Schuld zuzuweisen, kritisch beleuchtet und der "Täuschungseffekt der Retrospektive" als Mechanismus dieser Schuldzuweisung erklärt. Anschließend werden grundlegende Regeln der Traumatherapie nach Wilson (1989) vorgestellt, mit dem Fokus auf nicht-beurteilender Akzeptanz des Opfers.
3. Psychodynamische Therapien: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene psychodynamische Therapieansätze bei der Behandlung von Traumata. Es werden allgemeine Therapieansätze, Indikationen, Forschungsergebnisse und spezifische Methoden wie die psychoanalytische Fokaltherapie nach Lindy und die psychodynamische Therapie nach Horowitz vorgestellt und erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf der Aufarbeitung unbewusster Konflikte und der Integration traumatischer Erfahrungen in die Persönlichkeit.
4. Kognitive Verhaltenstherapien: Dieses Kapitel widmet sich kognitiv-behavioralen Therapien für Traumata. Es erläutert den theoretischen Rahmen, verschiedene Behandlungstechniken, und präsentiert empirische Forschungsbelege für die Wirksamkeit der Verfahren. Spezifische Ansätze wie die Breitspektrum-Therapie nach Scrignar und die dialektisch-behaviorale Therapie für Borderline-Patienten werden detailliert beschrieben. Der Fokus liegt auf der Veränderung von kognitiven Verzerrungen und maladaptiven Verhaltensmustern.
5. Gruppentherapie: Dieses Kapitel beleuchtet die Anwendung von Gruppentherapie bei traumatisierten Patienten. Es werden verschiedene Formen der Gruppentherapie (supportiv, psychodynamisch, kognitiv-behavioral) vorgestellt, und die Ergebnisse empirischer Studien diskutiert. Das Göttinger Modell wird als Beispiel für eine spezifische Form der Gruppentherapie erläutert. Der Fokus liegt auf dem Nutzen von Gruppendynamik und dem Austausch von Erfahrungen unter Betroffenen.
6. Ehe- und Familientherapie: Dieser Abschnitt untersucht den Einsatz von Ehe- und Familientherapie bei Traumafolgestörungen. Es werden systemische und supportive Therapieansätze vorgestellt, Indikationen und Forschungsergebnisse diskutiert. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Beziehungen und Familiendynamiken in der Traumaverarbeitung und der Unterstützung von Betroffenen und deren Umfeld.
7. Kreative Therapien: Dieses Kapitel beschreibt kreative Therapiemethoden in der Traumatherapie. Es werden Definitionen, klinische Einsatzbedingungen, Behandlungskonzepte, Indikationen, Techniken und empirische Befunde diskutiert. Der Fokus liegt auf dem Einsatz von Kunst, Musik oder anderen kreativen Ausdrucksformen zur Verarbeitung traumatischer Erfahrungen.
Schlüsselwörter
Traumatherapie, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Psychodynamische Therapie, Kognitive Verhaltenstherapie, Gruppentherapie, Ehe- und Familientherapie, Kreative Therapien, Abwehrmechanismen, Forschungsergebnisse, Behandlungstechniken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Überblick über verschiedene Therapieansätze in der Traumatherapie
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Therapieansätze in der Traumatherapie, mit besonderem Fokus auf die Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS). Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Die behandelten Therapieansätze umfassen psychodynamische Therapien, kognitive Verhaltenstherapien, Gruppentherapien, Ehe- und Familientherapie sowie kreative Therapien. Der Text vergleicht die verschiedenen Methoden, ihre theoretischen Grundlagen und empirischen Befunde.
Welche Therapieansätze werden im Detail behandelt?
Der Text behandelt detailliert psychodynamische Therapien (inkl. Ansätze nach Lindy und Horowitz), kognitive Verhaltenstherapien (inkl. Breitspektrum-Therapie nach Scrignar und dialektisch-behavioral Therapie), Gruppentherapien (supportiv, psychodynamisch, kognitiv-behavioral, Göttinger Modell), Ehe- und Familientherapie (systemisch und supportiv) und kreative Therapien. Für jeden Ansatz werden theoretische Grundlagen, Behandlungstechniken, Indikationen, Forschungsergebnisse und spezifische Methoden erläutert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Schwerpunkte liegen auf dem Vergleich verschiedener Therapiemethoden, der Darstellung von Widerständen und Abwehrmechanismen bei traumatisierten Patienten, den theoretischen Grundlagen und Behandlungstechniken, den empirischen Forschungsergebnissen zu den jeweiligen Therapiemethoden und der Rolle von Ehe- und Familientherapie im Kontext von Traumata. Der Text differenziert auch zwischen akuter Traumatherapie und der Therapie traumatischer Prozesse über einen längeren Zeitraum.
Wie werden die einzelnen Kapitel zusammengefasst?
Jedes Kapitel (Einleitung, Allgemeines zur Traumatherapie, Psychodynamische Therapien, Kognitive Verhaltenstherapien, Gruppentherapie, Ehe- und Familientherapie, Kreative Therapien) wird in einer kurzen Zusammenfassung dargestellt. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über die wichtigsten Inhalte und Erkenntnisse des jeweiligen Kapitels.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Die Schlüsselwörter umfassen Traumatherapie, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Psychodynamische Therapie, Kognitive Verhaltenstherapie, Gruppentherapie, Ehe- und Familientherapie, Kreative Therapien, Abwehrmechanismen, Forschungsergebnisse und Behandlungstechniken.
Was ist das Ziel des Textes?
Ziel des Textes ist es, einen Überblick über verschiedene Therapieansätze in der Traumatherapie zu geben, die verschiedenen Methoden, ihre theoretischen Grundlagen und empirischen Befunde darzustellen und zu vergleichen. Der Fokus liegt auf der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS).
Wer ist die Zielgruppe dieses Textes?
Der Text richtet sich an Personen, die sich akademisch mit Traumatherapie auseinandersetzen, beispielsweise Studierende der Psychologie, Psychotherapeuten und andere Fachkräfte im Gesundheitswesen. Der Text ist für eine strukturierte und professionelle Themenanalyse im akademischen Kontext konzipiert.
- Arbeit zitieren
- Nicola Ferdinand (Autor:in), Gernot Quinten (Autor:in), 2002, Traumatherapie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16302