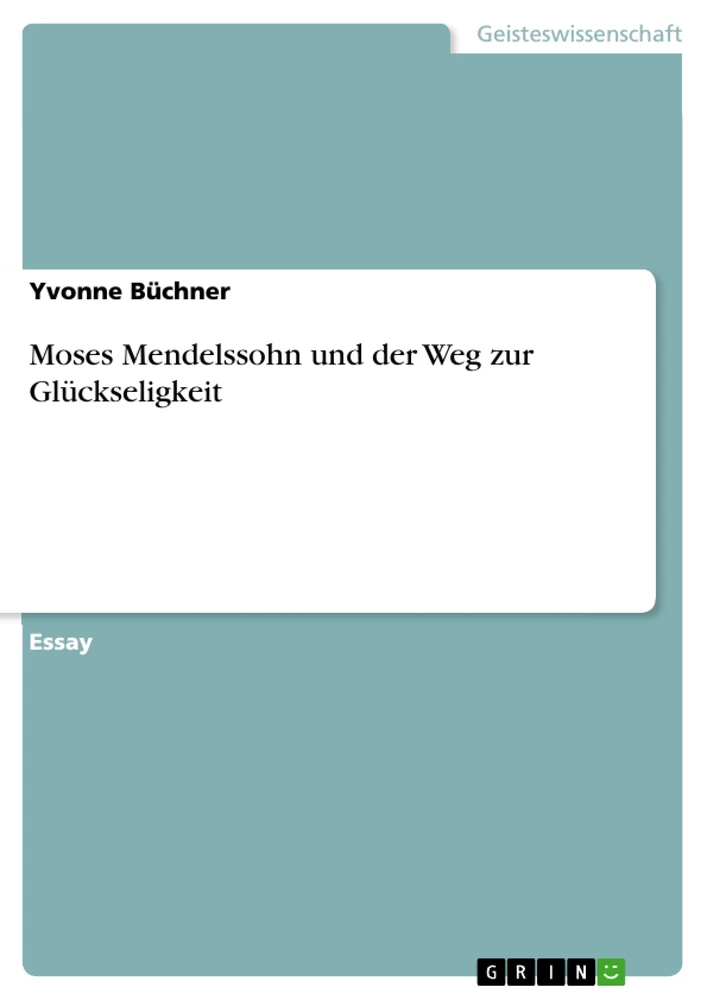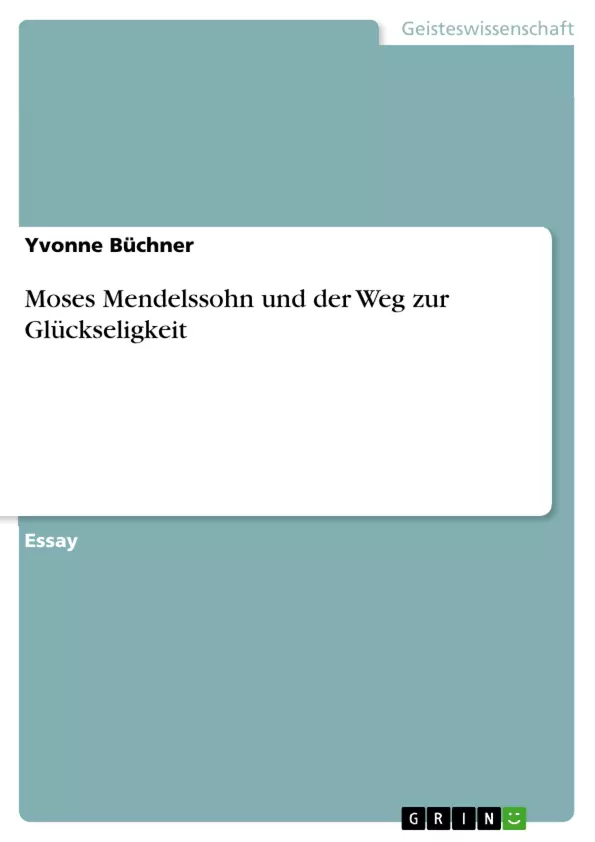Der Dessauer Familie Heymann wird am 6. September 1729 ein kleiner Junge geboren, welcher den Namen Moses erhält und später zum Stern der Haskala- der jüdischen Aufklärung werden wird. Die Heymanns ahnten damals noch nicht, dass ihr Söhnchen einmal der Vorreiter der jüdischen Emanzipationsbewegung in Deutschland wenn nicht gar in ganz Europa, als Berliner Sokrates sowie als Brückenbauer und Vermittler zwischen Juden und Christen gelten wird. Der Vater Mendel erkannte aber schon früh die Hochbegabung seines Sohnes und förderte ihn trotz geringer finanzieller Mittel sehr gut. Bereits als 10- jähriger lernte Moses Hebräisch und Aramäisch, auch begann er mit dem Talmudstudium bei dem berühmten Oberrabbiner David Fränkel in diesem Alter. Mit 13 Jahren (andere Quellen sprechen von 14 Jahren) folgte er seinem Lehrer nach Berlin. In den nächsten Jahren wird er sich dort unter ärmsten Verhältnissen und beinahe autodidaktisch die Sprachen Deutsch, Latein, Französisch und Englisch beibringen, sowie sich mit der Philosophie und der christlichen Lebensweise vertraut machen. Auf diesem Fundament beginnt Moses Mendelssohn 1750 mit seiner philosophischen „Öffentlichkeitsarbeit“, welche ihm in seinen 57 Lebensjahren viel Bewunderung und Freundschaften aber noch vielmehr Kritik, Verletzungen und Kummer einbringen wird. Speziell die ständigen Rechtfertigungen gegen die Anfeindungen wegen seines jüdischen Glaubens verletzten ihn tief. Obgleich Mendelssohn viele berühmte Theologen und Philosophen, unter ihnen Kant und Herder beistanden und verteidigten, führten diese Auseinandersetzungen bei Mendelssohn zu einer Schaffenskrise. Mendelssohn pflegte Freundschaften zu vielen der Großen Schriftsteller und Philosophen seiner Zeit. Sein vielleicht engster Freund Gotthold Ephraim Lessing nahm seinen jüdischen Freund als Vorbild für die Figur des „Nathan der Weise“ und setzte ihm so ein Denkmal. Eine andere tiefe Freundschaft verband Mendelssohn mit dem jungen Geschichtsprofessor und Philosophen Thomas Abbt aus Rinteln. In ihren Briefen diskutierten die beiden Philosophen vor allem die Frage nach der Unsterblichkeit der Seele und über Platons Werk „Phaidon“, in dem die letzten Tage des Sokrates vor dessen Hinrichtung beschrieben werden. Als 1767 Abbt achtundzwanzigjährig stirbt, widmet ihm Mendelssohn seinen „Phaedon – oder über die Unsterblichkeit der Seele in drey Gesprächen“.
Inhaltsverzeichnis
- Moses Mendelssohn und der Weg zur Glückseligkeit
- Der Weg zur Glückseligkeit
- Die philosophischen Gespräche des Moses Mendelssohn
- Die Seele und ihre Unsterblichkeit
- Die Frage nach der Unsterblichkeit
- Die Harmonie des Erkennens
- Die Harmonie des Erkennens
- Das Zusammenspiel von Körper und Seele
- Die Aufgabe der Vernunft
- Die Wahrheit und die Vernunft
- Die Harmonie des Erkennens
- Die Frage nach dem Ursprung der Seele
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abhandlung befasst sich mit dem Leben und Werk des Philosophen Moses Mendelssohn, insbesondere mit seinem Werk „Phädon - oder über die Unsterblichkeit der Seele in drey Gesprächen“. Die Arbeit analysiert die Argumentation Mendelssohns für die Unsterblichkeit der Seele und untersucht die Verbindung zwischen seinen philosophischen Ideen und der platonischen Tradition.
- Moses Mendelssohns „Phädon“ als Beweis für die Unsterblichkeit der Seele
- Die Verbindung zwischen klassischen jüdisch-christlichen und antiken Vorstellungen in Mendelssohns Werk
- Die Rolle der Vernunft und des Erkennens in der philosophischen Argumentation Mendelssohns
- Die Frage nach dem Ursprung und der Funktion der Seele in der Philosophie Mendelssohns
- Die Auseinandersetzung mit Simmias und Cebes' Zweifeln an der Unsterblichkeit der Seele
Zusammenfassung der Kapitel
Die Abhandlung beginnt mit einer kurzen Einführung in das Leben und Werk von Moses Mendelssohn. Anschließend wird Mendelssohns „Phädon“ vorgestellt und der Zusammenhang mit dem platonischen Original erläutert. Die Arbeit konzentriert sich dann auf die Analyse des zweiten Gesprächs in Mendelssohns „Phädon“, in dem Sokrates seine Thesen über die Unsterblichkeit der Seele und die Existenz Gottes verteidigt.
Simmias und Cebes äußern ihre Zweifel an der Unsterblichkeit der Seele, die Sokrates durch verschiedene Argumente zu widerlegen versucht. Er argumentiert, dass die Unsterblichkeit der Seele eine notwendige Voraussetzung für die menschliche Vernunft und die göttliche Bestimmung des Menschen ist. Sokrates führt weiter aus, dass die Seele nicht aus einzelnen Teilen zusammengesetzt sein kann, sondern ein eigenständiges und unteilbares Wesen ist.
Schlüsselwörter
Moses Mendelssohn, Phädon, Unsterblichkeit der Seele, Vernunft, Erkenntnis, göttliche Bestimmung, Harmonie, Philosophie, Platon, Dialogform, Simmias, Cebes, Gotteswirken.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Moses Mendelssohn?
Moses Mendelssohn (1729–1786) war ein bedeutender jüdischer Philosoph der Aufklärung (Haskala), bekannt als „Berliner Sokrates“ und Brückenbauer zwischen Juden und Christen.
Worum geht es in Mendelssohns Werk „Phädon“?
In Anlehnung an Platon diskutiert Mendelssohn in drei Gesprächen die Unsterblichkeit der Seele und liefert philosophische Beweise für deren Fortbestehen nach dem Tod.
Wie begründet Mendelssohn die Unsterblichkeit der Seele?
Er argumentiert, dass die Seele ein unteilbares Wesen ist und die menschliche Vernunft sowie die göttliche Bestimmung eine unsterbliche Existenz voraussetzen.
Welche Rolle spielt die Vernunft in seinem Werk?
Die Vernunft ist für Mendelssohn das Werkzeug, um zur Wahrheit und zur Erkenntnis der göttlichen Ordnung zu gelangen, was letztlich zur „Glückseligkeit“ führt.
In welcher Beziehung stand Mendelssohn zu Lessing?
Mendelssohn war eng mit Gotthold Ephraim Lessing befreundet. Lessing nahm Mendelssohn als Vorbild für die Titelfigur in seinem berühmten Werk „Nathan der Weise“.
Warum wurde Mendelssohn oft angefeindet?
Trotz seiner philosophischen Anerkennung sah er sich ständig Angriffen wegen seines jüdischen Glaubens ausgesetzt und musste sich oft gegen Bekehrungsversuche und Vorurteile rechtfertigen.
- Quote paper
- Yvonne Büchner (Author), 2010, Moses Mendelssohn und der Weg zur Glückseligkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163065