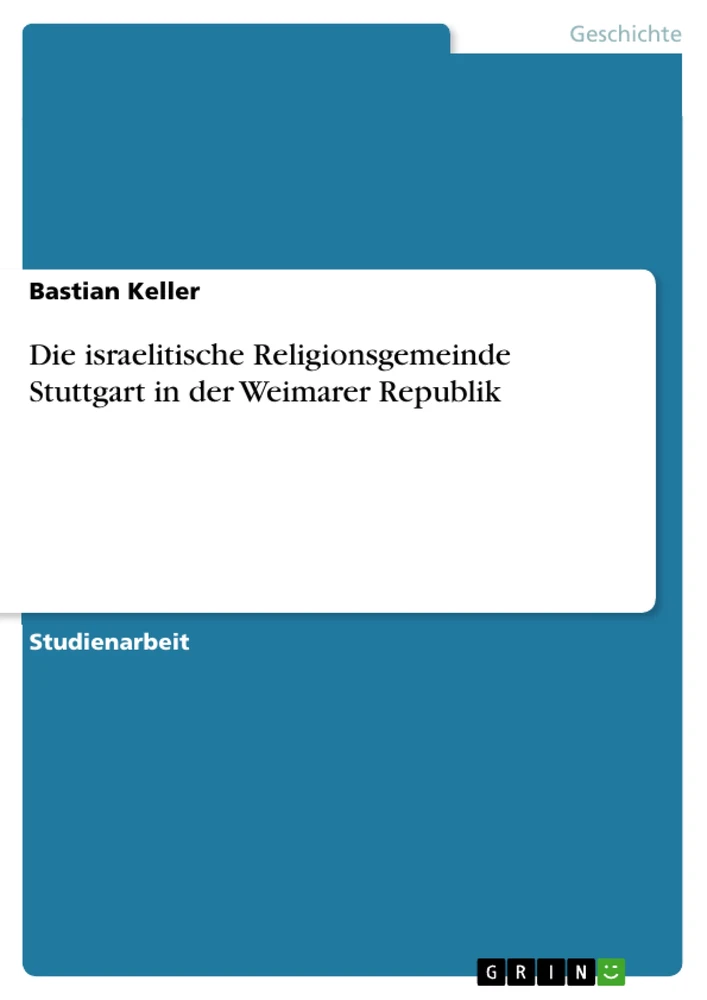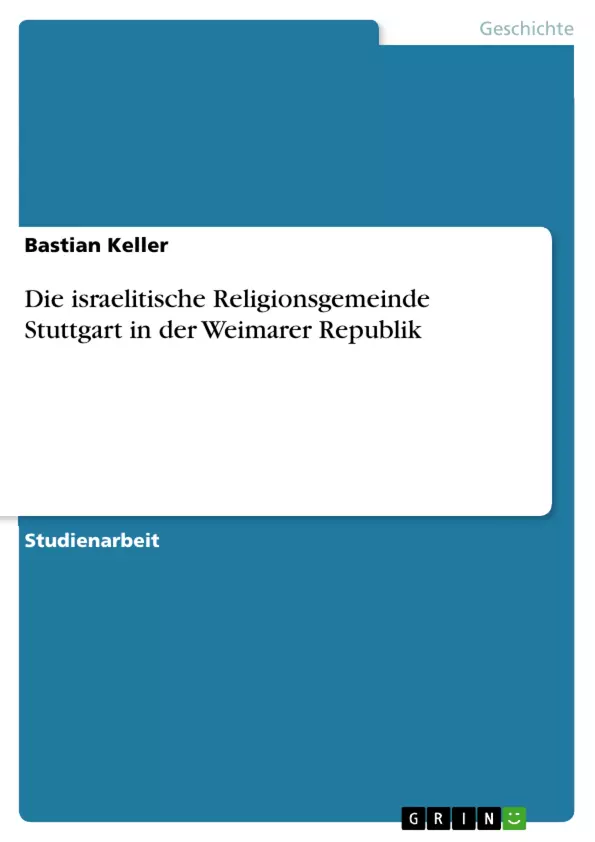Unter dem württembergischen König Wilhelm I. wurde am 27. April 1831 durch eine Verordnung die „Königliche Israelitische Oberkirchenbehörde“, genannt Israelitischer Oberrat, mit Hauptsitz in Stuttgart geschaffen. Sie unterstand dem Ministerium des Innern und war somit ein Bestandteil des Staatskirchentums.
Die vorherigen Synagogengemeinden in Württemberg wurden mit der Verordnung vom 27. April 1831 zu „jüdischen Kirchengemeinden“ umbenannt, obwohl der Begriff „Kirche“ beim Judentum ungebräuchlich und fremd ist.
Die Gründung der „jüdischen Kirchengemeinde“ Stuttgart fiel auf den 3. August 1832. Mit Beginn umfasste diese 15 Familien mit insgesamt 124 Seelen. Erster Rabbiner wurde das theologische Mitglied der Israelitischen Oberkirchenbehörde Dr. Joseph Maier, der am 21. November 1834 vom Ministerium des Innern ernannt wurde.
Das 19. Jahrhundert war für die Mitglieder der „jüdischen Kirchengemeinde“ Stuttgart eine Zeit des rasanten sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aufstieges. Noch im 18. Jahrhundert und teilweise ins 19. Jahrhundert hinein lebten die Juden in ganz Württemberg in ärmlichen Verhältnissen und führten ein Leben am Rande der bürgerlichen Gesellschaft.
Sie waren durch ihren jüdischen Glauben sozial und wirtschaftlich isoliert. Bildungs-, Ausbildung- und Aufstiegschancen sind ihnen am Rand der Gesellschaft verwehrt geblieben. Rechtlich gesehen waren die württembergischen Juden mit der christlichen Bevölkerung nicht gleichberechtigt. Die württembergischen Juden wurden in ihrem Leben durch besondere Gesetze eingeschränkt und diskriminiert.
Ein erster wichtiger Schritt zur rechtlichen Gleichberechtigung war das „Gesetz in Betreff der öffentlichen Verhältnisse der israelitischen Glaubensgenossen“ vom 8. Mai 1828, auch „Erziehungsgesetz“ genannt. Darin heißt es in Artikel 1: „Die im Königreiche einheimischen Israeliten genießen, so weit nicht das gegenwärtige Gesetz eine Ausnahme begründet, die Rechte der Württembergischen Unterthanen. Sie sind allen bürgerlichen Gesetzten unterworfen und haben alle Pflichten und Leistungen der übrigen Unterthanen zu erfüllen.“
Mit dem Tod von König Wilhelm I., der auch als Protektor der Juden bezeichnet wird, endete aber der Aufstieg der Stuttgarter Juden nicht. Er wurde weitergeführt. Denn König Karl I. war gegenüber den württembergischen Juden gutgesinnt und setzte sich weiterhin für deren Belange ein.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1 Die israelitische Religionsgemeinde Stuttgart
- 1.2 Definition der Fragestellung
- II. Der jüdische „Adel“
- III. Die jüdische „Kerngemeinde“
- IV. Die Dorfjuden
- V. Die Ostjuden
- VI. Liberalismus und Orthodoxie
- VI.1 Liberalismus und Judentum
- VI.2 Das orthodoxe Judentum
- VI.3 Deutscher Patriotismus und Zionismus
- VII. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Geschichte der israelitischen Religionsgemeinde Stuttgart in der Weimarer Republik. Sie untersucht die Entwicklung der Gemeinde von ihren Anfängen im 19. Jahrhundert bis zum Ende der Weimarer Republik. Die Arbeit beleuchtet insbesondere den Einfluss von Liberalismus und Orthodoxie auf die Gemeinde und die Rolle, die die Stuttgarter Juden im öffentlichen und wirtschaftlichen Leben der Stadt spielten.
- Die Entwicklung der israelitischen Religionsgemeinde Stuttgart im 19. und 20. Jahrhundert
- Der Einfluss von Liberalismus und Orthodoxie auf die Gemeinde
- Die Integration der Stuttgarter Juden in die bürgerliche Gesellschaft
- Die Rolle der Stuttgarter Juden im öffentlichen und wirtschaftlichen Leben der Stadt
- Der Einfluss des Staatskirchentums auf die Gemeinde
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Dieses Kapitel stellt die israelitische Religionsgemeinde Stuttgart und die Fragestellung der Arbeit vor.
- II. Der jüdische „Adel“: Dieses Kapitel befasst sich mit der Geschichte der jüdischen „Adelsfamilien“ in Stuttgart.
- III. Die jüdische „Kerngemeinde“: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der „Kerngemeinde“ der Stuttgarter Juden.
- IV. Die Dorfjuden: Dieses Kapitel beschreibt die Situation der Dorfjuden in Württemberg.
- V. Die Ostjuden: Dieses Kapitel behandelt die Geschichte der Ostjuden in Stuttgart.
- VI. Liberalismus und Orthodoxie: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen von Liberalismus und Orthodoxie auf die israelitische Religionsgemeinde Stuttgart.
Schlüsselwörter
Israelitische Religionsgemeinde Stuttgart, Weimarer Republik, Judentum, Liberalismus, Orthodoxie, Integration, Staatskirchentum, soziale und wirtschaftliche Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen zum Judentum in Stuttgart
Wann wurde die jüdische Gemeinde in Stuttgart gegründet?
Die offizielle Gründung der „jüdischen Kirchengemeinde“ Stuttgart erfolgte am 3. August 1832 mit zunächst 15 Familien.
Was war der „Israelitische Oberrat“?
Eine 1831 geschaffene Behörde in Stuttgart, die dem Ministerium des Innern unterstand und Teil des Staatskirchentums war.
Wie unterschieden sich Liberalismus und Orthodoxie in der Gemeinde?
Die Arbeit analysiert die Spannungen zwischen der bürgerlichen Integration (Liberalismus) und der Bewahrung traditioneller religiöser Gesetze (Orthodoxie).
Welche Rolle spielten die „Ostjuden“ in Stuttgart?
Die Einwanderung von Juden aus Osteuropa brachte neue kulturelle Einflüsse und soziale Herausforderungen für die bestehende Gemeinde mit sich.
Was war das „Erziehungsgesetz“ von 1828?
Ein wichtiger Schritt zur rechtlichen Gleichberechtigung, der den württembergischen Juden die Rechte und Pflichten von Staatsbürgern zusprach.
- Citation du texte
- Bastian Keller (Auteur), 2010, Die israelitische Religionsgemeinde Stuttgart in der Weimarer Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163083