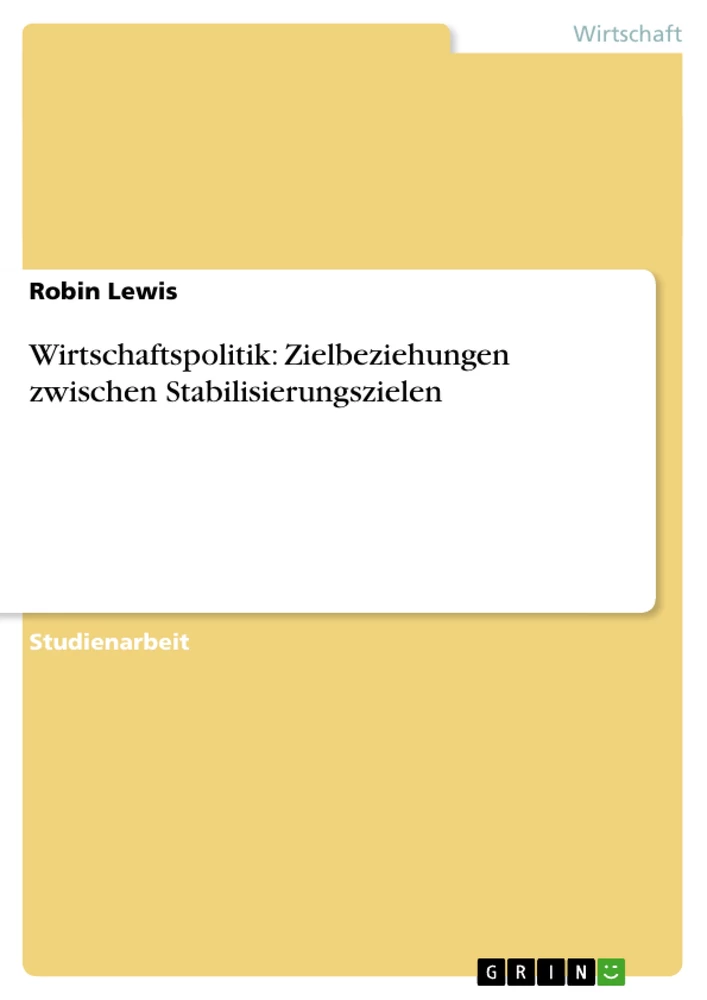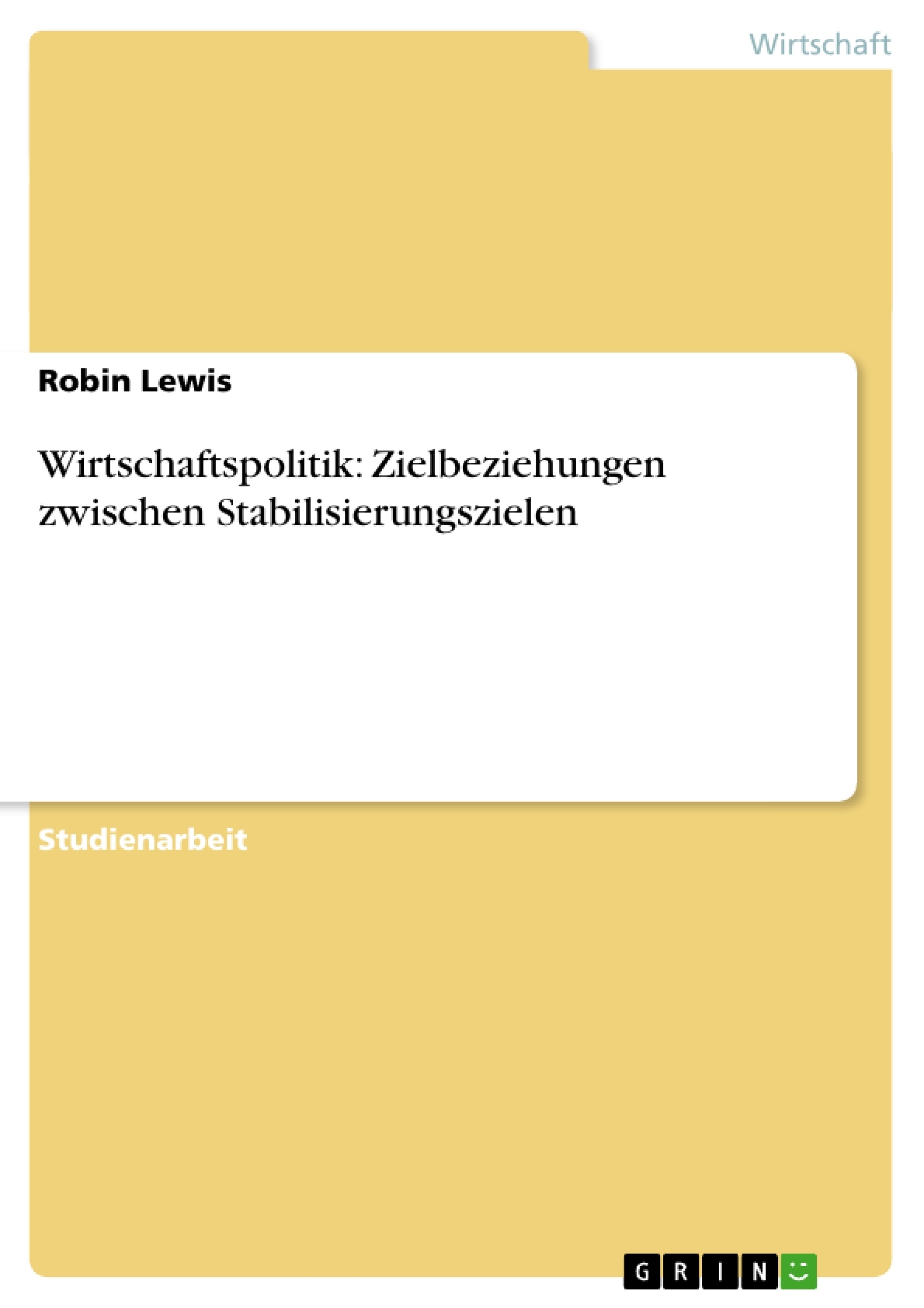Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Zielbeziehungen zwischen den Stabilisierungszielen in der Bundesrepublik Deutschland.
Um näher auf die Stabilisierungsziele eingehen zu können müssen zunächst die Begriffe Stabilitäts- und Stabilisierungspolitik unterschieden werden.
· Unter Stabilitätspolitik versteht man sämtliche wirtschaftspolitischen Massnahmen des Staates, die darauf ausgerichtet sind eine langfristige Stabilität des Geldwertes und des Preisniveaus zu garantieren.
· Unter Stabilisierungspolitik versteht man staatliche Massnahmen, mit denen gleichzeitig mehrere gesamtwirtschaftliche Ziele wie z. B. Preisniveaustabilität, Vollbeschäftigung oder stetiges Wirtschaftswachstum realisiert werden sollen.
Die Realisierung mehrerer wirtschaftlicher Ziele zur gleichen Zeit wird in der Literatur auch häufig als Globalsteuerung bezeichnet.
Um die kontinuierliche Stabilisierung einer Volkwirtschaft zu gewährleisten muss der Staat im Rahmen der Stabilisierungspolitik danach streben, die folgenden Stabilisierungsziele zu erreichen.
· Vollbeschäftigung
· Preisniveau- und Geldwertstabilität
· Stetiges Wirtschaftswachstum
· Ausgewogenes aussenwirtschaftliches Gleichgewicht
· Gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung
Ziel der Arbeit soll es sein nach einer kurzen Einführung in das Thema Stabilisierungspolitik und einer näheren Erläuterung der einzelnen Stabilisierungsziele, einen umfassenden Überblick darüber zu geben in welcher Beziehung die einzelnen Ziele zueinander stehen und an welchen Stellen sie sich ergänzen, beziehungsweise überschneiden.
Dem Staat stehen zur Erreichung dieser Ziele verschiedene Instrumente zur Verfügung, auf deren Bedeutung zu einem späteren Punkt in dieser arbeit Bezug genommen wird.
Zunächst werden jedoch im folgenden Kapitel die theoretischen Ansätze zur stabilisierungspolitischen Konzeption näher beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Ansätze zur stabilisierungspolitischen Konzeption
- Ansätze nach Keynes
- Ansätze der Neoklassik
- Stabilisierungspolitik
- Ziele des Stabilitätsgesetzes
- Stabilisierungspolitische Ziele
- Instrumente und Träger der Stabilisierungspolitik
- Zielbeziehungen der Stabilisierungsziele
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beziehungen zwischen den Stabilisierungszielen in der Bundesrepublik Deutschland. Dabei wird zunächst zwischen Stabilitätspolitik und Stabilisierungspolitik unterschieden und die einzelnen Ziele der Stabilisierungspolitik, wie Vollbeschäftigung, Preisniveau- und Geldwertstabilität, stetiges Wirtschaftswachstum, aussenwirtschaftliches Gleichgewicht und gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung, erläutert.
- Differenzierung zwischen Stabilitätspolitik und Stabilisierungspolitik
- Erläuterung der einzelnen Stabilisierungsziele
- Analyse der Beziehungen zwischen den Stabilisierungszielen
- Bedeutung der Instrumente der Stabilisierungspolitik
- Theoretische Ansätze zur stabilisierungspolitischen Konzeption
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Unterscheidung zwischen Stabilitätspolitik und Stabilisierungspolitik. Sie führt die wichtigsten Stabilisierungsziele auf und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Theoretische Ansätze zur stabilisierungspolitischen Konzeption
Dieses Kapitel beleuchtet die keynesianischen und neoklassischen Ansätze zur Konzeption der Stabilisierungspolitik. Es werden die jeweiligen theoretischen Grundannahmen und die Rolle des Staates in der Steuerung der Wirtschaft diskutiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Fokus-Themen der Arbeit sind: Stabilisierungspolitik, Stabilitätspolitik, Wirtschaftspolitik, Vollbeschäftigung, Preisniveau- und Geldwertstabilität, stetiges Wirtschaftswachstum, aussenwirtschaftliches Gleichgewicht, Einkommens- und Vermögensverteilung, Keynesianismus, Neoklassik, Globalsteuerung, Instrumente der Wirtschaftspolitik, Zielbeziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Stabilitäts- und Stabilisierungspolitik?
Stabilitätspolitik zielt langfristig auf den Geldwert ab, während Stabilisierungspolitik kurz- bis mittelfristig mehrere Ziele wie Wachstum und Vollbeschäftigung gleichzeitig verfolgt.
Was sind die fünf zentralen Stabilisierungsziele?
Vollbeschäftigung, Preisniveaustabilität, stetiges Wirtschaftswachstum, außenwirtschaftliches Gleichgewicht sowie gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung.
Was versteht man unter 'Globalsteuerung'?
Die gleichzeitige Beeinflussung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage durch den Staat, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Wie unterscheiden sich Keynesianismus und Neoklassik in der Stabilisierungspolitik?
Keynesianer setzen auf staatliche Nachfragesteuerung, während die Neoklassik die Selbstheilungskräfte des Marktes und angebotsorientierte Maßnahmen betont.
Gibt es Konflikte zwischen den Stabilisierungszielen?
Ja, oft stehen Ziele im Konflikt, wie etwa Preisstabilität und Vollbeschäftigung (Phillipps-Kurve), was eine sorgfältige Abwägung der Instrumente erfordert.
- Quote paper
- Robin Lewis (Author), 2003, Wirtschaftspolitik: Zielbeziehungen zwischen Stabilisierungszielen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16309