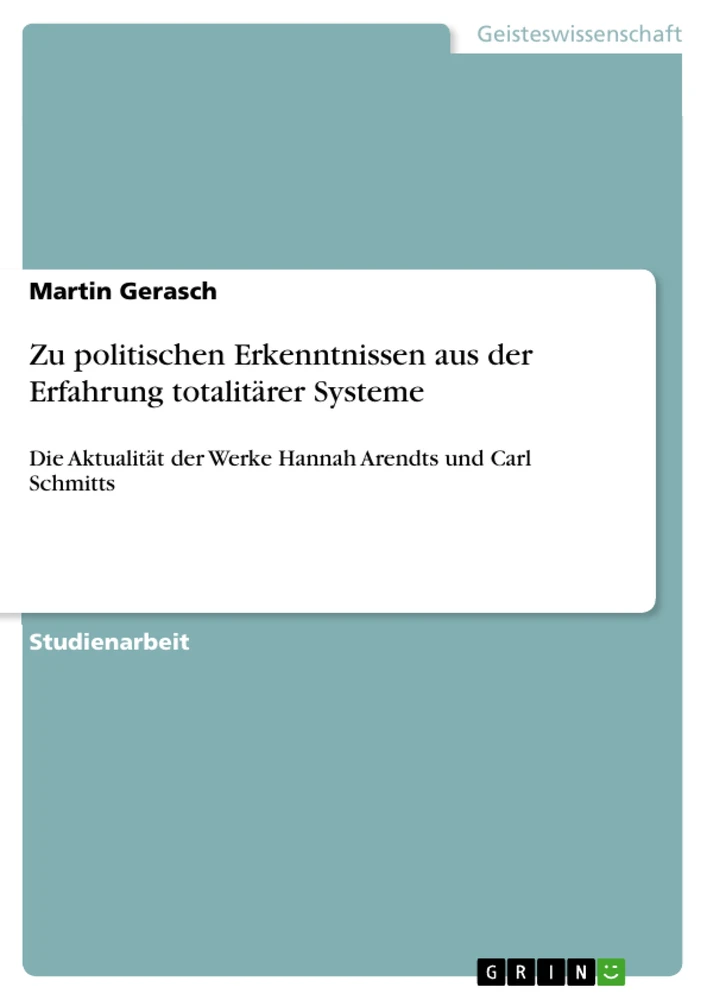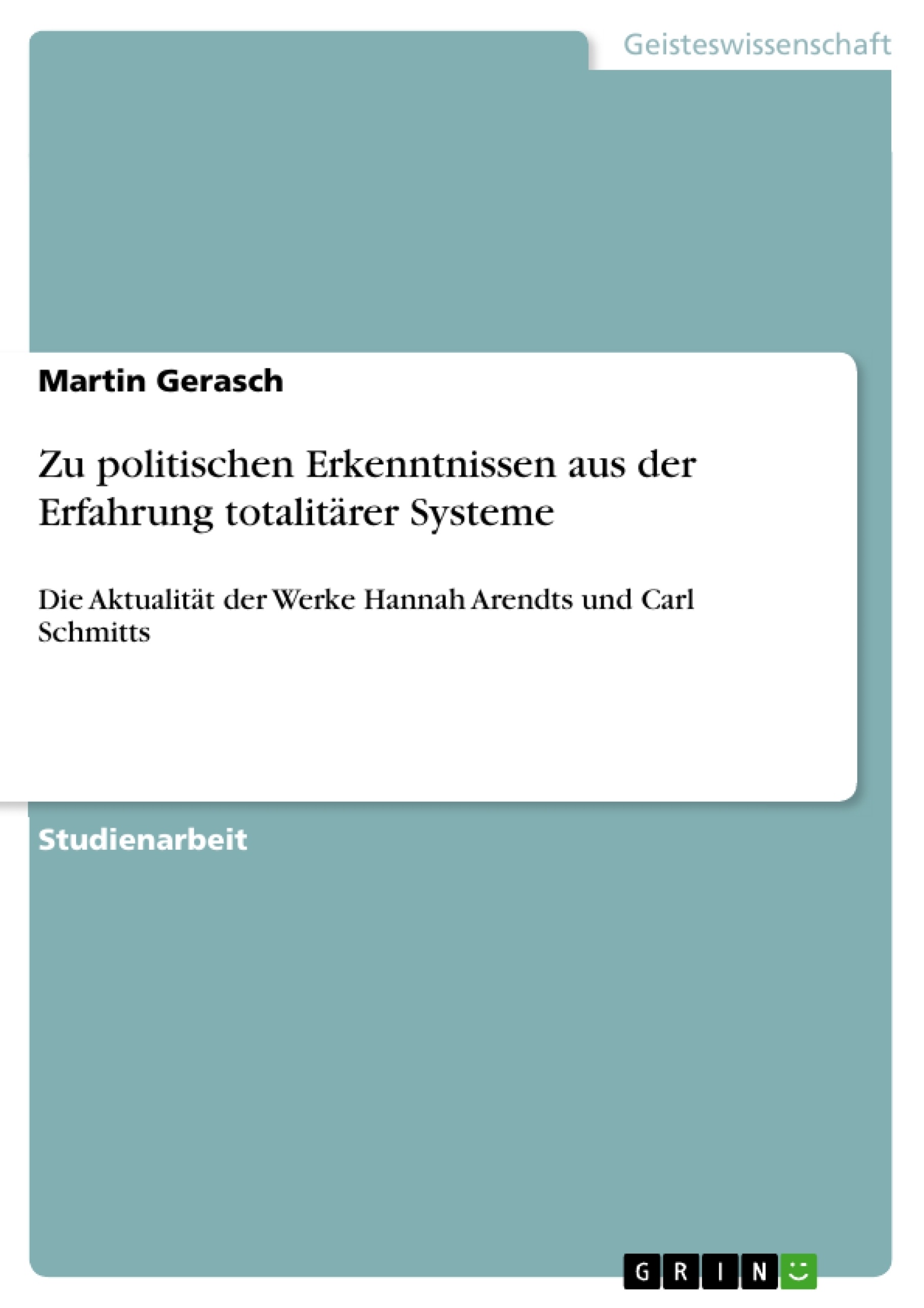„Es gibt in der LTI keinen anderen Übergriff technischer Wörter, der die Tendenz des Mechanisierens und Automatisierens so nackt zutage treten ließe wie dieses ’gleichschalten.’ […] Der immer wiederholte Übergriff, das Ausspinnen des Technischen, das Schwelgen in ihm: Weimar kennt nur das Ankurbeln der Wirtschaft, die LTI fügt nicht nur das Auf-volle-Touren-Kommen hinzu, sondern auch ’die gut eingespielte Lenkung’ – alles dies […] legt Zeugnis ab für die tatsächliche Missachtung der vorgeblicherweise geschätzten und gehegten Persönlichkeit, für den Willen zur Unterdrückung des selbständig denkenden, des freien Menschen.“
Dies gehört zu Victor Klemperers Erfahrungen mit der Sprache des Nationalsozialismus. Er erkennt in ihr die „Verdinglichung“ des Menschen, die dessen bloße Funktion im totalen System in den Vordergrund rückt.
Mit diesem Phänomen setzte sich auch Hannah Arendt auseinander. Im Wissen, dass Worte Aufschluss über das „Wer-einer-ist“ verschaffen, betrachtete sie neben der Sprache des Nationalsozialismus auch die des Stalinismus. Arendt ging in ihrer Analyse noch weiter als Klemperer und erkannte, dass KZ und Gulag als Idealmodell des totalitären Systems fungieren. Sie sind der Inbegriff der Entmenschlichung und machen aus der Pluralität der Menschen den Menschen. Jener soll zu keinerlei freien Handlungen und Spontaneität fähig sein. Dies setzt Arendt mit der Vernichtung der dem Menschen eigenen Natalität gleich. Eine Massenbewegung gehört zu den sechs Wesenszügen durch die Arendt aber auch Carl Joachim Friedrich totalitäre Regime charakterisierten. Wie kommt es aber zu solch einer „atomisierten Masse“ und warum ist gerade dieser Faktor für die totalitären Systeme so wichtig?
Um dies zu beantworten, möchte ich einige Begriffe näher erläutern, die Arendt in ihren Werken verwendet. Dazu gehört die Differenzierung von Mob und Masse im 19. und 20. Jahrhundert. Bei dieser Thematik sind Klassenlosigkeit, Atomisierung, Pluralismus und Natalität entscheidende Termini.
Als Literatur sind hierbei Arendts Hauptwerke „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ und „Vita activa“ sehr hilfreich. Der Schlussfolgerung, dass totalitäre Regime im Gegensatz zur Tyrannei nicht nur apolitisch, sondern antipolitisch seien , kann man einiges über Hannah Arendts Politikbegriff entnehmen. Mit der Überzeugung, dass der Sinn der Politik in der Freiheit liege, äußerte sie sich konträr zu Carl Schmitt, der oft als juristischer „Steigbügelhalter“ der Nazis gesehen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Die Bedeutung der atomisierten Masse in der totalen Herrschaft
- II. KZ und Gulag – Die Rolle der Lager bei der Verdinglichung der Menschen
- III. Besser,,Herstellen\" als „Handeln\"?
- IV. Sprechen und Handeln - H. Arendts Begriff der Politik
- V. Freund und Feind – Aspekte Carl Schmitts politischer Theorie
- VI. Gegner statt Feind? - Bezüge zur aktuellen Politik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Werke Hannah Arendts und Carl Schmitts im Kontext totalitärer Systeme und untersucht deren Aktualität für die heutige Zeit. Sie beleuchtet die Instrumentalisierung der Masse durch totalitäre Regime und die Entstehung von Politikverdrossenheit in der heutigen „Postdemokratie".
- Die Rolle der atomisierten Masse in totalitären Systemen
- Die Verdinglichung des Menschen in KZ und Gulag
- Hannah Arendts Politikbegriff und die Unterscheidung von „Handeln“ und „Herstellen“
- Carl Schmitts Freund-Feind-Schema und dessen Bedeutung für das Politische
- Die aktuelle Debatte über „Postdemokratie“ und die Bedeutung politischer Theorien für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die These auf, dass die Werke Hannah Arendts und Carl Schmitts von großer Aktualität sind und wichtige Einblicke in die Funktionsweise totalitärer Systeme und die Herausforderungen der heutigen Politik bieten.
Kapitel I behandelt die Bedeutung der atomisierten Masse für totalitäre Regime. Arendts Analyse der Weimarer Republik zeigt, wie die Auflösung der Klassengesellschaft zu einer unorganisierten und entwurzelten Masse führte, die leicht zu manipulieren war.
Kapitel II untersucht die Rolle von KZ und Gulag in der Verdinglichung des Menschen. Diese Lager dienen als Idealmodelle der totalitären Herrschaft, in denen die Individualität des Menschen zerstört wird und er zu einer austauschbaren Einheit im System wird.
Kapitel III setzt sich mit Arendts Politikbegriff auseinander und beleuchtet die Unterscheidung zwischen „Handeln“ und „Herstellen“. Arendt argumentiert, dass totalitäre Regime das menschliche Handeln durch ein System von „Herstellen“ ersetzen und somit den politischen Raum zerstören.
Kapitel IV analysiert Carl Schmitts Freund-Feind-Schema und seine Bedeutung für das Politische. Schmitt sieht Politik als einen permanenten Kampf zwischen Freund und Feind, wobei die Unterscheidung zwischen diesen Gruppen entscheidend ist.
Kapitel V untersucht die Aktualität der Werke Arendts und Schmitts für die heutige Zeit. Es wird argumentiert, dass die Herausforderungen der „Postdemokratie“, wie z.B. die Politikverdrossenheit und die zunehmende Macht von Lobbyisten, ein vertieftes Verständnis der politischen Theorie erfordern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen der politischen Theorie, wie z.B. totalitäre Herrschaft, atomisierte Masse, Verdinglichung, Politikbegriff, Freund-Feind-Schema, Postdemokratie und Politikverdrossenheit. Sie analysiert die Werke Hannah Arendts und Carl Schmitts und ihre Bedeutung für das Verständnis der aktuellen politischen Situation.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Hannah Arendt unter der „atomisierten Masse“?
Es handelt sich um eine unorganisierte, entwurzelte Bevölkerungsschicht, die nach dem Zerfall der Klassengesellschaft leicht von totalitären Regimen manipuliert werden kann.
Welche Rolle spielen KZ und Gulag in Arendts Analyse?
Sie dienen als Idealmodelle totalitärer Herrschaft, in denen die menschliche Individualität und Natalität (Spontaneität) systematisch vernichtet wird.
Was ist das Freund-Feind-Schema von Carl Schmitt?
Schmitt definiert Politik durch die Unterscheidung zwischen Freund und Feind, was einen permanenten Kampfzustand als Wesen des Politischen impliziert.
Wie unterscheidet Arendt „Handeln“ von „Herstellen“?
Handeln ist freies, politisches Tun unter Gleichen, während Herstellen ein zweckgebundenes, technisches Produzieren ist, das totalitäre Systeme auf den Menschen übertragen.
Was bedeutet der Begriff „Postdemokratie“?
Er beschreibt einen Zustand, in dem formale demokratische Institutionen zwar bestehen, die eigentliche Macht aber bei Lobbyisten und Eliten liegt, was zu Politikverdrossenheit führt.
- Arbeit zitieren
- Martin Gerasch (Autor:in), 2010, Zu politischen Erkenntnissen aus der Erfahrung totalitärer Systeme, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163095