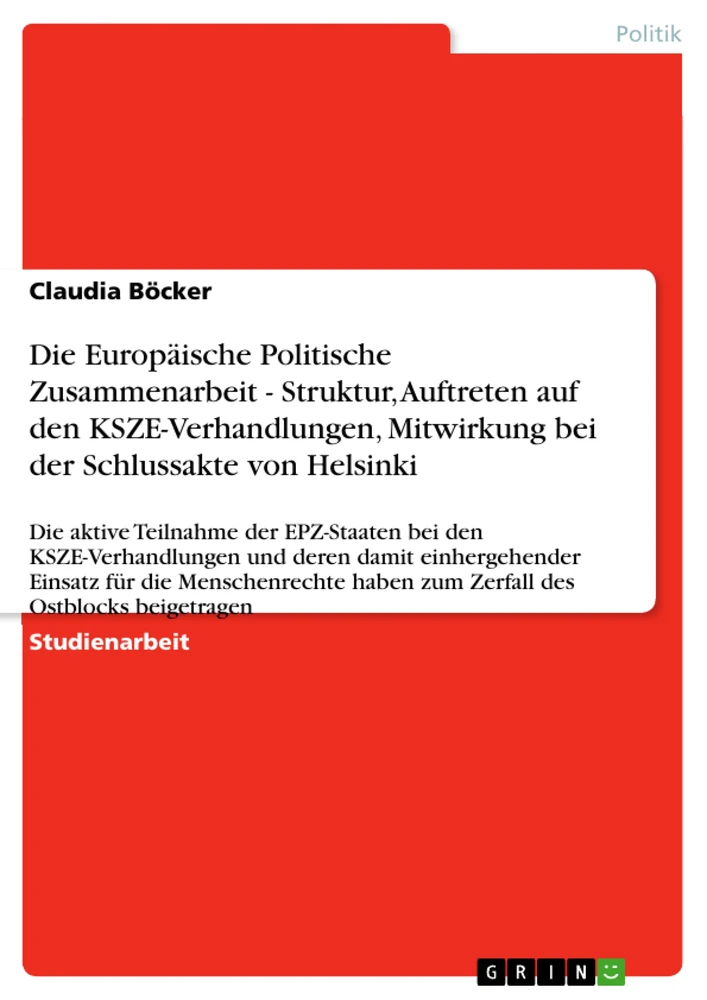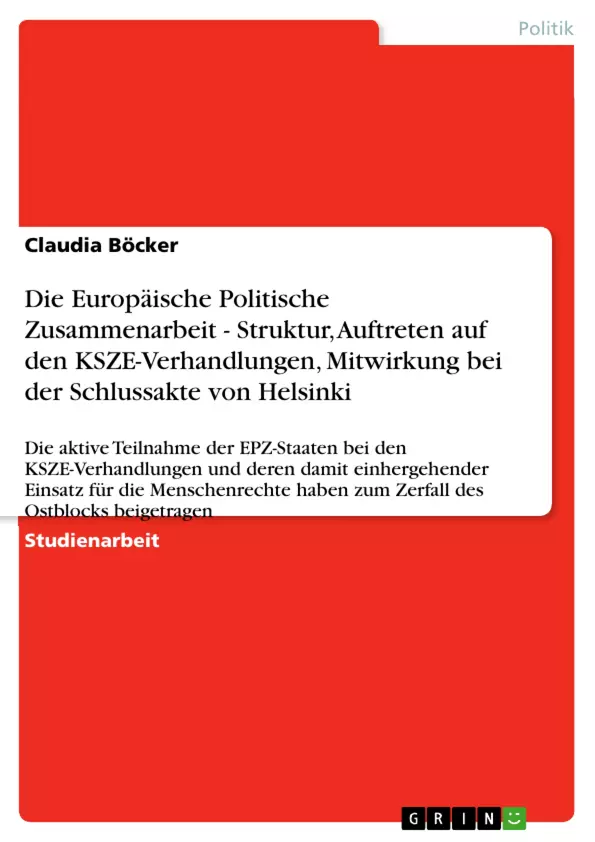Nach mehreren gescheiterten Versuchen nach der wirtschaftlichen Kooperation auch eine gemeinsame Außenpolitik für Westeuropa zu initiieren, erteilten die Außenminister im Dezember 1969 auf dem Gipfel von Den Haag den Auftrag, die Möglichkeit der engeren politischen Zusammenarbeit zu prüfen. Daraus ging der sogenannte „Davignon-Bericht“, der den Grundstein der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) legte. Den Vorteil einer engeren Zusammenarbeit im Bereich der Außenpolitik sahen die damals sechs Mitgliedsstaaten im größeren Geltungsbereich und höheren Ansehen gegenüber den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion, Osteuropa, wie auch gegenüber den arabischen Ländern. Die erste große Aufgabe für die EPZ stellten die Verhandlungen im Rahmen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) und deren Vorbereitungen ab 1971 dar.
Die KSZE wurde auf Initiative der Sowjetunion ins Leben gerufen. Schon 1954 legte der sowjetische Außenminister Molotow auf der Berliner Sachverständigenkonferenz einen Vertragsentwurf für die kollektive Sicherheit in Europa und einen Vorschlag für eine dazugehörige Konferenz vor. Die Intentionen der Sowjetunion zielten aber offenbar nicht auf die Sicherheitsfragen bezüglich Europas ab, sondern vielmehr auf die Verhinderung der endgültigen Westanbindung der Bundesrepublik Deutschland durch die Pariser Verträge.[...]
Erst mit der „Bukarester Deklaration“ im Juli 1966 begann eine ernsthafte Auseinandersetzung des Westens mit der vorgeschlagenen Thematik einer Sicherheitskonferenz für Europa.[...]
Durch die Unterzeichnung und die Veröffentlichung der Schlussakte von Helsinki erkannten die Teilnehmerstaaten der KSZE-Verhandlungen die darin festgehaltene Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte an. Es entstanden viele Dissidenten und Menschenrechtsorganisationen in den Warschauer-Pakt-Staaten auf, die mit der unterzeichneten Schlussakte etwas gegen die vorherrschenden Menschenrechtsverletzungen in ihren Heimatländern in der Hand hatten.
Aufgrund dieser Entwicklung kann man zu der These kommen, dass die aktive Teilnahme der EPZ-Staaten bei den KSZE-Verhandlungen und deren damit einhergehender Einsatz für die Menschenrechte letztendlich zum Zerfall des Ostblocks beigetragen hat.
Im weiteren Verlauf meiner Hausarbeit werde ich die Entwicklung und Arbeitsweise der EPZ, sowie den Verlauf der KSZE darstellen. Abschließend möchte ich auf die oben genannten These zurückkommen und mich kritisch mit ihr auseinander setzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Europäische Politische Zusammenarbeit- Nur mit einer Stimme sprechen oder eine gemeinsame Außenpolitik?
- Das Wirken der Europäischen Politischen Zusammenarbeit auf der „Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ (KSZE)
- Absichten der Teilnehmerstaaten
- Abstimmung der Verhandlungsführung durch die EPZ
- Von multilateralen Vorgesprächen zur Schlussakte von Helsinki
- Das Problem der Menschenrechte in Korb III
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Rolle der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) in den KSZE-Verhandlungen und deren Beitrag zum Zerfall des Ostblocks. Sie analysiert, wie die EPZ-Staaten durch ihre aktive Teilnahme und ihren Einsatz für die Menschenrechte eine entscheidende Rolle im Prozess der europäischen Sicherheitsarchitektur spielten.
- Die Entwicklung der EPZ und ihre Bedeutung für die gemeinsame Außenpolitik Westeuropas
- Der Einfluss der EPZ auf die KSZE-Verhandlungen und deren Ergebnisse
- Die Rolle der Menschenrechte in den KSZE-Verhandlungen und ihre Auswirkungen auf die Ostblockstaaten
- Die Debatte über die Auswirkungen der KSZE-Verhandlungen auf die europäische Sicherheitsarchitektur
- Die Frage, inwieweit die aktive Teilnahme der EPZ-Staaten zum Zerfall des Ostblocks beigetragen hat
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Forschungsfrage dar. Sie beleuchtet die Entstehung der EPZ und deren Bedeutung für die europäische Sicherheitspolitik.
- Europäische Politische Zusammenarbeit: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung und die Ziele der Europäischen Politischen Zusammenarbeit. Es analysiert die Herausforderungen und Chancen, die mit der Entwicklung einer gemeinsamen Außenpolitik für Westeuropa verbunden waren.
- Das Wirken der Europäischen Politischen Zusammenarbeit auf der KSZE: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der EPZ in den KSZE-Verhandlungen. Es beleuchtet die Absichten der Teilnehmerstaaten, die Verhandlungsführung der EPZ und die Aufnahme der „Menschlichen Dimension“ in die Schlussakte von Helsinki. Es wird auch auf die Bedeutung der Menschenrechte im Kontext der KSZE-Verhandlungen eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit konzentriert sich auf die Themen Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ), Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), Menschenrechte, Ostblock, europäische Sicherheitsarchitektur, gemeinsame Außenpolitik und die Rolle der EPZ-Staaten im Kontext des Kalten Krieges.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Davignon-Bericht?
Der Davignon-Bericht von 1970 legte den Grundstein für die Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ), um eine engere politische Abstimmung und gemeinsame Außenpolitik der EG-Mitgliedstaaten zu ermöglichen.
Welche Rolle spielte die EPZ bei den KSZE-Verhandlungen?
Die KSZE war die erste große Bewährungsprobe für die EPZ. Die westeuropäischen Staaten stimmten ihre Verhandlungsführung eng ab, um gegenüber den Supermächten USA und UdSSR mit einer Stimme zu sprechen.
Was ist die Bedeutung von 'Korb III' in der Schlussakte von Helsinki?
Korb III behandelte die „Zusammenarbeit in humanitären und anderen Bereichen“. Hier setzten die EPZ-Staaten die Anerkennung von Menschenrechten und Grundfreiheiten durch.
Hat die KSZE zum Zerfall des Ostblocks beigetragen?
Die These der Arbeit lautet, dass die Verpflichtung auf die Menschenrechte in der Schlussakte Dissidentenbewegungen im Ostblock stärkte, was letztlich den Zerfall des kommunistischen Systems beschleunigte.
Warum initiierte die Sowjetunion ursprünglich die KSZE?
Die UdSSR wollte primär den territorialen Status quo in Europa festschreiben und die Westanbindung der Bundesrepublik Deutschland erschweren, nicht primär Sicherheitsfragen klären.
- Arbeit zitieren
- Claudia Böcker (Autor:in), 2010, Die Europäische Politische Zusammenarbeit - Struktur, Auftreten auf den KSZE-Verhandlungen, Mitwirkung bei der Schlussakte von Helsinki, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163207