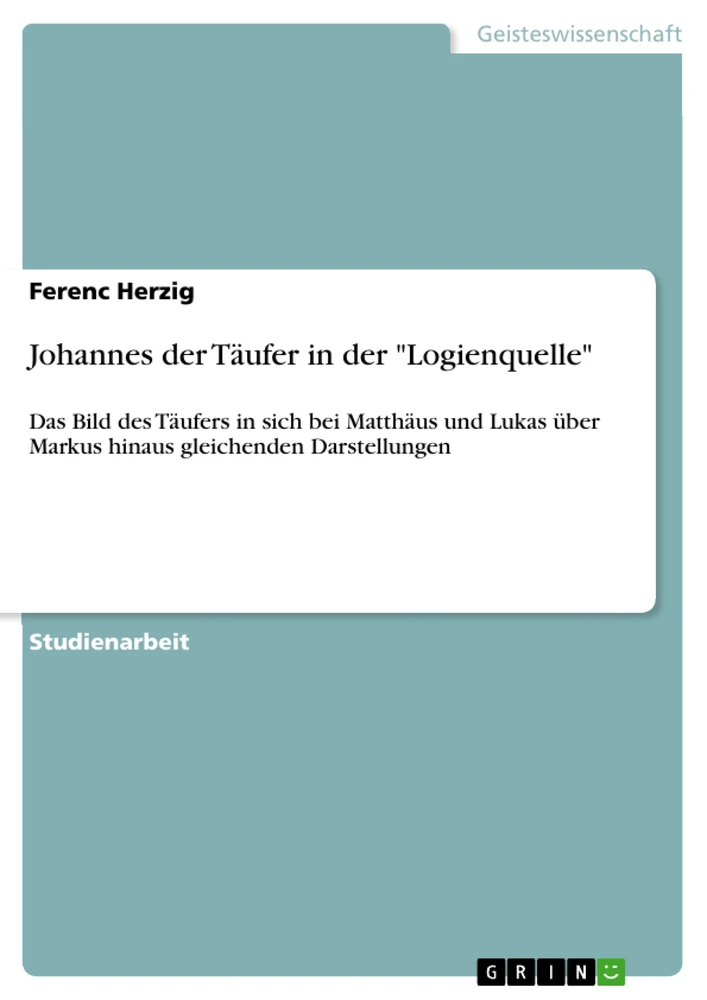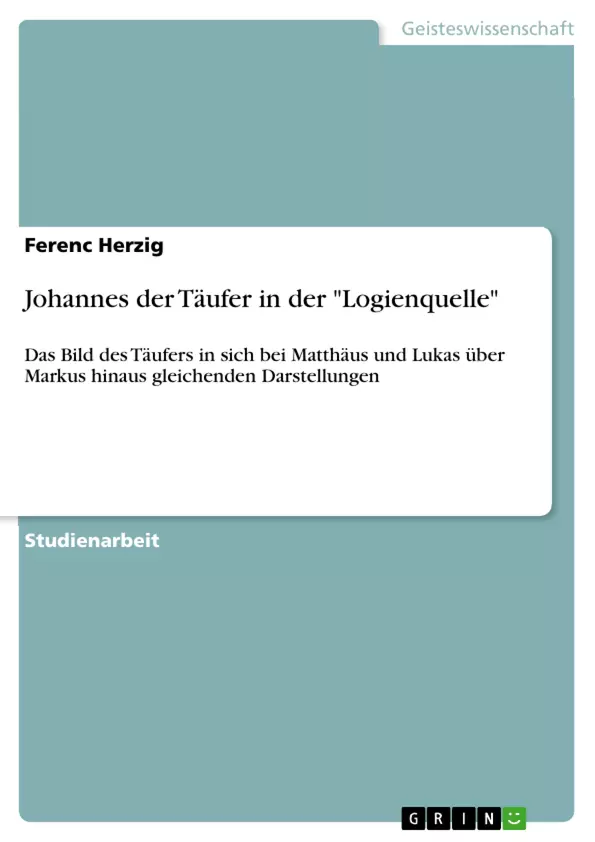Eine Seminararbeit, die sich einem der herausragenden Charaktere des Neuen Testaments widmet, steht am Anfang vor im wesentlichen zwei Überlegungen: innerhalb welcher Darstellung – gesetzt, es gibt derer verschiedene – nimmt der Leser die portraitierte Figur aus welchen Gründen wahr und wodurch ragt sie generell und im allgemeinen aus ihrem Kontext heraus. Bei der Frage nach der Darstellung hat es sich diese Arbeit zum Ziel gemacht, das Bild Johannes des Täufers aus der landläufig „Logienquelle“ genannten, bis dato allerdings noch nicht erwiesenen Q-Hypothese herauszuarbeiten, um es aus zweierlei Richtungen zu befragen: auf welchem Fundament steht die sogenannte „Logienquelle“ und worin liegen die bis heute begründeten Zweifel an ihrer Voraussetzung? Denn es ist keineswegs so, wie der Erlanger Neutestamentler P. Pilhofer in seinem Repetitorium – sicherlich stark verkürzt – gleich im ersten Satz seiner Darstellung den Studierenden Glauben machen will: „Wenige Probleme der neutestamentlichen Wissenschaft sind in so überzeugender Weise gelöst worden wie die synoptische Frage“. Vielmehr muß man Pilhofer schon nach einer kursorischen Sichtung der gegenwärtigen Forschungsliteratur wenigstens die Ermunterung M.S. Goodacres entgegenhalten, daß aus seiner Sicht “students who were introduced to Q at an early stage in their university education might enjoy hearing news of a different view. The brighter students, those with inquiring minds, will no doubt enjoy examining the evidence to see whether the Q hypotheses is indeed the best opinion, or whether this might be an occasion for using Occam's Razor“.
Also wird sich diese Arbeit darum bemühen, im Spannungsbogen Pilhofer – Goodacre auf der anderen Seite ein möglichst genaues Bild des jüdisch-christlichen Propheten par excellence mit „für die Entstehung des Christentums [...] entscheidender Bedeutung“ zu zeichnen, um Johannes dem Täufer, in dem die Kirche vielleicht sogar das personifizierte Kontinuum von Altem und Neuen Testament erblicken kann, „in bei Matthäus und Lukas sich über Markus hinaus gleichenden Darstellungen“ gerecht zu werden. Denn es muß bei aller Kritik an „Q“ wunder nehmen, wie wichtig den beiden Evangelisten diese Tradition war, so daß sie sich vielleicht unerwartet stark bei sowohl Mt als auch Lk mit frappierenden Ähnlichkeiten niederschlägt. Daß dies kein Zufall sein kann und also einer genauen Betrachtung bedarf, soll die hermeneutische Grundlage und Prämisse dieser Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Problemskizze
- Die Zweiquellen-Theorie
- Forschungsgeschichtlicher Überblick zur Entstehung der Q-Hypothese
- Profil der „Logienquelle Q“
- Kritik an der Existenzvermutung einer „Logienquelle“
- Struktur und Gestalt der „Logienquelle“
- Johannes der Täufer in der Logienquelle
- Die Verkündigung des Täufers (Q 3,7-9)
- Johannes und der Kommende (Q 3,16b-17)
- Täuferanfrage und Antwort Jesu (Q 7,18-23)
- Jesu Zeugnis über Johannes den Täufer (Q 7,24-28)
- Die Bedeutung des „Stürmerspruches“ (Q 16,16)
- Gleichnis von den spielenden Kindern (Q 7,31-35)
- Die Verkündigung des Täufers (Q 3,7-9)
- Der geschichtliche Ort der „,Logienquelle\"; ein Lokalisierungsversuch
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit widmet sich dem Bild Johannes des Täufers in der sogenannten „Logienquelle“ oder „Spruchquelle“, einer hypothetischen Quelle, die Matthäus und Lukas neben dem Markusevangelium genutzt haben sollen. Die Arbeit untersucht die Grundlage dieser „Logienquelle“ und beleuchtet die Zweifel an ihrer Existenz, um das Bild des Täufers aus dieser Quelle herauszuarbeiten.
- Die Entstehung und Entwicklung der Zweiquellen-Theorie
- Das Profil und die Inhalte der „Logienquelle Q“
- Die Rolle Johannes des Täufers in der „Logienquelle“
- Die Kritik an der Existenz der „Logienquelle“
- Ein Versuch der Lokalisierung der „Logienquelle“ im historischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Problemskizze führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Frage nach der Darstellung des Täufers in der „Logienquelle“. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf diese Quelle und die damit verbundenen Zweifel. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Zweiquellen-Theorie, ihrer Entstehungsgeschichte und den Argumenten für und gegen die Existenz der „Logienquelle“. Das dritte Kapitel analysiert die Passagen in der „Logienquelle“, die sich auf Johannes den Täufer beziehen, und untersucht seine Rolle und Bedeutung in diesem Textkontext. Der vierte Kapitel stellt den Versuch dar, den historischen Ort der „Logienquelle“ zu lokalisieren. Der Ausblick fasst die Ergebnisse zusammen und eröffnet weitere Forschungsansätze.
Schlüsselwörter
Zweiquellen-Theorie, Logienquelle, Q-Hypothese, Johannes der Täufer, Synoptische Evangelien, Matthäus, Lukas, Markus, Jesus, Christologie, Spruchsammlung, Judentum, Christentum, Tradition, Historische Kritik.
- Arbeit zitieren
- stud. theol. Ferenc Herzig (Autor:in), 2010, Johannes der Täufer in der "Logienquelle", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163315