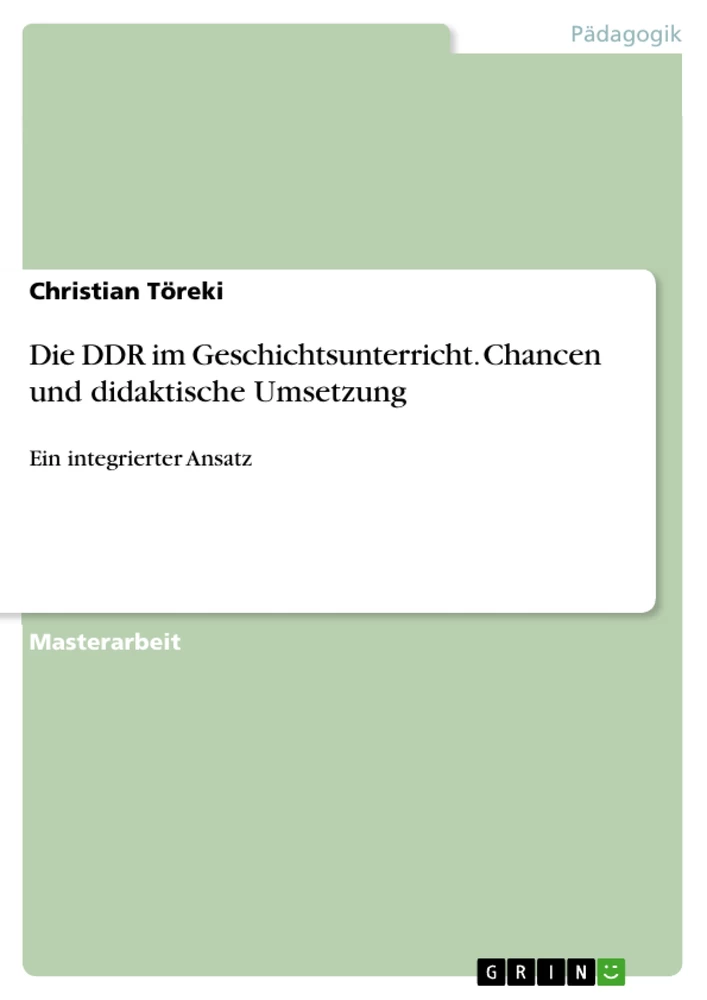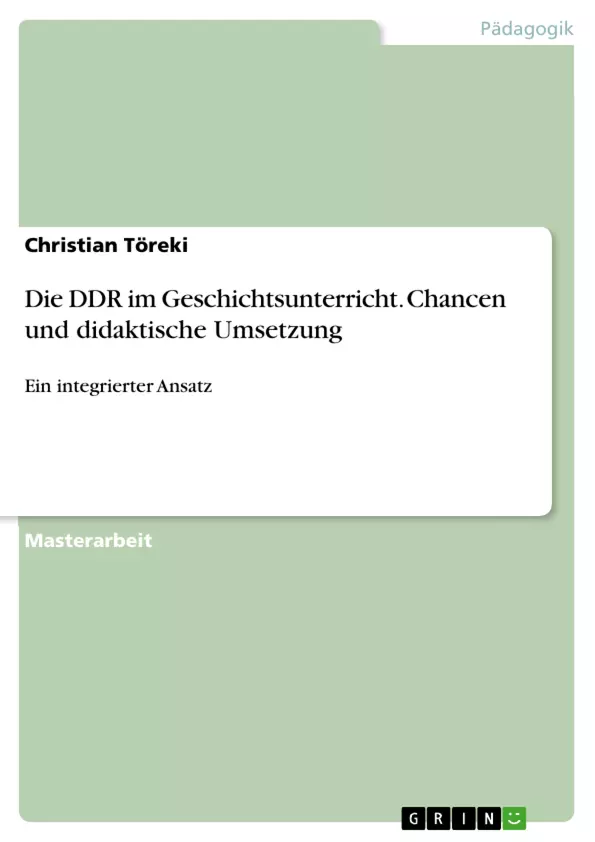Zunächst erfolgt jedoch die Zusammenfassung einer qualitativen Studie, die untersucht, wie und aus welchen Quellen Jugendliche ihre Vorstellungen über die DDR konstruieren. Dem schließen sich Ausführungen zur quantitativen Untersuchung von Monika Deutz-Schroeder und Klaus Schroeder an, welche die oben erwähnten Reaktionen in Presse und Politik hervorgerufen haben. Neben der Darstellung der wichtigsten Ergebnisse der empirischen Erhebung wird auch das methodische Vorgehen der Wissenschaftler bei der Auswertung bewertet. Ebenfalls in diesem Kapitel wird auf den Prozess des Historischen Lernens eingegangen, der eng verbunden ist mit den Reflexionen zur deutsch-deutschen Geschichte nach 1945.
Im vierten Kapitel der Masterarbeit werden eindimensionale Erklärungsansätze zur Nachkriegsgeschichte vorgestellt, kritisch beleuchtet sowie dargestellt, wie die Geschichtswissenschaft die jüngste deutsche Vergangenheit erzählt. Im folgenden Kapitel steht schließlich die Theorie des Konzepts einer integrierten deutsch-deutschen Geschichte en detail im Mittelpunkt der Ausführungen. Neben Vorüberlegungen zum Konzept werden sechs Leitlinien beschrieben, an denen sich eine asymmetrisch verflochtene Parallelgeschichte erzählen lässt. Ausgehend von einer gemeinsamen Ausgangslage des Jahres 1945 gingen die beiden deutschen Staaten im Kalten Krieg scharf voneinander getrennte, im Wesentlichen durch ihre Blockzugehörigkeit geprägte Wege. Hinzu traten Eigendynamiken in beiden Staaten. So entwickelten sich zwei verschiedene Gesellschaften, die aber auf komplizierte Weise miteinander verbunden und aufeinander bezogen sowie mit gemeinsamen Problemen konfrontiert waren. Ebenfalls in diesem Kapitel werden Chancen einer integrierten deutschen Nachkriegsgeschichte herausgestellt.
Im sechsten Kapitel steht der Unterricht im alten Bundesgebiet zur DDR im Zentrum meiner Betrachtungen. Dabei wird vor allem auf Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz sowie frühere Analysen von Schulbüchern eingegangen. Abschließend erfolgt eine Untersuchung der didaktischen Umsetzung der gemeinsamen Geschichte in Lehrwerken. Eine eigenständige Analyse eines Geschichtsbuchs bildet den Abschluss der Masterarbeit, da vorliegende Publikationen sich nur auf Lehrwerke beziehen, welche bis zum Jahr 2005 herausgegeben wurden. Hier wird untersucht, ob und wie sich der integrierte Ansatz in diesem ausgewählten Buch wieder findet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Schülervorstellungen zur DDR
- 2.1 Eine qualitative Untersuchung
- 2.2 Eine quantitative Untersuchung
- 2.2.1 Ergebnisse
- 2.2.2 Schlussfolgerungen
- 3. Reflexion über die deutsch-deutsche Geschichte
- 4. Eindimensionale Erklärungsansätze zur Nachkriegsgeschichte
- 5. Das Konzept einer integrierten Nachkriegsgeschichte
- 5.1 Vorüberlegungen
- 5.2 Das Konzept
- 5.2.1 1945 als Endpunkt und Chance
- 5.2.2 Blockbildung
- 5.2.3 Eigendynamik der DDR und BRD
- 5.2.4 Abgrenzung und asymmetrische Verflechtung
- 5.2.5 Problemlagen von Industriegesellschaften
- 5.2.6 Erosionserscheinungen
- 5.3 Chancen einer integrierten Nachkriegsgeschichte
- 5.4 Kritik am Konzept
- 6. Die DDR im Unterricht und in Schulbüchern
- 6.1 Westdeutscher Geschichtsunterricht und die DDR
- 6.2 Didaktische Schulbuchkonzepte seit 1990
- 6.2.1 Schulbücher für das Fach Geschichte
- 6.2.2 Neuere Analysen von Schulbüchern
- 6.2.3 Eigene Analyse eines Lehrwerks
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit der Frage, wie die Geschichte der DDR im Geschichtsunterricht behandelt werden sollte, und welche Rolle dabei die Geschichte der alten Bundesrepublik spielt. Sie untersucht die Relevanz eines integrierten Ansatzes, der die Geschichte der beiden deutschen Staaten als asymmetrisch verflochtene Parallelgeschichte darstellt. Das Ziel der Arbeit ist es, die Chancen und didaktischen Möglichkeiten eines solchen Ansatzes aufzuzeigen und kritisch zu beleuchten.
- Schülervorstellungen zur DDR
- Reflexion über die deutsch-deutsche Geschichte
- Eindimensionale Erklärungsansätze zur Nachkriegsgeschichte
- Das Konzept einer integrierten Nachkriegsgeschichte
- Die DDR im Unterricht und in Schulbüchern
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 analysiert Schülervorstellungen zur DDR, basierend auf einer qualitativen Studie von Sabine Moller, die den Einfluss von Medien und familiären Erzählungen untersucht. Kapitel 3 beleuchtet den Prozess des Historischen Lernens im Kontext der deutsch-deutschen Geschichte. Kapitel 4 kritisiert eindimensionale Erklärungsansätze zur Nachkriegsgeschichte und stellt die Herausforderungen der Geschichtswissenschaft dar. Kapitel 5 präsentiert das Konzept einer integrierten deutsch-deutschen Geschichte, beschreibt dessen Leitlinien und Chancen, und setzt sich kritisch mit der Kritik an diesem Ansatz auseinander. Kapitel 6 beleuchtet den Geschichtsunterricht im Westen bezüglich der DDR, analysiert didaktische Schulbuchkonzepte seit 1990 und untersucht die Umsetzung der gemeinsamen Geschichte in Lehrwerken.
Schlüsselwörter
Schülervorstellungen, DDR, Geschichtsunterricht, deutsche Nachkriegsgeschichte, integrierte Geschichte, asymmetrische Verflechtung, Schulbücher, Didaktik.
- Quote paper
- Christian Töreki (Author), 2010, Die DDR im Geschichtsunterricht. Chancen und didaktische Umsetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163318