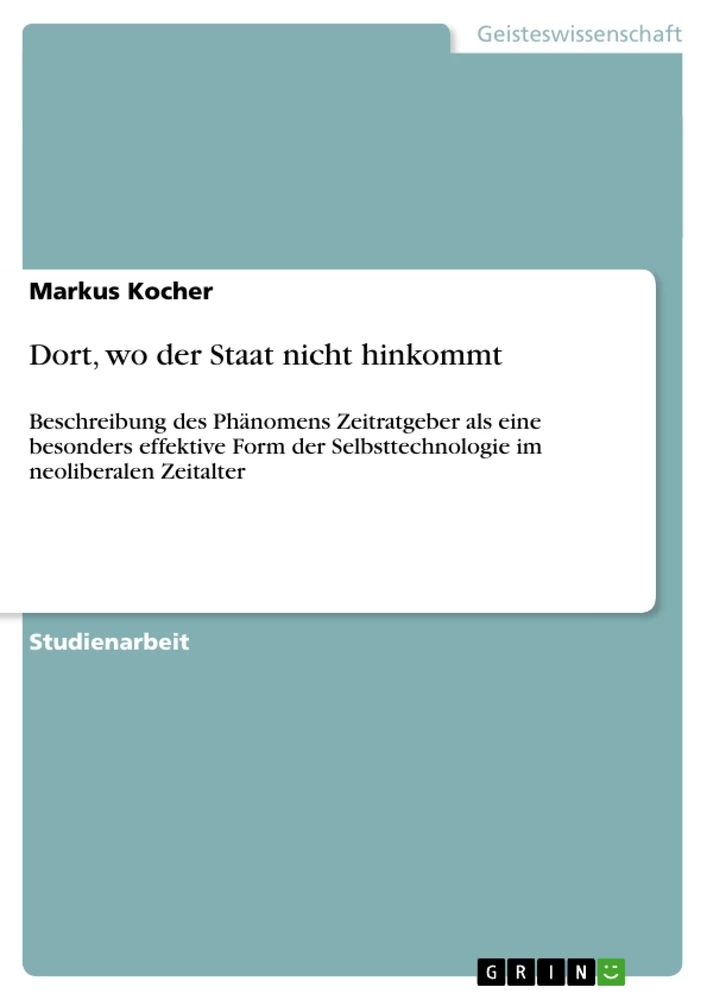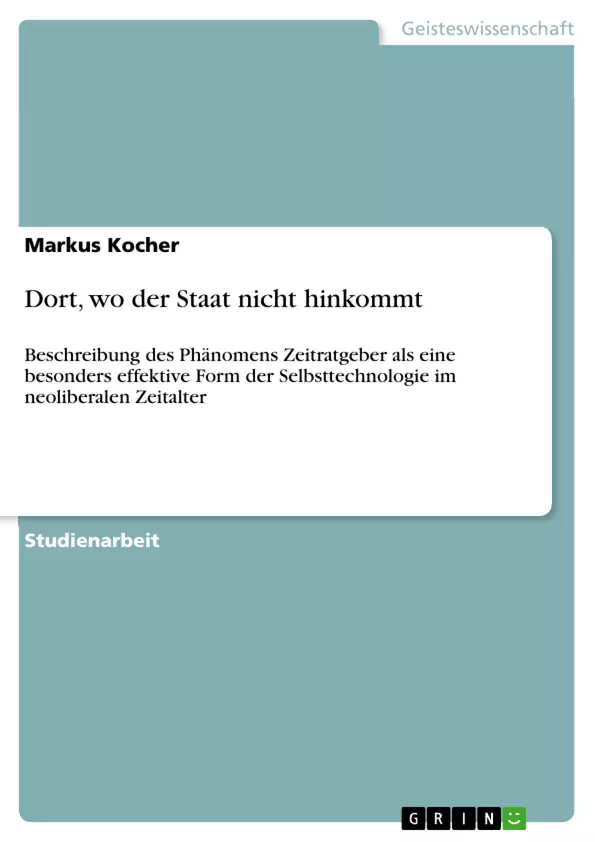Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Zeit-Ratgebers als eine Form von Selbsttechnologie, die darauf abzielt, den Menschen als "unternehmerisches Selbst" zur Optimierung seines Humankapitals anzuleiten. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer im neoliberalen Zeitalter vorherrschenden Arbeitsweise, die dem Individuum zunehmend Flexibilität und Mobilität abverlangt. Die als unverbindlichen Ratschläge getarnten Anleitungen des Zeit-Ratgebers werden hier als besonders rezente Weise von Gouvernementalität (Michel Foucault) dechiffriert. Warum der Ratgeber funktioniert, mit welchen Techniken er uns die Entscheidung abnimmt, vor die er uns selber stellt - dies wird in dieser Arbeit gezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINFÜHRUNG INS THEMA
- 2. ARBEIT IM WANDEL - DEM ZEITRATGEBER AUF DER SPUR
- 2.1. DIE ZEIT DER STEMPELUHR IST ABGELAUFEN
- 2.2. VON DER ENTGRENZUNG ZUR ERSCHÖPFUNG
- 3. GOUVERNEMENTALITÄT UND DER AUFSTIEG DES SELBST-UNTERNEHMERS .....
- 4. DER ZEITRATGEBER – WIE FUNKTIONIERT ER, WAS WILL ER?
- 4.1. ZEITRATGEBER ÄLTERER HERKUNFT
- 4.2. DER NEUE ZEITRATGEBER
- 4.3. FUNKTION UND WIRKUNG NEUER ZEITRATGEBER
- 4.3.1. DAS ICH ALS ANDOCKSTELLE
- 4.3.2. ENTSCHEIDUNGSHILFEN
- 4.3.3. PAKT MIT DER WISSENSCHAFT, FLIRT MIT DER RELIGION
- 5. SCHLÜSSE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Zeitratgeber und untersucht, wie diese im Kontext des neoliberalen Zeitalters als eine Form der Selbsttechnologie eingesetzt werden, um die eigene Arbeitskraft zu optimieren. Der Text beleuchtet dabei den Einfluss der neoliberalen Arbeitspolitik auf die Entgrenzung der Arbeit und die wachsende Belastung von Arbeitnehmern.
- Die Rolle der Zeitratgeber im neoliberalen Arbeitskontext
- Die Entgrenzung der Arbeit und die Folgen für die psychische Gesundheit von Arbeitnehmern
- Die Verwendung von „Techniken der Selbst- und Handlungskontrolle“ in der Zeitratgeberliteratur
- Die Regulierung des Selbst und die Konstruktion des „unternehmerischen Selbst“ durch Zeitratgeber
- Die Kritik an der Selbstverantwortungslogik der Zeitratgeber und deren potentielle Folgen für die Arbeitsbedingungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und beleuchtet die zunehmende Verbreitung von Ratgebern in allen Lebensbereichen. Es wird die These aufgestellt, dass Zeitratgeber ein exemplarisches Beispiel für die zunehmende „Kolonialisierung“ des Alltags durch Ratgeber darstellen und als eine Art Programm zur Selbstoptimierung der Arbeitskraft dienen.
Kapitel 2 beschreibt den Wandel in der Arbeitswelt im Zuge der Neoliberalisierung. Das Verschwinden der Stechuhr und das Aufkommen flexibler Arbeitsmodelle, die eine verstärkte Selbstkontrolle und Eigenverantwortung vom Arbeitnehmer fordern, wird dargestellt. Die zunehmende Entgrenzung der Arbeit und die wachsende Belastung der Arbeitnehmer werden als Ursachen für die wachsende Bedeutung der Zeitratgeberliteratur betrachtet.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Konzept der Gouvernementalität und dem Aufstieg des „Selbst-Unternehmers“. Der Ratgeber wird als ein Konstrukt aus Mikro-Techniken beschrieben, die das Individuum „gleichermassen in der Tiefe, in der Feinheit und im Detail“ lenken.
Kapitel 4 beleuchtet die Funktionsweise von Zeitratgebern und unterscheidet zwischen traditionelleren und neuartigen Formen. Es werden die verschiedenen Mechanismen aufgezeigt, durch die Ratgeber das Individuum dazu anleiten, seine Zeit zu managen und seine Arbeitskraft zu optimieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Zeitmanagement, Selbsttechnologie, neoliberale Arbeitspolitik, Gouvernementalität, „unternehmerisches Selbst“, Entgrenzung der Arbeit, psychische Belastung am Arbeitsplatz, Zeitratgeberliteratur, Selbstverantwortung, und Mikro-Techniken.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden Zeit-Ratgeber in dieser Arbeit dechiffriert?
Sie werden als Form der "Selbsttechnologie" und "Gouvernementalität" (nach Foucault) analysiert, die den Menschen zum "unternehmerischen Selbst" optimieren wollen.
Was bedeutet die "Entgrenzung der Arbeit"?
Im neoliberalen Zeitalter verschwinden feste Arbeitszeiten (Ende der Stechuhr), was zu einer ständigen Verfügbarkeit und potenziellen Erschöpfung führt.
Warum boomen Zeitmanagement-Ratgeber heute so stark?
Weil sie dem Individuum Techniken an die Hand geben, um mit dem wachsenden Flexibilitäts- und Mobilitätsdruck der modernen Arbeitswelt umzugehen.
Welche Rolle spielt die Wissenschaft in diesen Ratgebern?
Ratgeber gehen oft einen "Pakt mit der Wissenschaft" oder einen "Flirt mit der Religion" ein, um ihre Anleitungen als allgemeingültige Wahrheiten zu legitimieren.
Was ist die Kritik an der Selbstverantwortungslogik?
Die Arbeit kritisiert, dass systemische Probleme der Arbeitswelt auf das Individuum abgewälzt werden, das sich nun selbst "managen" muss.
- Arbeit zitieren
- Markus Kocher (Autor:in), 2009, Dort, wo der Staat nicht hinkommt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163415