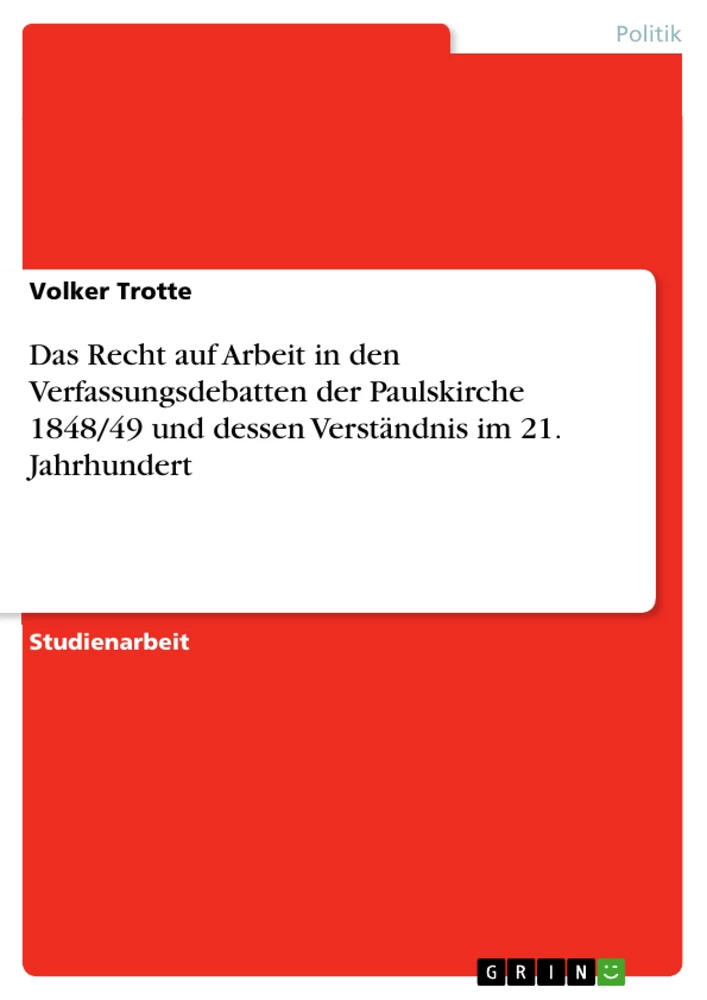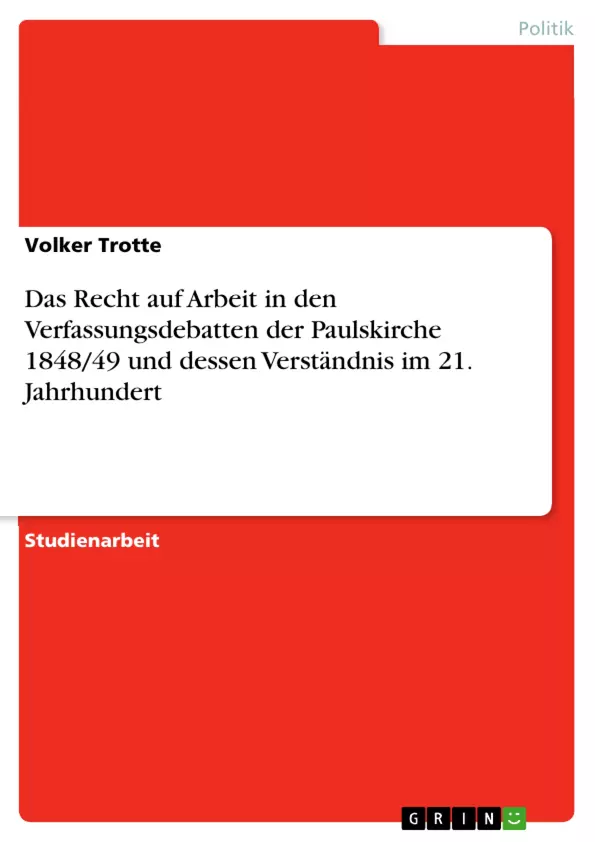Als die Männer der Paulskirche sich 1848 zum Vorparlament und der späteren Frankfurter Nationalversammlung zusammenfanden, kamen Sie nicht nur aus den unterschiedlichen Staaten des deutschen Bundes, sondern ebenso aus den verschiedensten gesellschaftlichen Verhältnissen. Obwohl sie Männer des Volkes waren, vertrat nur der geringste Teil die große gesellschaftliche Unterschicht. Unter den insgesamt 585 gleichzeitige Abgeordneten waren nur drei Bauern und vier Handwerker. Durch Fluktuation war die absolute Zahl der Abgeordneten während der Revolution letztlich größer als die von Parlamentsordnung vorgesehene maximale Anzahl. Der überwiegende Teil waren Staatsdiener (436) und freiberufliche Intelligenz (149), mehr als 600 Teilnehmer hatten eine akademische, 491 eine rechtwissenschaftlich-ausgerichtete Ausbildung. Dennoch begannen sie, statt mit der direkten Erarbeitung einer Verfassung, mit dem Aufstellen eines Grundrechtskataloges. Innerhalb der Debatten um die Inhalte desselben entsponn sich eine bis heute andauernde Diskussion um die Frage nach dem Recht auf Arbeit als Teil der Grundrechte, um die Auslegung desselben, um Sinn und Ziel. Kurzum es ging um die Sozialen Frage und das Einbringen von Lösungsansätzen in die neue Verfassung und damit in den neuen Staat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Aufbau
- 2. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen zur Zeit der Nationalversammlung
- 3. Das Recht auf Arbeit in den Verfassungsdebatten der Paulskirche
- 4. Das Verständnis des Rechts auf Arbeit im 21. Jahrhundert in Deutschland
- 5. Schlussbetrachtung
- 6. Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Debatten um das Recht auf Arbeit während der Frankfurter Paulskirche 1848/49 und vergleicht diese mit dem aktuellen Verständnis dieses Rechts im 21. Jahrhundert. Ziel ist es, die historischen Kontexte und Argumentationslinien aufzuzeigen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede in den jeweiligen Debatten herauszuarbeiten.
- Das Recht auf Arbeit in den Debatten der Paulskirche
- Gesellschaftliche Rahmenbedingungen der Revolution von 1848/49
- Verschiedene Auffassungen zum Recht auf Arbeit in der Paulskirche
- Der Einfluss der französischen Februarrevolution
- Vergleich der historischen und aktuellen Debatten um das Recht auf Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Rechts auf Arbeit in den Verfassungsdebatten der Paulskirche 1848/49 und im 21. Jahrhundert ein. Sie beschreibt die Zusammensetzung der Nationalversammlung und hebt die Bedeutung der Debatte um das Recht auf Arbeit als Teil der Grundrechte hervor. Die Problemstellung verdeutlicht das Fehlen eines expliziten Rechts auf Arbeit in der Verfassung von 1848/49 und den anhaltenden Diskurs um staatliche Arbeitsbeschaffung und den Schutz der Binnenwirtschaft. Der Aufbau der Arbeit wird skizziert, wobei die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Debatten der Paulskirche und der aktuelle Diskurs miteinander verglichen werden.
2. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen zur Zeit der Nationalversammlung: Dieses Kapitel beschreibt die politische und sozioökonomische Situation im deutschen Bundesgebiet um 1848. Es beleuchtet die Aufteilung in Einzelstaaten, den Deutschen Bund und den Deutschen Zollverein. Die Einführung neuer Technologien, die zunehmende Industrialisierung und die daraus resultierende Entstehung der Arbeiterklasse werden detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf dem Kontrast zwischen technischem Fortschritt und der daraus resultierenden Massenarbeitslosigkeit und Armut (Pauperismus), die maßgeblich zur Sozialen Frage beitrugen und den Ausbruch der Revolution mit beeinflussten. Die Februarrevolution in Frankreich wird als wichtiger Auslöser für die Märzrevolution in Deutschland genannt. Die Zusammenfassung unterstreicht die Bedeutung dieser Rahmenbedingungen für das Verständnis der Debatten um das Recht auf Arbeit in der Paulskirche.
3. Das Recht auf Arbeit in den Verfassungsdebatten der Paulskirche: Das Kapitel analysiert die verschiedenen Positionen und Auffassungen zum Recht auf Arbeit innerhalb der Paulskirche. Es präsentiert die Einteilung der Ansätze in vier verschiedene Auffassungen nach Wolfram Siemann, angefangen vom "entfesselten Liberalismus" mit Vertretern wie Osterrath und Merck, die ein Recht auf Arbeit ablehnten, bis hin zu anderen Positionen, welche unterschiedliche Auslegungen und Lösungsansätze diskutierten. Die Zusammenfassung fasst die zentralen Argumente und die Vielfalt der Meinungen innerhalb der Debatten zusammen und hebt die Bedeutung dieser Debatten für die heutige Diskussion hervor. Die Fußnoten, welche einzelne Akteure und deren Positionen detaillierter beleuchten, tragen zum Verständnis der Komplexität der Debatten bei.
Schlüsselwörter
Recht auf Arbeit, Paulskirche, Frankfurter Nationalversammlung, 1848/49, Soziale Frage, Märzrevolution, Verfassungsdebatten, Liberalismus, Industrielle Revolution, Pauperismus, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftspolitik, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Recht auf Arbeit in den Verfassungsdebatten der Paulskirche 1848/49
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Debatten um das Recht auf Arbeit während der Frankfurter Paulskirche (1848/49) und vergleicht diese mit dem aktuellen Verständnis dieses Rechts im 21. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf dem historischen Kontext, den Argumentationslinien und den Gemeinsamkeiten sowie Unterschieden in den jeweiligen Debatten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Debatten um das Recht auf Arbeit in der Paulskirche, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Revolution von 1848/49, verschiedene Auffassungen zum Recht auf Arbeit innerhalb der Paulskirche, den Einfluss der französischen Februarrevolution und einen Vergleich der historischen und aktuellen Debatten zum Recht auf Arbeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (mit Problemstellung und Aufbau), Gesellschaftliche Rahmenbedingungen zur Zeit der Nationalversammlung, Das Recht auf Arbeit in den Verfassungsdebatten der Paulskirche, Das Verständnis des Rechts auf Arbeit im 21. Jahrhundert in Deutschland, Schlussbetrachtung und Literatur- und Quellenverzeichnis.
Wie werden die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Paulskirche dargestellt?
Das Kapitel zu den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beschreibt die politische und sozioökonomische Situation im deutschen Bundesgebiet um 1848, einschließlich der Aufteilung in Einzelstaaten, des Deutschen Bundes und des Deutschen Zollvereins. Es beleuchtet die Industrialisierung, die Entstehung der Arbeiterklasse, den technischen Fortschritt, die daraus resultierende Arbeitslosigkeit und Armut (Pauperismus) und den Einfluss der Februarrevolution in Frankreich.
Wie werden die Debatten in der Paulskirche zum Recht auf Arbeit analysiert?
Das Kapitel zur Paulskirche analysiert verschiedene Positionen und Auffassungen zum Recht auf Arbeit, unter anderem anhand der Einteilung in vier verschiedene Ansätze (nach Wolfram Siemann), von "entfesseltem Liberalismus" bis hin zu Positionen, die unterschiedliche Auslegungen und Lösungsansätze diskutierten. Es fasst die zentralen Argumente und die Vielfalt der Meinungen zusammen.
Wie lautet die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung besteht darin, die historischen Kontexte und Argumentationslinien der Debatten um das Recht auf Arbeit während der Paulskirche aufzuzeigen und diese mit dem aktuellen Verständnis dieses Rechts zu vergleichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Recht auf Arbeit, Paulskirche, Frankfurter Nationalversammlung, 1848/49, Soziale Frage, Märzrevolution, Verfassungsdebatten, Liberalismus, Industrielle Revolution, Pauperismus, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftspolitik, Deutschland.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Punkte und Argumente jedes Kapitels hervorheben.
- Quote paper
- Volker Trotte (Author), 2010, Das Recht auf Arbeit in den Verfassungsdebatten der Paulskirche 1848/49 und dessen Verständnis im 21. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163418