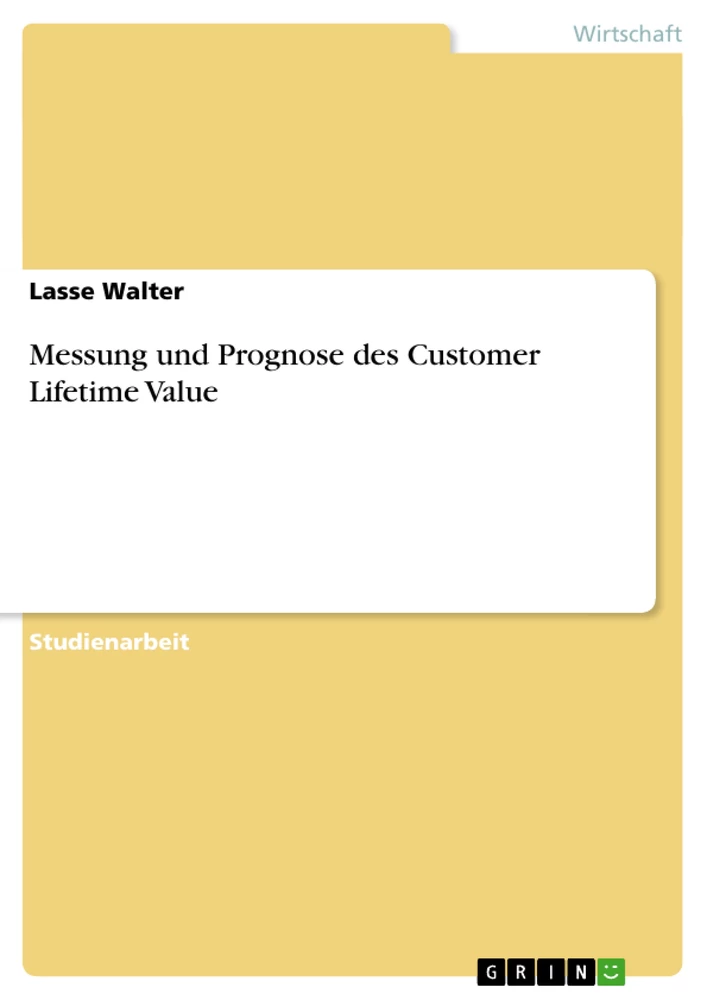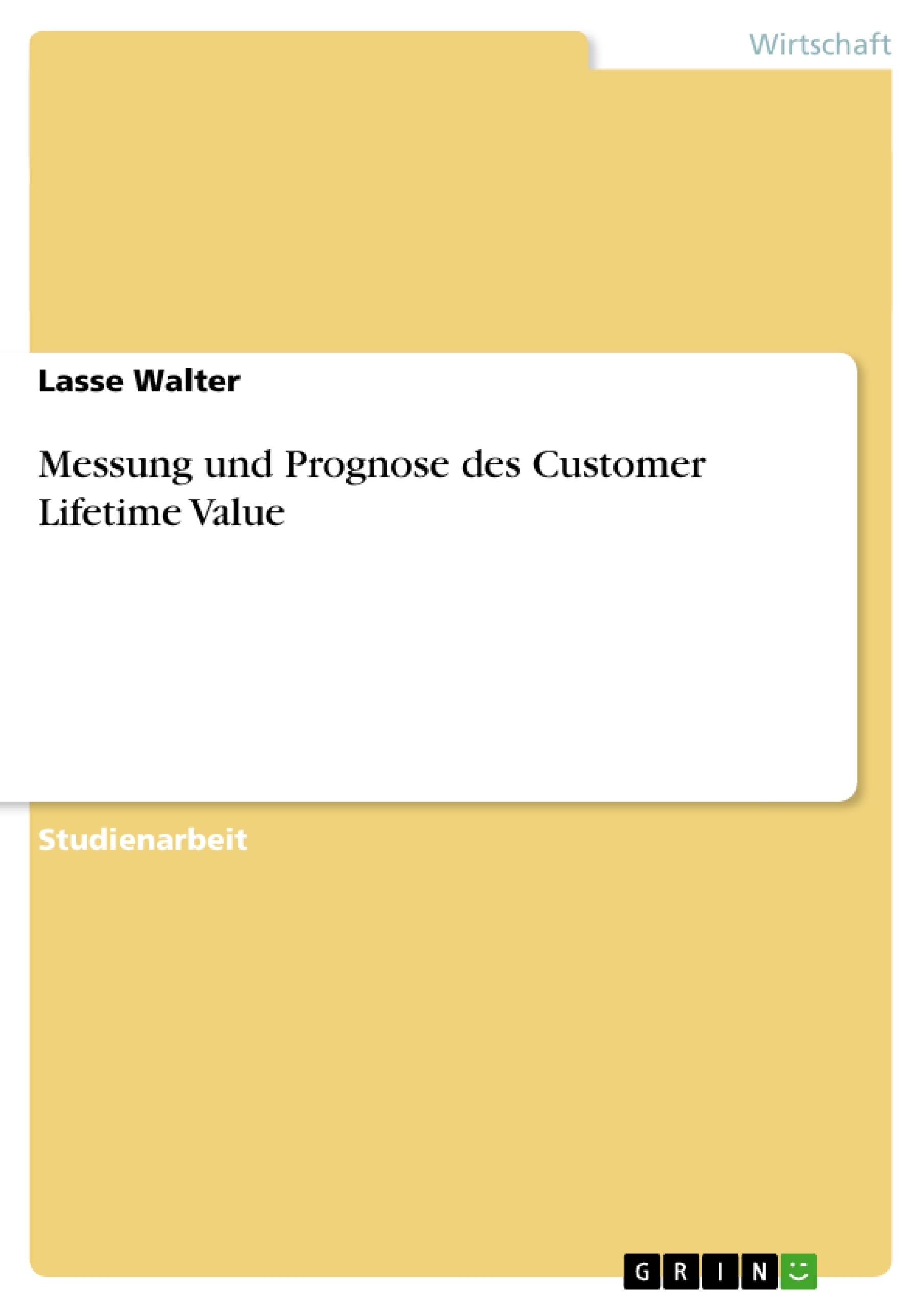„Das klassische Marketing befindet sich in einem Wandel. Während bisher das
Kundenmarketing aus den klassischen 4 P´s (Produkt, Price, Promotion und Place) besteht,
gewinnt zukünftig das Beziehungsmarketing oder auch Relationship Marketing an
Bedeutung.“ (Harnischfeger, 1996, S.13). Die zeitliche Entwicklung der Wirtschaft und die
damit verbundenen Veränderungen der Märkte hat den Fokus der Marketingorientierung in
den letzten 50 Jahren mehrmals wechseln lassen, um trotz der zunehmenden Komplexität und
Dynamik des Wettbewerbs den Unternehmen verstärkt neue Möglichkeiten zu bieten,
Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten zu erreichen. Manfred Bruhn (1999) unterteilt
die Entwicklung der Orientierungsschwerpunkte der letzten 50 Jahre in 6 Phasen: [...] Als Hyperwettbewerb definiert Bruhn eine Form von modernen, aggressiven und komplexen
Wettbewerb, der die Unternehmen zurück zu der traditionellen Kundenorientierung als
Konzept des Marketing führt und somit kein neues Phänomen, sondern eine Revitalisierung
des Beziehungsmarketing darstellt.
Das Beziehungsmarketing führt den Ansatz der Kundenorientierung weiter fort, mit dem Ziel,
die Distanz zwischen dem Unternehmen und seinen dominierenden Beziehungspartner, dem
Kunden, zu verringern. Die „Pareto-Regel„ , wonach lediglich 20 Prozent aller Kunden für 80
Prozent der Gewinne sorgen, während die restlichen 80 Prozent der Kunden nur
verhältnismäßig hohe Kosten verursachen (Cooper/Kaplan, 1991, S.134), verspricht unter
verbesserten Kundeninformationen erhebliche Wettbewerbsvorteile. Für das Unternehmen ist
es demzufolge wichtig, die Kundenindividualität abzubilden, um einerseits die
gewinnbringenden Kundenbeziehungen zu identifizieren und zu fördern, sowie andererseits
die Verbindung zu unrentablen Kunden auszumachen und aufzugeben oder so umzugestalten,
daß diese ebenfalls gewinnbringend werden. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von
Database Marketing. Der Customer Lifetime Value (CLV) bezieht sich auf die
Kundenwertermittlung in Bezug auf die Dauer der Geschäftsbeziehung des Anbieters mit dem
jeweiligen Kunden. Diese Arbeit vermittelt einen Überblick von der bisherigen Forschung über die Messung und Prognose des CLV. Die beiden folgenden Kapitel formulieren die
Problemstellung dieses Konzeptes und klären einige Grundlagenbegriffe. In Kapitel 4 werden
repräsentative Modelle verschiedener Berechnungsansätze und deren jeweiligen Problemen
vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Grundlagendefinition
- „Wer ist eigentlich der Kunde?“
- Das Lebenszykluskonzept
- Methoden der Messung des CLV
- Kalkulative Modelle
- Barwertmodelle
- Ressourcenallokationsmodelle
- Abwanderungsmodelle
- Probleme der Kalkulativen Modelle
- Kundenbindungswahrscheinlichkeitsmodelle
- Probleme von Kundenbindungswahrscheinlichkeitsmodellen
- Normative Modelle auf Basis des NBD/Pareto-Modells
- Probleme der normativen Modelle auf Basis des NBD/Pareto-Modells
- Referenzmodelle
- Kalkulative Modelle
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Messung und Prognose des Customer Lifetime Value (CLV), also dem Wert, den ein Kunde über die gesamte Dauer seiner Geschäftsbeziehung zum Unternehmen generiert. Sie analysiert die Problematik der CLV-Berechnung und stellt verschiedene Modelle zur Messung und Prognose vor.
- Definition und Abgrenzung des Kundenbegriffs
- Das Lebenszykluskonzept und seine Anwendung im Kontext des CLV
- Verschiedene Modelle zur Messung und Prognose des CLV
- Bewertung der Stärken und Schwächen der einzelnen Modelle
- Herausforderungen und zukünftige Entwicklungen im Bereich des CLV
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Wandel im Marketing von der Produktorientierung hin zum Beziehungsmarketing dar und führt das Konzept des CLV ein.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Problematik der CLV-Messung und verdeutlicht die Bedeutung des Kundenwerts für die effiziente Allokation von Marketingressourcen.
Das dritte Kapitel liefert eine Definition des Kundenbegriffs und erläutert das Lebenszykluskonzept als Grundlage für die Bestimmung der „Lebenszeit“ eines Kunden.
Das vierte Kapitel stellt verschiedene Modelle zur Messung und Prognose des CLV vor, darunter Kalkulative Modelle, Kundenbindungswahrscheinlichkeitsmodelle und Normative Modelle. Es werden die jeweiligen Stärken und Schwächen der Modelle sowie die Herausforderungen bei ihrer Anwendung diskutiert.
Schlüsselwörter
Customer Lifetime Value (CLV), Kundenwertermittlung, Beziehungsmarketing, Lebenszykluskonzept, Kalkulative Modelle, Kundenbindungswahrscheinlichkeitsmodelle, Normative Modelle, Marketingressourcen, Kundenloyalität, Abwanderung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Customer Lifetime Value (CLV)?
Der CLV ist eine Kennzahl zur Ermittlung des Kundenwerts über die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung. Er hilft Unternehmen zu entscheiden, welche Kundenbeziehungen besonders gewinnbringend sind und gefördert werden sollten.
Warum gewinnt Beziehungsmarketing gegenüber klassischem Marketing an Bedeutung?
Im modernen Hyperwettbewerb reicht die Produktorientierung nicht mehr aus. Beziehungsmarketing zielt darauf ab, die Distanz zum Kunden zu verringern und durch individuelle Betreuung langfristige Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
Was besagt die Pareto-Regel im Kundenmarketing?
Die Regel besagt, dass oft nur 20 Prozent der Kunden für etwa 80 Prozent des Gewinns verantwortlich sind, während der Rest der Kunden verhältnismäßig hohe Kosten verursacht.
Welche Modelle zur Messung des CLV gibt es?
Es werden kalkulative Modelle (z. B. Barwertmodelle, Abwanderungsmodelle), Kundenbindungswahrscheinlichkeitsmodelle sowie normative Modelle auf Basis des NBD/Pareto-Modells unterschieden.
Was ist die größte Herausforderung bei der CLV-Prognose?
Die Schwierigkeit liegt darin, die zukünftige Dauer der Geschäftsbeziehung und die künftigen Deckungsbeiträge unter dynamischen Marktbedingungen präzise vorherzusagen.
- Quote paper
- Lasse Walter (Author), 2002, Messung und Prognose des Customer Lifetime Value, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16353