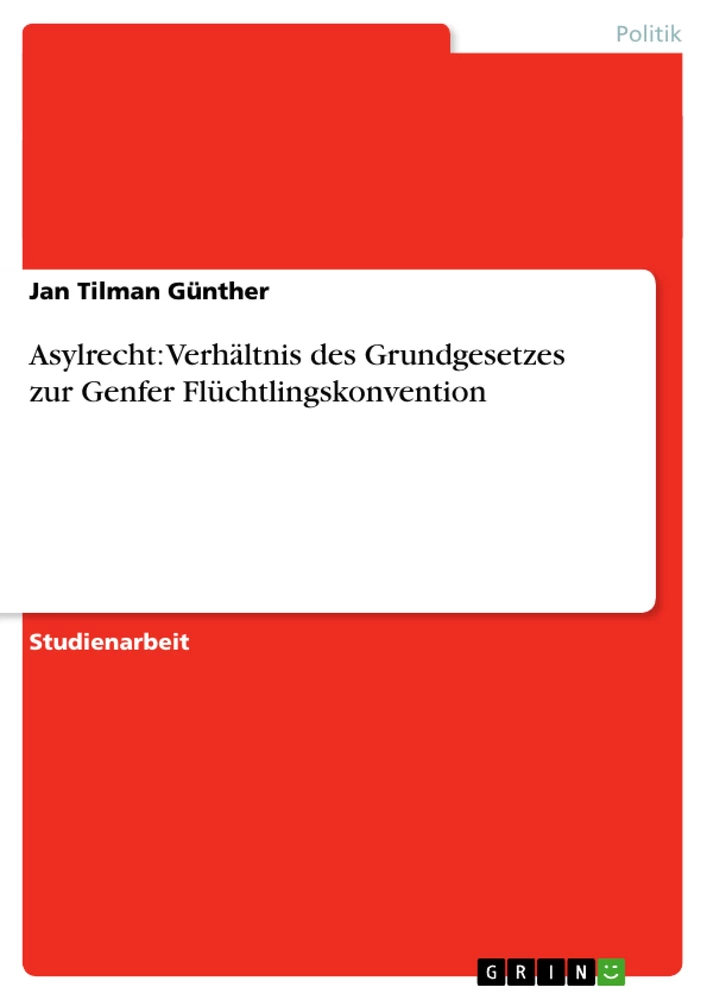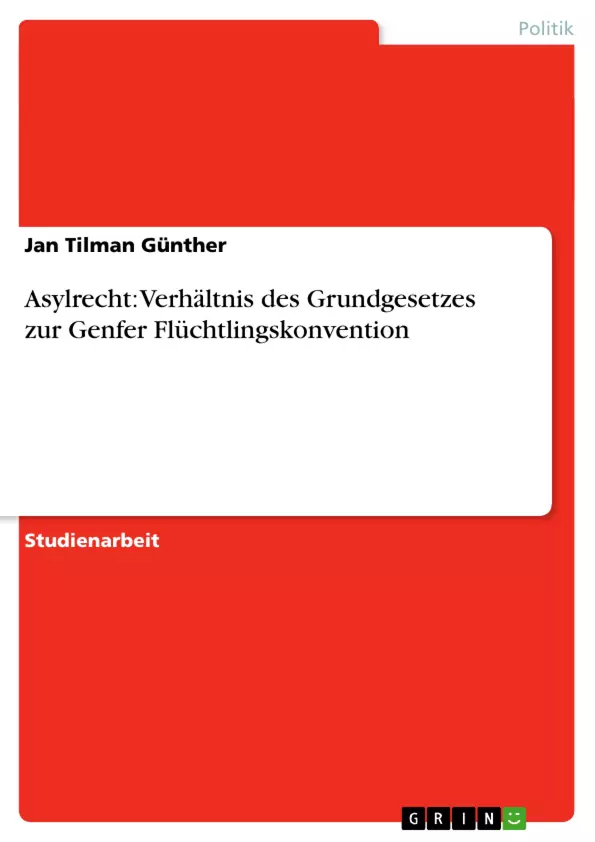„Politisch verfolgte genießen Asyl“, so heißt es in Art. 16a der Verfassung. Nach
den Erfahrungen der Nazidiktatur hat sich die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet,
keinem politisch Verfolgten das Asylrecht zu verwehren. Im Laufe der
Jahrzehnte haben die Flüchtlingszahlen in Westeuropa dramatisch zugenommen.
Seit den 80er Jahren werden die anschwellenden Flüchtlingsströme als
globales Problem wahrnehmbar. Die westlichen Industriestaaten reagieren mit
restriktiven Maßnahmen, die Vereinigten Staaten etwa mit einem Stahlzaun an
der Grenze zu Mexiko, Europa mit dem Schengener Abkommen, das die Öffnung
der Grenzen im Inneren der EU mit der Abschottung nach außen verbindet.
Schließlich wird die Migration immer wieder zum innenpolitischen Problem.
Fremdenfeindliche Ressentiments in der Bevölkerung, die Angst vor wirtschaftlicher
Konkurrenz durch Migranten und die Angst vor „Überfremdung“, vor dem
Verlust kultureller Identität sind weit verbreitet.
Das Recht muss interpretiert werden, und so sagt der Art. 16a GG Satz 1 erst
wenig über die reale Asylpraxis. Wer hat als politischer Flüchtling zu gelten,
welche Kriterien und Nachweise gelten, wer entscheidet? Wird das Asylrecht
liberal oder restriktiv ausgelegt?
In der vorliegenden Arbeit wird das Verhältnis des im Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland niedergelegten Rechts auf Asyl mit den Bestimmungen
des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, der Genfer Flüchtlingskonvention
(GFK) untersucht. Dabei soll insbesondere der Frage nachgegangen
werden, in wie weit das bundesdeutsche Asylrecht - insbesondere
nach der Schaffung des neuen Art. 16a GG im Jahr 1992 - die Kriterien die
Genfer Flüchtlingskonvention erfüllt oder sogar darüber hinaus geht. Dabei soll
in erster Linie die normative Ebene der Gesetzgebung untersucht werden. Detaillierte
Verfahrensfragen bezüglich des Ausländer- und Asylverfahrensgesetzes,
der Asylpraxis des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge und den verschiedenen Urteilen des Verfassungsgerichts und der
Verwaltungsgerichte können im Rahmen dieser Arbeit nicht mit einbezogen
werden, obwohl sie für das Gesamtbild der deutschen Asylpraxis aufschluss4
reich wären. Die höchstrichterlichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes
(BVerfG) und des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) fließen fallweise
in die Arbeit ein.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehung und Wandel des internationalen Flüchtlingsrechts und des nationalen Asylrechts
- 2.1 Entwicklung und Reichweite der Genfer Flüchtlingskonvention
- 2.1.1 Der Flüchtlingsbegriff der GFK
- 2.1.2 Der räumliche und zeitliche Geltungsbereich der Genfer Flüchtlingskonvention
- 2.1.3 Die Ausweitung des Geltungsbereiches der GFK durch das New Yorker Protokoll 1967
- 2.1.4 Die Rechtsstellung der Flüchtlinge
- 2.2 Entstehung und Bestimmungen des Asylrechts im Grundgesetz
- 2.2.1 Entwicklung des Asylrechts in der Bundesrepublik Deutschland bis zur Verfassungsänderung 1993
- 2.2.2 Die Neuregelung des Asylrechts durch den Art. 16a GG
- 2.1 Entwicklung und Reichweite der Genfer Flüchtlingskonvention
- 3. Vereinbarkeit des deutschen Asylrechts mit der Genfer Flüchtlingskonvention
- 3.1 Der Begriff der politischen Verfolgung
- 3.2 Nachfluchtgründe
- 3.3 Das Konzept der sicheren Dritt- und Herkunftsstaaten
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen dem deutschen Asylrecht, wie es im Grundgesetz verankert ist, und den Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK). Im Fokus steht der Vergleich der Kriterien beider Rechtsgrundlagen und die Frage, inwieweit das deutsche Asylrecht – insbesondere nach der Novellierung von Artikel 16a GG im Jahr 1992 – die Kriterien der GFK erfüllt oder über diese hinausgeht. Die Arbeit konzentriert sich auf die normative Ebene der Gesetzgebung.
- Vergleich des deutschen Asylrechts mit der Genfer Flüchtlingskonvention
- Analyse des Flüchtlingsbegriffs in der GFK und im deutschen Recht
- Untersuchung der Entwicklung des deutschen Asylrechts
- Bewertung der Vereinbarkeit beider Rechtsgrundlagen
- Auswirkungen der Novellierung des Art. 16a GG auf die Asylpraxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des deutschen Asylrechts und seiner Beziehung zur Genfer Flüchtlingskonvention ein. Sie beschreibt den historischen Kontext, die steigenden Flüchtlingszahlen und die damit verbundenen innenpolitischen Herausforderungen. Die Arbeit stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Übereinstimmung des deutschen Asylrechts mit der GFK und die These von Otto Kimminich in den Mittelpunkt, wonach das deutsche Grundgesetz in Bezug auf den Asylgrundsatz weiter gefasst sei als das Völkerrecht.
2. Entstehung und Wandel des internationalen Flüchtlingsrechts und des nationalen Asylrechts: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Genfer Flüchtlingskonvention nach dem Zweiten Weltkrieg, ihre Entwicklung und ihre Reichweite. Es beschreibt den Prozess der Ausarbeitung und Ratifizierung der Konvention sowie die Definition des Flüchtlingsbegriffs in Artikel 1 GFK. Die Entwicklung des deutschen Asylrechts von seinen Anfängen bis zur Verfassungsänderung 1993 und die Neuregelung durch Artikel 16a GG werden ebenfalls detailliert dargestellt, um den historischen Kontext und die rechtlichen Grundlagen für den folgenden Vergleich zu legen.
3. Vereinbarkeit des deutschen Asylrechts mit der Genfer Flüchtlingskonvention: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und vergleicht den Begriff der politischen Verfolgung, Nachfluchtgründe und das Konzept der sicheren Dritt- und Herkunftsstaaten im deutschen Asylrecht mit den entsprechenden Bestimmungen der GFK. Es analysiert die Übereinstimmung und die Unterschiede beider Rechtsordnungen und beleuchtet mögliche Diskrepanzen sowie die Auswirkungen auf die Asylpraxis. Das Kapitel untersucht, inwiefern das deutsche Asylrecht die Kriterien der GFK erfüllt und ob es darüber hinausgeht, unter Berücksichtigung von höchstrichterlichen Entscheidungen.
Schlüsselwörter
Asylrecht, Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), Grundgesetz (GG), Artikel 16a GG, politische Verfolgung, Flüchtlingsbegriff, sichere Drittstaaten, Herkunftsstaaten, Völkerrecht, nationales Recht, Rechtsvergleich, Asylpraxis, Flüchtlingsströme, Migration.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Vergleich des deutschen Asylrechts mit der Genfer Flüchtlingskonvention
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument analysiert das Verhältnis zwischen dem deutschen Asylrecht (insbesondere Art. 16a GG) und der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK). Es vergleicht die Kriterien beider Rechtsgrundlagen und untersucht die Vereinbarkeit. Der Fokus liegt auf der normativen Ebene der Gesetzgebung.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Entstehung und Entwicklung sowohl des internationalen Flüchtlingsrechts (GFK) als auch des nationalen Asylrechts in Deutschland. Es vergleicht den Flüchtlingsbegriff, die politischen Verfolgungsgründe, das Konzept sicherer Dritt- und Herkunftsstaaten und untersucht die Auswirkungen der Novellierung des Art. 16a GG auf die Asylpraxis. Die Arbeit bewertet die Vereinbarkeit beider Rechtsgrundlagen und bezieht sich auf einschlägige Rechtsprechung.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Entstehung und zum Wandel des internationalen und nationalen Rechts, ein Kapitel zum Vergleich der Vereinbarkeit des deutschen Asylrechts mit der GFK und ein Fazit. Das zweite Kapitel beschreibt detailliert die Entwicklung der GFK und des Art. 16a GG. Das dritte Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert die Übereinstimmung und Unterschiede beider Rechtsordnungen.
Wie wird der Flüchtlingsbegriff in diesem Dokument behandelt?
Der Flüchtlingsbegriff wird im Kontext der GFK und des deutschen Rechts verglichen. Die Definition des Flüchtlings nach Artikel 1 GFK wird erläutert und mit der deutschen Rechtslage konfrontiert. Die Arbeit untersucht, ob und wie der deutsche Flüchtlingsbegriff mit dem der GFK übereinstimmt oder davon abweicht.
Welche Rolle spielt Artikel 16a GG?
Artikel 16a GG spielt eine zentrale Rolle, da er die Neuregelung des deutschen Asylrechts darstellt. Das Dokument analysiert die Auswirkungen dieser Novellierung (1993) auf die Asylpraxis und die Vereinbarkeit mit der GFK. Die Entwicklung des Asylrechts vor und nach der Änderung von Art. 16a GG wird detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Asylrecht, Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), Grundgesetz (GG), Artikel 16a GG, politische Verfolgung, Flüchtlingsbegriff, sichere Drittstaaten, Herkunftsstaaten, Völkerrecht, nationales Recht, Rechtsvergleich, Asylpraxis, Flüchtlingsströme, Migration.
Welche These wird im Dokument vertreten?
Das Dokument untersucht die These von Otto Kimminich, wonach das deutsche Grundgesetz in Bezug auf den Asylgrundsatz weiter gefasst sei als das Völkerrecht (GFK).
Für wen ist dieses Dokument bestimmt?
Dieses Dokument richtet sich an Personen, die sich akademisch mit dem deutschen Asylrecht und dessen Verhältnis zur Genfer Flüchtlingskonvention auseinandersetzen möchten. Es eignet sich für Studierende der Rechtswissenschaften, Wissenschaftler und alle Interessierten mit entsprechendem Vorwissen.
- Quote paper
- Jan Tilman Günther (Author), 2002, Asylrecht: Verhältnis des Grundgesetzes zur Genfer Flüchtlingskonvention, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16354