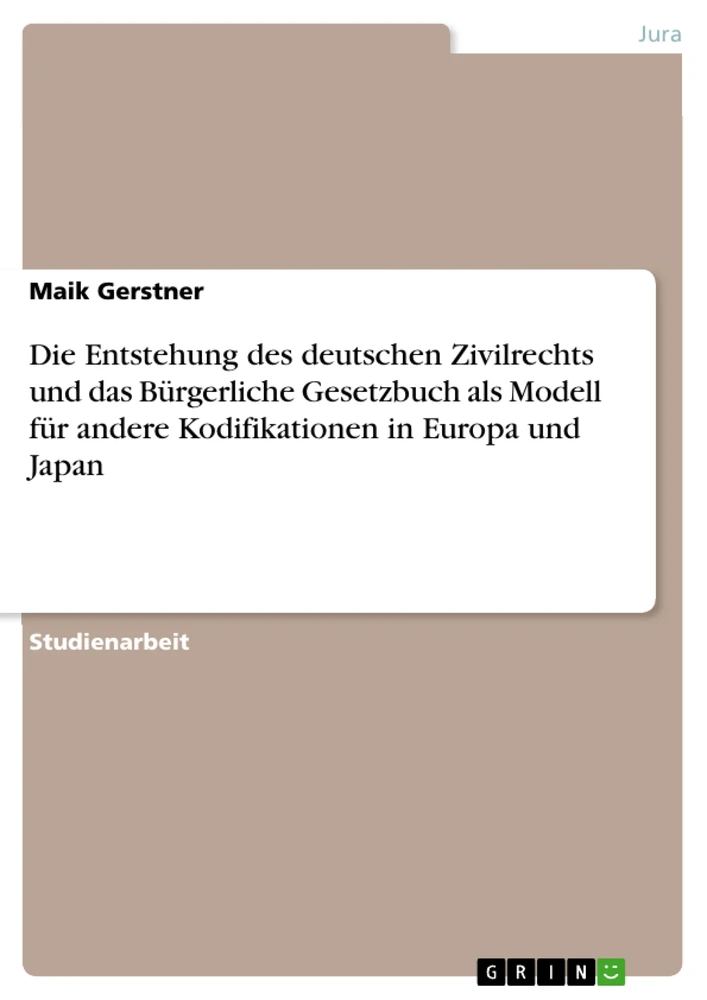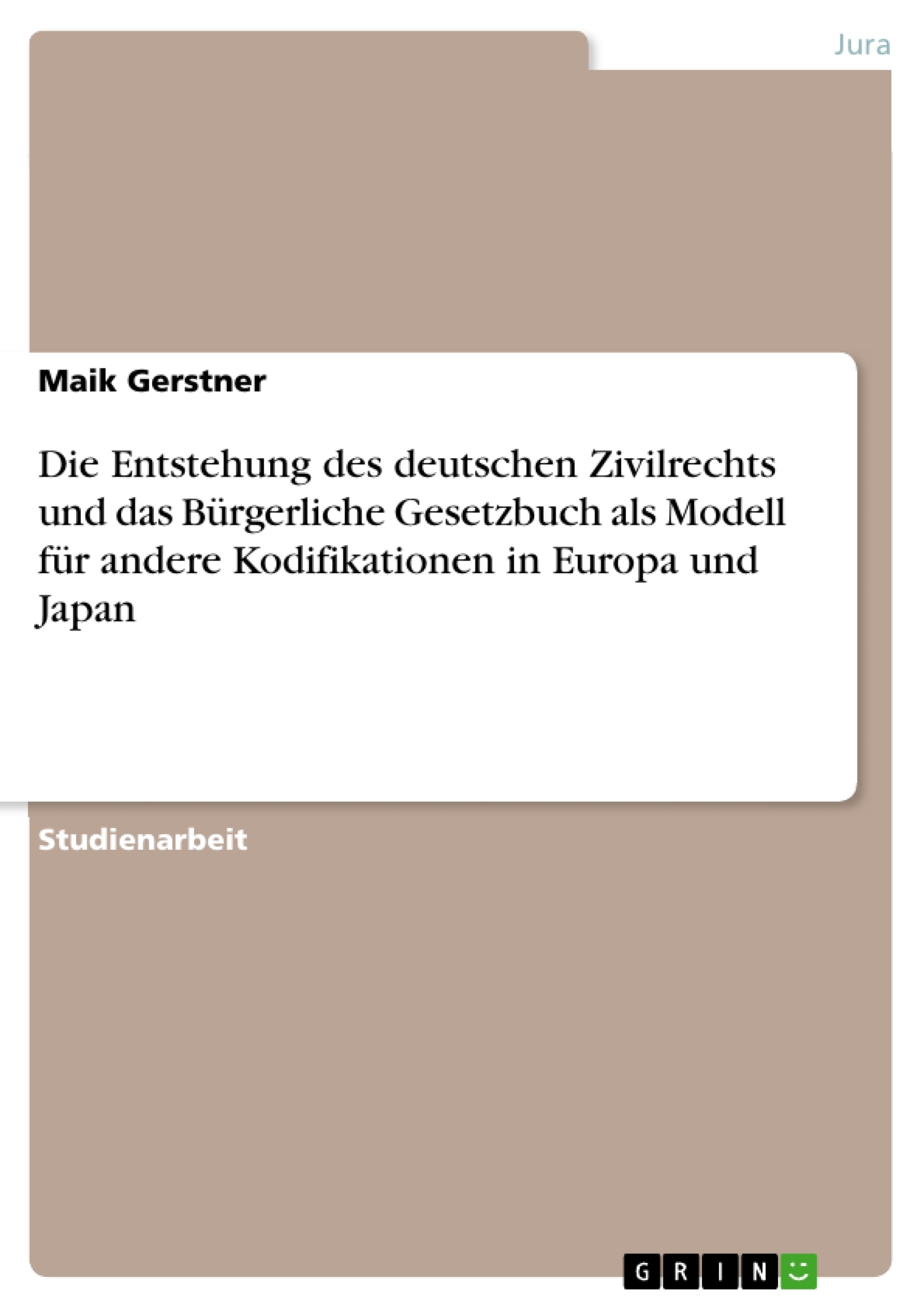Diese Hausarbeit zeigt die bedeutende Entwicklung des Zivilrechts in Europa ab Beginn des römischen Rechts. Hauptaugenmerk liegt aber im deutschen Raum vom Beginn des römischen Rechts bis hin zur Kodifizierung des Zivilrechts in Gestalt des BGB.
Anschließend wird die Kodifizierung ausländischer Zivilgesetzbücher mit Bezug zum BGB betrachtet.
Suchbegriffe:
Rechtskreise, Civil Law, germanischer Rechtskreis, deutscher Rechtskreis, römisches Recht, römisch-byzantinisches Recht, Zwölftafelgesetz, Justinian, Corpus Iuris Civiles, europäisches Mittelalter, Glossen, Glossatoren, Azo, Accursius, Glossa ordinaria, Eike von Repgow, Sachsenspiegel, Konsiliatoren, Baldus de Ubaldis, Bartolus de Sassoferrato, Ewiger Landfrieden, Johann Freiherr von Schwarzenberg , Constitutio Criminalis Carolina, Ulrich Zasius, europäische Neuzeit, Usus modernus pandectarum, Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis, Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, Code civil, Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, Friedrich Justus Thibaut, Friedrich Carl von Savigny, 18.05.1848, Nationalversammlung, Deutscher Bund, Norddeutscher Bund, BGB, Bürgerliches Gesetzbuch, Pandektenwissenschaft, Bernhard Windscheid, Otto von Gierke, Nationalsozialismus, NSDAP, Volksgesetzbuch, ZGB, Zivilgesetzbuch, DDR, Deutsche Demokratische Republik, Österreich, Griechenland, Japan, JBGB, Japanisches Bürgerliches Gesetzbuch, 1853, Admiral Perry, ungleiche Verträge, Hermann Techow, Otto Rudorff, Hermann Roesler, Boissonade
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Entstehung der römisch-germanischen Rechtsfamilie
- 3. Das europäische Mittelalter
- 4. Die europäische Neuzeit
- 5. Die Entstehung des BGB
- 6. Das BGB zur Zeit des Nationalsozialismus
- 7. Die Ablösung des BGB durch das ZGB in der Deutschen Demokratischen Republik
- 8. Das BGB als Modell für Zivilrechtskodifikationen im Ausland
- 8.1 Im europäischen Ausland
- 8.2 In Brasilien
- 8.3 In Japan
- 9. Fazit
- Literaturverzeichnis
- Internetverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Entstehung des deutschen Zivilrechts und analysiert die Entwicklung vom römischen Recht bis hin zur Kodifizierung des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Darüber hinaus werden die Einflüsse des BGB auf andere Zivilrechtskodifikationen im Ausland beleuchtet.
- Entwicklung des deutschen Zivilrechts vom römischen Recht zum BGB
- Die Rolle des BGB in der deutschen Rechtsgeschichte
- Einfluss des BGB auf andere Zivilrechtskodifikationen
- Vergleichende Betrachtung von Zivilrechtskodifikationen in verschiedenen Ländern
- Bedeutung der Kodifizierung für die Rechtsentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung der Rechtskreiseinteilung erläutert und die Besonderheit des deutschen Zivilrechts im Kontext des "Civil Law" hervorhebt. Kapitel 2 beleuchtet die Entstehung der römisch-germanischen Rechtsfamilie, beginnend mit der Gründung Roms und der Entwicklung des römischen Rechts. Kapitel 3 untersucht die Epoche des europäischen Mittelalters und dessen Einfluss auf die Entwicklung des deutschen Zivilrechts. Kapitel 4 analysiert die europäische Neuzeit und die Herausforderungen, die zur Entwicklung des BGB führten. Kapitel 5 konzentriert sich auf die Entstehung des BGB und seine Bedeutung für die deutsche Rechtsordnung. In Kapitel 6 wird die Rolle des BGB während der Zeit des Nationalsozialismus beleuchtet. Kapitel 7 behandelt die Ablösung des BGB durch das Zivilgesetzbuch (ZGB) in der Deutschen Demokratischen Republik. Kapitel 8 untersucht die Bedeutung des BGB als Vorbild für Zivilrechtskodifikationen im europäischen Ausland, in Brasilien und in Japan.
Schlüsselwörter
Römisch-germanische Rechtsfamilie, Civil Law, Kodifizierung, BGB, Zivilrecht, Rechtsgeschichte, Rechtskreis, Rechtsordnung, Europa, Japan, Brasilien, Vergleichende Rechtswissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wie entstand das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)?
Das BGB entstand nach jahrzehntelangen Vorarbeiten im 19. Jahrhundert auf Basis der Pandektenwissenschaft und trat am 1. Januar 1900 in Kraft.
Welchen Einfluss hatte das römische Recht auf das BGB?
Das römische Recht (insbesondere das Corpus Iuris Civilis) bildete über den Usus modernus pandectarum die wissenschaftliche Grundlage für das deutsche Zivilrecht.
Warum diente das BGB als Vorbild für das japanische Zivilrecht?
Im Zuge der Meiji-Restauration suchte Japan nach modernen westlichen Kodifikationen, um die „ungleichen Verträge“ zu beenden; das systematische BGB bot hierfür ein ideales Modell.
Was geschah mit dem BGB während der DDR-Zeit?
In der DDR wurde das BGB zunehmend als bürgerlich-kapitalistisch abgelehnt und schließlich 1975 durch das Zivilgesetzbuch (ZGB) der DDR ersetzt.
Wer waren die Glossatoren und Konsiliatoren?
Dies waren mittelalterliche Juristengruppen, die das römische Recht wissenschaftlich aufarbeiteten und so die Rezeption des römischen Rechts in Europa ermöglichten.
- Citar trabajo
- Maik Gerstner (Autor), 2010, Die Entstehung des deutschen Zivilrechts und das Bürgerliche Gesetzbuch als Modell für andere Kodifikationen in Europa und Japan, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163545