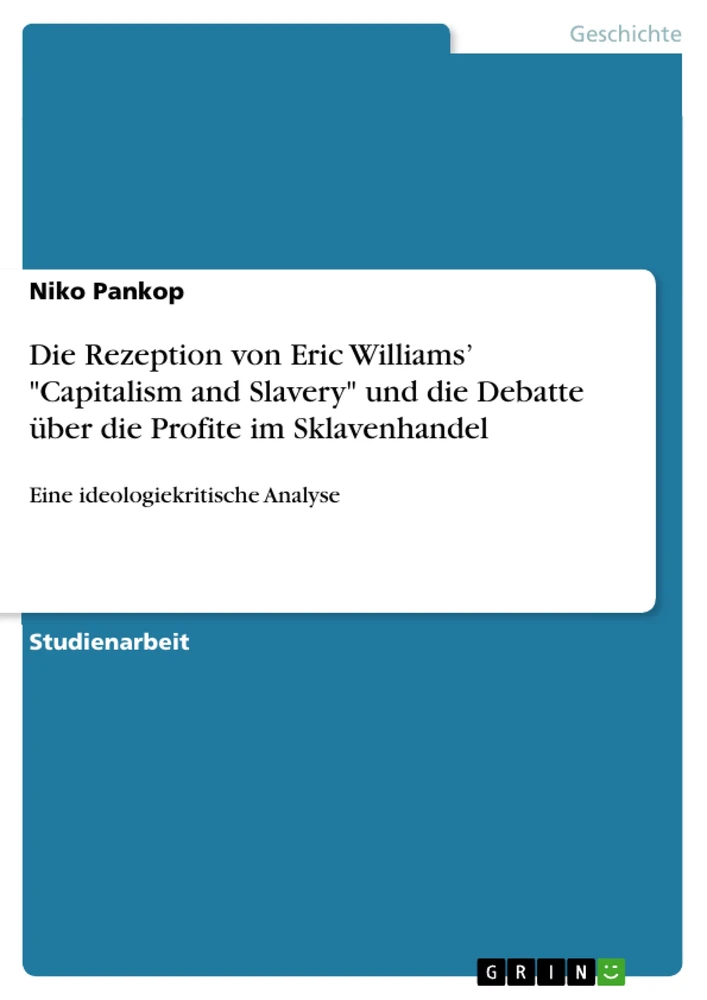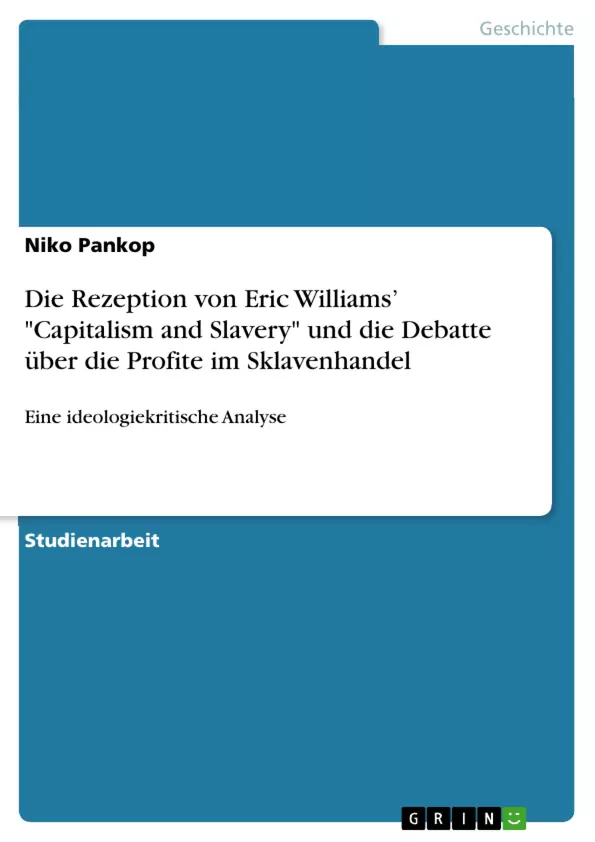„Every age rewrites history, but particularly ours, which has been forced by events to re-evaluate our conceptions of history and economic and political development.” Mit diesen Worten beginnt Eric Williams sein Werk "Capitalism and Slavery", das er 1944 herausbrachte und in dem er neue mutige Thesen über den Zusammenhang zwischen der Sklaverei, dem Dreieckshandel und der Entwicklung des Kapitalismus aufstellte. In einnehmender Weise schrieb er mit diesem Werk die Geschichte neu, beeinflusst von den entstehenden Unabhängigkeitsbewegungen in den Kolonien, speziell seiner Heimat Trinidad und Tobago.
Aber nicht nur jede Epoche schreibt ihre eigene Geschichte, sondern auch die Protagonisten jeder Epoche jeweils aus ihrem eigenen Blickwinkel. So kam es in der Folge des Erscheinens von Capitalism and Slavery zu den verschiedensten Reaktionen, die jedes Mal von den jeweiligen zeitgenössischen Ereignissen und von der geographischen und politischen Herkunft ihrer Autoren geprägt waren. Diese Arbeit fast die bahnbrechenden Ergebnisse von Capitalism and Slavery zusammen und umreißt und kommentiert auch den Kern der wichtigsten Antworten, die dieses Werk hervorrief. Hierbei konzentriert sich die Arbeit auf einen Zweig der Debatte, der sich einer der zwei Hauptthesen in Capitalism and Slavery über die Bedeutung der Sklaverei für die Entwicklung des Kapitalismus widmete. Dabei geht es um die Annahme, dass die Profite aus dem Sklavenhandel einen unentbehrlichen Beitrag zum Start der Industriellen Revolution in Großbritannien leisteten.
Die Rezeption von Capitalism und Slavery unterlag dabei einer Entwicklung, die von anfänglicher Zurückweisung des Werkes in den 40er, 50er und Anfang der 60er Jahre, bis hin zur formellen Anerkennung der Williamsthesen durch die Geschichtswissenschaft seit Mitte der 60er Jahre reichte.
Im Anschluss daran bemüht sich diese Arbeit um ideologiekritische Bewertung der Debatte. Die Debatte wird in ihrem historischen und ideologischen Kontext untersucht. Dabei wird erörtert, welches der jeweilige Hintergrund von Stellungnahmen war und wie diese Stellungnahmen in ihrem politischen Kontext zu erklären sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Eric Williams' Capitalism and Slavery
- 2.1. Wirtschaftliche Bedeutung des Dreieckshandels und Gründe für die Abolition - eine kurze Darstellung der zentralen Williamsthesen
- 2.2. Marxistische Geschichtsschreibung und koloniale Emanzipationsbestrebungen - prägende Einflüsse auf Capitalism and Slavery
- 3. Die Rezeption von Williams' These zur wirtschaftlichen Bedeutung des Sklavenhandels
- 3.1. Vorwurf von Voreingenommenheit und wirtschaftlichem Determinismus in den 40er und 50er Jahren
- 3.2. Debatte der 60er und 70er Jahre - eine verengte Debatte über die Höhe der Profite
- 4. Kontextualisierung und ideologiekritische Bewertung der Debatte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Rezeption von Eric Williams' "Capitalism and Slavery" und die darauf folgende Debatte über die Bedeutung des Sklavenhandels für die Entwicklung des Kapitalismus. Sie untersucht kritisch die Argumente der Befürworter und Gegner von Williams' These, insbesondere die Frage nach dem Umfang der Profite aus dem Sklavenhandel und deren Beitrag zur Industrialisierung Großbritanniens. Die Arbeit betrachtet die Debatte im historischen und ideologischen Kontext und bewertet sie ideologiekritisch.
- Die wirtschaftliche Bedeutung des Dreieckshandels nach Eric Williams
- Die Rezeption von Williams' Werk in verschiedenen historischen Phasen
- Die Kritik an Williams' These und die Argumentationslinien der Kritiker
- Der ideologische Kontext der Debatte
- Die Rolle von Profiten aus dem Sklavenhandel in der industriellen Revolution
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt Eric Williams' "Capitalism and Slavery" (1944) vor, das mutige Thesen über den Zusammenhang zwischen Sklaverei, Dreieckshandel und der Entwicklung des Kapitalismus aufstellte. Sie beschreibt die unterschiedlichen Reaktionen auf das Werk, beeinflusst von zeitgenössischen Ereignissen und den Hintergründen der jeweiligen Autoren. Der Fokus liegt auf der Debatte um die These, dass Profite aus dem Sklavenhandel essentiell für den Beginn der industriellen Revolution in Großbritannien waren. Stanley Engermans Artikel "The Slave Trade and British Capital Formation" wird als zentrale Gegenposition zu Williams' Werk genannt. Die Arbeit skizziert die Entwicklung der Rezeption von "Capitalism and Slavery", von anfänglicher Zurückweisung bis hin zur Anerkennung der Williamsthesen.
2. Eric Williams' Capitalism and Slavery: Dieses Kapitel fasst Williams' zentrale These zusammen: Der Dreieckshandel stimulierte die britische Industrie dreifach – durch den Kauf von Sklaven mit britischen Manufakturprodukten, durch die Produktion von Rohstoffen auf den Plantagen und durch die Versorgung der Sklaven und ihrer Besitzer. Die daraus resultierenden Profite finanzierten maßgeblich die industrielle Revolution. Williams' Arbeit wird im Kontext der kolonialen Emanzipationsbewegungen und marxistischer Geschichtsschreibung eingeordnet. Die detaillierte Darstellung des Dreieckshandels mit seinen Warenströmen zwischen Großbritannien, der Karibik und Afrika verdeutlicht die weitreichenden ökonomischen Auswirkungen der Sklaverei.
3. Die Rezeption von Williams' These zur wirtschaftlichen Bedeutung des Sklavenhandels: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Debatte um Williams' These. In den 1940er und 1950er Jahren wurde Williams' Arbeit vor allem wegen angeblicher Voreingenommenheit und wirtschaftlichem Determinismus kritisiert. In den 1960er und 1970er Jahren verengte sich die Debatte auf die Höhe der Profite aus dem Sklavenhandel. Die Arbeit analysiert die Argumente der Kritiker und setzt sie in einen historischen Kontext. Der Fokus liegt auf der Untersuchung von Rezensionen und Artikeln, die eine kritische Auseinandersetzung mit Williams' Arbeit darstellen, einschließlich des bereits erwähnten Artikels von Engerman.
4. Kontextualisierung und ideologiekritische Bewertung der Debatte: Dieses Kapitel bietet eine ideologiekritische Bewertung der Debatte um Williams' "Capitalism and Slavery". Es analysiert die historischen und ideologischen Hintergründe der verschiedenen Positionen und deren jeweilige politischen Kontexte. Die Arbeit untersucht, wie die verschiedenen Stellungnahmen zu Williams’ Arbeit durch den politischen Kontext und die jeweiligen Hintergründe der Autoren beeinflusst wurden. Sie untersucht, wie diese ideologischen Einflüsse die Interpretation von historischen Fakten prägten.
Schlüsselwörter
Eric Williams, Capitalism and Slavery, Dreieckshandel, Sklavenhandel, industrielle Revolution, Großbritannien, Profit, Marxistische Geschichtsschreibung, Kolonialismus, Ideologiekritik, Rezeption, Wirtschaftsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zu "Rezeption von Eric Williams' Capitalism and Slavery"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Rezeption von Eric Williams' "Capitalism and Slavery" und die darauf folgende Debatte über die Bedeutung des Sklavenhandels für die Entwicklung des Kapitalismus. Sie untersucht kritisch die Argumente der Befürworter und Gegner von Williams' These, insbesondere die Frage nach dem Umfang der Profite aus dem Sklavenhandel und deren Beitrag zur Industrialisierung Großbritanniens. Die Arbeit betrachtet die Debatte im historischen und ideologischen Kontext und bewertet sie ideologiekritisch.
Welche zentralen Thesen von Eric Williams werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf Williams' These, dass der Dreieckshandel die britische Industrie dreifach stimulierte: durch den Kauf von Sklaven mit britischen Manufakturprodukten, durch die Produktion von Rohstoffen auf den Plantagen und durch die Versorgung der Sklaven und ihrer Besitzer. Die daraus resultierenden Profite, so Williams, finanzierten maßgeblich die industrielle Revolution. Die Arbeit untersucht auch die Einordnung von Williams' Werk im Kontext der kolonialen Emanzipationsbewegungen und marxistischer Geschichtsschreibung.
Wie wird die Rezeption von Williams' "Capitalism and Slavery" dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung der Debatte um Williams' These über die verschiedenen historischen Phasen. In den 1940er und 1950er Jahren wurde Williams' Arbeit aufgrund von angeblicher Voreingenommenheit und wirtschaftlichem Determinismus kritisiert. In den 1960er und 1970er Jahren verengte sich die Debatte auf die Höhe der Profite aus dem Sklavenhandel. Die Arbeit analysiert die Argumente der Kritiker und setzt sie in einen historischen Kontext. Der Fokus liegt auf der Untersuchung von Rezensionen und Artikeln, die eine kritische Auseinandersetzung mit Williams' Arbeit darstellen, einschließlich des Artikels von Engerman.
Welche Rolle spielt die Ideologiekritik in dieser Arbeit?
Die Arbeit bietet eine ideologiekritische Bewertung der Debatte um Williams' "Capitalism and Slavery". Sie analysiert die historischen und ideologischen Hintergründe der verschiedenen Positionen und deren jeweilige politische Kontexte. Es wird untersucht, wie die verschiedenen Stellungnahmen zu Williams’ Arbeit durch den politischen Kontext und die jeweiligen Hintergründe der Autoren beeinflusst wurden und wie diese ideologischen Einflüsse die Interpretation von historischen Fakten prägten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem einzelnen?
Die Arbeit umfasst vier Kapitel: 1. Einleitung (Einführung in Williams' Werk und die darauf folgende Debatte); 2. Eric Williams' Capitalism and Slavery (Zusammenfassung der zentralen These Williams'); 3. Die Rezeption von Williams' These (Analyse der Kritik an Williams' Arbeit in verschiedenen Phasen); 4. Kontextualisierung und ideologiekritische Bewertung der Debatte (ideologiekritische Bewertung der Debatte und ihrer historischen und politischen Kontexte).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Eric Williams, Capitalism and Slavery, Dreieckshandel, Sklavenhandel, industrielle Revolution, Großbritannien, Profit, Marxistische Geschichtsschreibung, Kolonialismus, Ideologiekritik, Rezeption, Wirtschaftsgeschichte.
- Quote paper
- Niko Pankop (Author), 2009, Die Rezeption von Eric Williams’ "Capitalism and Slavery" und die Debatte über die Profite im Sklavenhandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163599