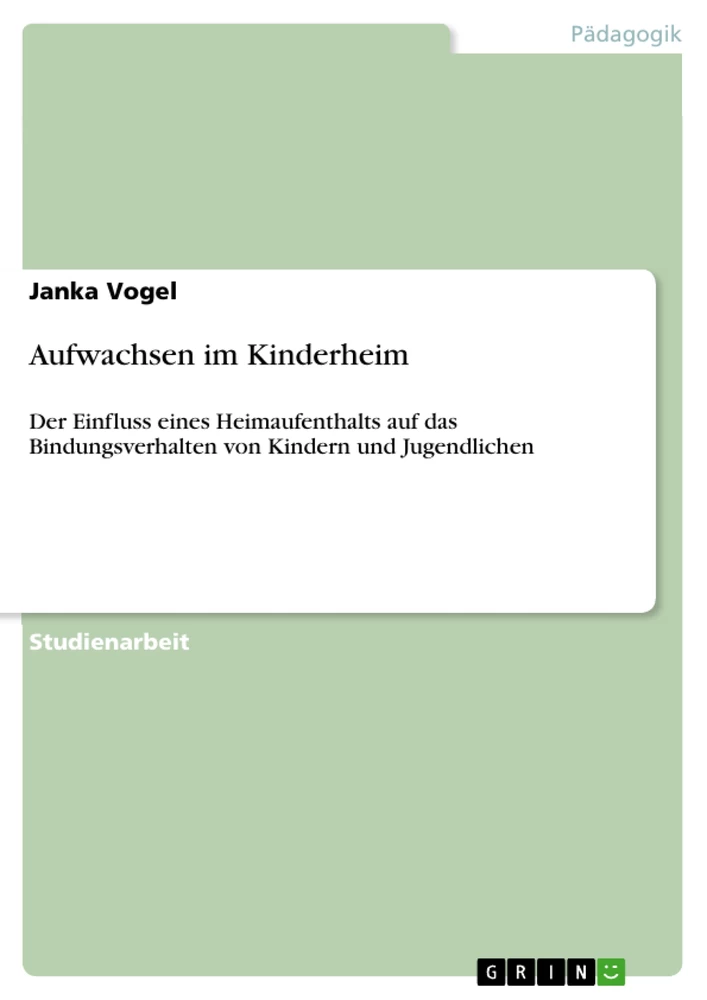Es soll im Rahmen dieser Arbeit die Frage gestellt werden, inwieweit sich der Aufenthalt in einer Anstalt auf das Bindungsverhalten des Kindes/Jugendlichen auswirken kann. Wie stehen sich bindungsfördernde und bindungsverhindernde Faktoren gegenüber; welche überwiegen im von uns im Folgenden untersuchten Milieu? Neben theoretischen Überlegungen zur vorgestellten Problematik sollen aber immer auch praktische Beispiele stehen. Jede pädagogische Theorie ist sinnlos, wenn sie nicht den konkreten Menschen und sein Wohlergehen zum Ziel hat. Abgerundet wird diese Arbeit deshalb mit den Stimmen jener, die selbst in heimen oder ähnlichen Instutitionen aufwuchsen. Dass die zu behandelnde Problemstellung historische und globale Dimensionen hat, wird ein Vergleich deutscher und rumänischer Heimerziehung andeuten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Lebenswelt Heim
- 2.1 Zur Geschichte der Heimerziehung
- 2.2 Heimerziehung heute
- 2.3 Der Weg ins Heim
- 2.4 Leben im Heim
- 3. Das Heim-Milieu unter psychologisch-bindungstheoretischen Gesichtspunkten
- 3.1 Bindungstheoretische Grundlagen
- 3.2 Heimaufenthalt und Bindungsbedürfnis
- 3.3 Bindungsstörung vs. gelingende Bindung
- 4. Erfahrungen von Heimkindern
- 4.1 „Hölle von Staat und Kirche“ - Aufgewachsen im Nachkriegsdeutschland
- 4.2 „Ich hasse meine Mutter“ - Aufgewachsen in einem Kinderheim Rumäniens
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Heimaufenthalts auf das Bindungsverhalten von Kindern und Jugendlichen. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Heimerziehung, analysiert das spezifische Milieu von Kinderheimen und deren Auswirkungen auf die Bindungsentwicklung der Kinder. Der Fokus liegt auf der Gegenüberstellung bindungsfördernder und bindungsbehindernder Faktoren im Kontext des Heimaufenthalts.
- Historische Entwicklung der Heimerziehung
- Das Heim-Milieu und seine Auswirkungen auf Kinder
- Bindungstheoretische Grundlagen und ihre Relevanz für Heimkinder
- Vergleichende Betrachtung der Heimerziehung in verschiedenen Kontexten (Deutschland, Rumänien)
- Analyse von Erfahrungen von Heimkindern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie anhand des Beispiels von Felizitas B. die Problematik des Aufwachsens in einem Kinderheim veranschaulicht. Sie beschreibt die ambivalenten Aspekte der Heimerziehung und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss des Heimaufenthalts auf das Bindungsverhalten von Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit verbindet theoretische Überlegungen mit praktischen Beispielen und vergleicht die Heimerziehung in Deutschland und Rumänien, um die historischen und globalen Dimensionen des Themas zu beleuchten.
2. Lebenswelt Heim: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Lebenswelt von Kindern in Heimen. Es beginnt mit einem historischen Abriss der Heimerziehung, beginnend mit mittelalterlichen Hospitälern bis hin zur Entwicklung frühkapitalistischer Zwangsarbeitsanstalten. Der Fokus liegt auf den sich verändernden Bedingungen und Ideologien der Heimerziehung über die Jahrhunderte, wobei kritische Aspekte wie Ausbeutung und menschenunwürdige Zustände hervorgehoben werden. Es wird die Entwicklung hin zu einer Professionalisierung der Heimerziehung im 20. Jahrhundert skizziert.
3. Das Heim-Milieu unter psychologisch-bindungstheoretischen Gesichtspunkten: Dieses Kapitel analysiert das Heim-Milieu unter dem Blickwinkel der Bindungstheorie. Es beschreibt zunächst die bindungstheoretischen Grundlagen und setzt diese in Beziehung zum Heimaufenthalt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Spannungsfeld zwischen Bindungsbedürfnis und den Bedingungen in Heimen, die sowohl bindungsfördernde als auch bindungsbehindernde Faktoren aufweisen können. Es wird untersucht, unter welchen Umständen Bindungsstörungen entstehen und wie gelingende Bindung im Kontext eines Heimaufenthalts gefördert werden kann.
4. Erfahrungen von Heimkindern: Dieses Kapitel präsentiert Erfahrungen von Heimkindern aus unterschiedlichen Kontexten. Es vergleicht die Erlebnisse von Kindern, die in deutschen Nachkriegsheimen und in rumänischen Kinderheimen aufgewachsen sind. Dieser Vergleich soll die unterschiedlichen Bedingungen und deren Auswirkungen auf die betroffenen Kinder aufzeigen und die komplexen Herausforderungen der Heimerziehung veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Heimerziehung, Bindungsverhalten, Kinder, Jugendliche, Bindungstheorie, Entwicklung, Sozialisation, Lebenswelt, Geschichte der Heimerziehung, Deutschland, Rumänien, Kinderschutz, Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss des Heimaufenthalts auf das Bindungsverhalten von Kindern und Jugendlichen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Aufwachsens in einem Heim auf das Bindungsverhalten von Kindern und Jugendlichen. Sie analysiert die historische Entwicklung der Heimerziehung, das spezifische Milieu von Kinderheimen und deren Auswirkungen auf die Bindungsentwicklung. Dabei werden bindungsfördernde und bindungsbehindernde Faktoren im Kontext des Heimaufenthalts verglichen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Heimerziehung, das Heim-Milieu und dessen Auswirkungen auf Kinder, bindungstheoretische Grundlagen und deren Relevanz für Heimkinder, einen Vergleich der Heimerziehung in Deutschland und Rumänien sowie die Analyse von Erfahrungen von Heimkindern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Lebenswelt Heim (mit Unterkapiteln zur Geschichte, Gegenwart, Weg ins Heim und Leben im Heim), Das Heim-Milieu unter psychologisch-bindungstheoretischen Gesichtspunkten (mit Unterkapiteln zu Bindungstheorie, Heimaufenthalt und Bindungsbedürfnis, sowie Bindungsstörung vs. gelingende Bindung), Erfahrungen von Heimkindern (mit Unterkapiteln zu Erfahrungen in deutschen und rumänischen Heimen) und Fazit.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, veranschaulicht die Problematik anhand eines Beispiels und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss des Heimaufenthalts auf das Bindungsverhalten. Sie beschreibt die ambivalenten Aspekte der Heimerziehung und vergleicht die Heimerziehung in Deutschland und Rumänien.
Worauf konzentriert sich das Kapitel "Lebenswelt Heim"?
Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Lebenswelt von Kindern in Heimen. Es beinhaltet einen historischen Abriss der Heimerziehung, von mittelalterlichen Hospitälern bis zur Entwicklung frühkapitalistischer Zwangsarbeitsanstalten, und skizziert die Entwicklung hin zu einer Professionalisierung im 20. Jahrhundert.
Wie wird das Heim-Milieu analysiert?
Das Kapitel "Das Heim-Milieu unter psychologisch-bindungstheoretischen Gesichtspunkten" analysiert das Heim-Milieu anhand der Bindungstheorie. Es beschreibt die bindungstheoretischen Grundlagen und deren Beziehung zum Heimaufenthalt, untersucht das Spannungsfeld zwischen Bindungsbedürfnis und den Bedingungen in Heimen und analysiert die Entstehung von Bindungsstörungen sowie die Förderung gelingender Bindung im Heimkontext.
Welche Erfahrungen von Heimkindern werden dargestellt?
Das Kapitel "Erfahrungen von Heimkindern" präsentiert die Erlebnisse von Kindern aus deutschen Nachkriegsheimen und rumänischen Kinderheimen. Der Vergleich soll die unterschiedlichen Bedingungen und deren Auswirkungen aufzeigen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heimerziehung, Bindungsverhalten, Kinder, Jugendliche, Bindungstheorie, Entwicklung, Sozialisation, Lebenswelt, Geschichte der Heimerziehung, Deutschland, Rumänien, Kinderschutz, Pädagogik.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist der Einfluss des Heimaufenthalts auf das Bindungsverhalten von Kindern und Jugendlichen.
Welche Länder werden im Vergleich betrachtet?
Die Arbeit vergleicht die Heimerziehung in Deutschland und Rumänien.
- Quote paper
- Janka Vogel (Author), 2010, Aufwachsen im Kinderheim, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163602