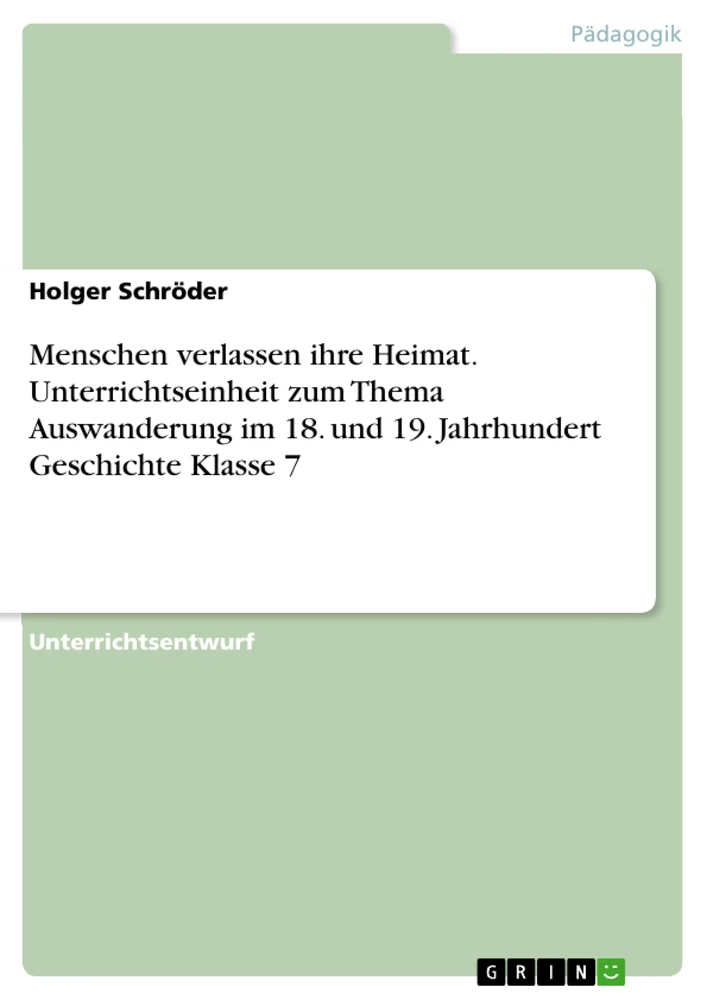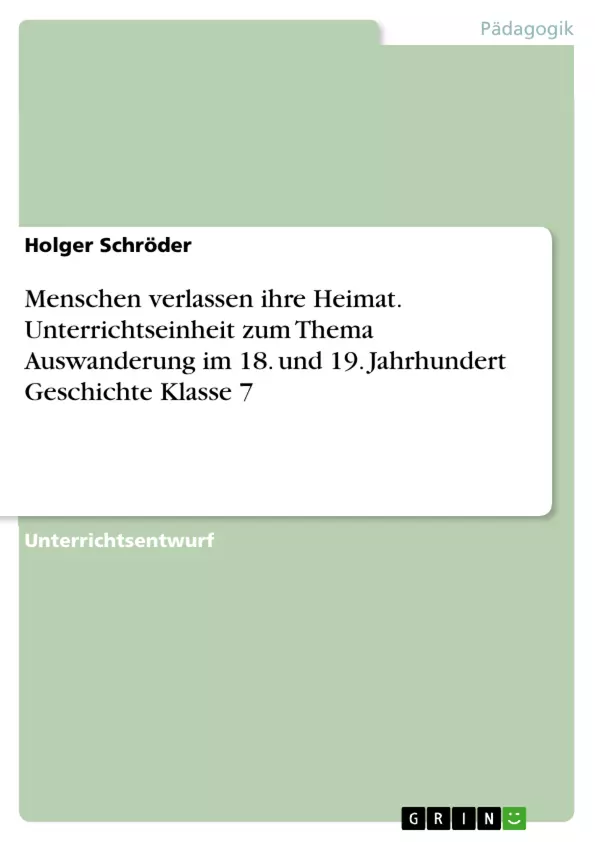Das 20. Jahrhundert gilt als Jahrhundert der Migration schlechthin. Dabei erlebten viele Menschen mehr oder weniger freiwillig Migration. Diesen Sachverhalt möchte der Entwurf aufgreifen, um anhand der Fußball Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, genauer gesagt an der deutschen Nationalmannschaft das Phänomen der Wanderungsbewegung herauszuarbeiten. Der auf den ersten Blick wahrnehmbare Migrationshintergrund mancher deutscher Spieler wird in dieser Stunde mittels des DFB-Migrationswerbespots thematisiert und einleitend problematisiert. In der darauf folgenden Erarbeitungsphase sollen die Schüler durch biografische Erlebnisgeschichten über verschiedene Jahrhunderte hinweg, Grundmotive benennen können, weshalb Menschen ihre Heimat verließen.
Inhaltsverzeichnis
- Bedingungsanalyse
- Allgemeine Schulische Situation
- Ist-Stand-Feststellung
- Einbettung der Stunde in die Unterrichtseinheit
- Didaktische Reflexion
- Kompetenzen und Inhalte des Bildungsplans
- Sachanalyse
- Kompetenzen und Standards
- Stundenziel
- Methodische Reflexion
- Methodische Planung mit Alternativen und Begründung
- Strukturskizze
- Anhang
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Tafelbild
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Lehrprobe befasst sich mit dem Thema der Auswanderung im 18. und 19. Jahrhundert im Rahmen der Unterrichtseinheit „In die Fremde - Auswanderung im 18. und 19. Jahrhundert“. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse individueller Wanderungsgeschichten, die unterschiedliche politische, religiöse und wirtschaftliche Beweggründe beleuchten.
- Individuelle Wanderungsgeschichten als Quelle für die Analyse von Auswanderungsmustern
- Politische, religiöse und wirtschaftliche Ursachen von Auswanderung im 18. und 19. Jahrhundert
- Lebensbedingungen und Herausforderungen der Auswanderer im Zielgebiet
- Die Rolle von Auswanderung in der europäischen Geschichte
- Die Bedeutung von historischen Quellen für die Rekonstruktion von Wanderungsgeschichten
Zusammenfassung der Kapitel
Bedingungsanalyse
Dieser Abschnitt analysiert die schulische Situation und die Zusammensetzung der Klasse 7, in der die Lehrprobe stattfinden soll. Es werden die Lernvoraussetzungen der Schüler und die spezifischen Bedingungen des Schulkonzepts beleuchtet. Darüber hinaus wird die Einbettung der Lehrprobe in die Unterrichtseinheit „In die Fremde - Auswanderung im 18. und 19. Jahrhundert“ erläutert.
Didaktische Reflexion
In diesem Kapitel werden die didaktischen Aspekte der Lehrprobe beleuchtet. Es werden die relevanten Kompetenzen und Inhalte des Bildungsplans, die Sachanalyse und die zu erreichenden Kompetenzen und Standards erläutert. Des Weiteren wird das Stundenziel der Lehrprobe definiert.
Methodische Reflexion
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der methodischen Planung der Lehrprobe. Es werden verschiedene Methoden und ihre Begründung präsentiert, sowie eine Strukturskizze der Unterrichtsstunde vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Lehrprobe konzentriert sich auf die Analyse individueller Wanderungsgeschichten im 18. und 19. Jahrhundert und beleuchtet dabei vor allem politische, religiöse und wirtschaftliche Beweggründe für die Auswanderung. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind daher Auswanderung, Migrationsgeschichte, Biographien, Ursachen der Auswanderung, Lebensbedingungen der Auswanderer, historische Quellen, Unterrichtseinheit und Lehrprobe.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Zeitraum behandelt die Unterrichtseinheit zur Auswanderung?
Die Einheit konzentriert sich auf die Auswanderungsbewegungen im 18. und 19. Jahrhundert.
Wie wird das Thema Migration für Schüler eingeleitet?
Der Einstieg erfolgt über einen aktuellen Bezug: die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 und den Migrationshintergrund einiger Spieler der deutschen Nationalmannschaft.
Was sind die Hauptmotive für die Auswanderung in dieser Zeit?
Die Schüler erarbeiten politische, religiöse und wirtschaftliche Gründe, warum Menschen ihre Heimat verließen.
Welche Quellen werden im Unterricht verwendet?
Es werden biografische Erlebnisgeschichten und historische Quellen genutzt, um individuelle Wanderungsgeschichten nachzuvollziehen.
Für welche Klassenstufe ist dieser Entwurf konzipiert?
Der Unterrichtsentwurf ist für eine 7. Klasse im Fach Geschichte ausgelegt.
- Quote paper
- Holger Schröder (Author), 2010, Menschen verlassen ihre Heimat. Unterrichtseinheit zum Thema Auswanderung im 18. und 19. Jahrhundert Geschichte Klasse 7, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163643