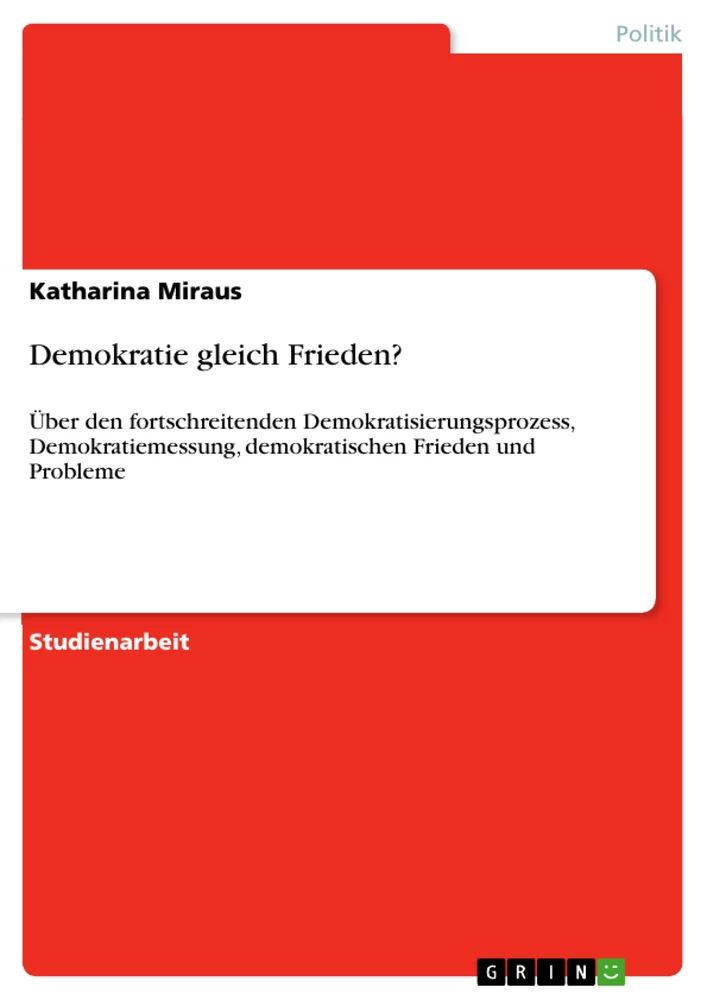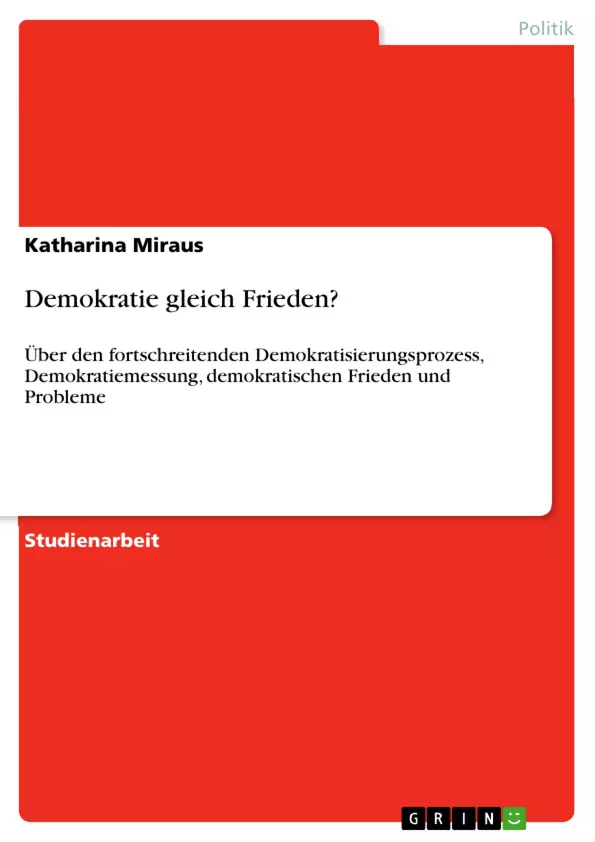Weltfrieden, sprich ein Leben ohne Krieg, das klingt reißerisch und ist zugleich auch sehnlichster Wunsch des Großteils der Menschen. Vollbringung dieser Wunschvorstellung durch Demokratie und die damit verbundene Demokratisierung? Demokratie („Volksherrschaft“) ist eine Herrschaftsform, die besondere Ansprüche stellt – an die Regierenden, aber ebenso an das Volk (Souverän). Was Demokratie ist und das Verständnis darüber, welchen Nutzen sie hat, hat sich im Laufe der Zeit vertieft und in ein anderes Licht gerückt. Von Demokratie darf gesprochen werden, wenn allgemeines und gleiches Wahlrecht, Meinungs-, Presse-, Rundfunk-, Vereins-, Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit, sowie Grundrechte jedes Einzelnen gegenüber dem Staat, -als Staat gilt „diejenige menschliche Gemeinschaft, welche innerhalb eines bestimmten Gebietes das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für sich (mit Erfolg) beansprucht“ (Weber 1956: 8)-, gegenüber gesellschaftlichen Gruppen (besonders Religionsgemeinschaften) und gegenüber anderen Einzelpersonen garantiert sind. Ferner noch sollte eine Gewaltenteilung im Sinne von John Locke und Montesqieu (Riklin 1989: 420ff ) vorherrschen, um der Machtkonzentration und der staatlichen Willkür entgegenzuwirken.
Der Glaube daran, die Herrschaftsform stehe in Relation zu Frieden, geht schon auf die frühen demokratietheoretischen Ansätze zurück, „neben anderen Rousseau und vor allem der Abbé de St. Pierre“ (Geis 2001: 282). Die Vereinigten Staaten von Amerika haben sich diese Denkweise in ihrem außenpolitischen Handeln besonders zu Herzen genommen, als Wegbereiter der Schaffung eines „weltweiten Demokratie-Monopols“, durch militärische Einsätze, Invasion und Intervention, um Nicht-Demokratien zu „befrieden“ (Kuntz 2007: 31-64).
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung:
- II. Kriegsursachen und Definitionsproblem Frieden
- 1Hinzu kommen intergesellschaftliche, globale Gründe:
- III. „Volksherrschaft“ - Frieden für alle?
- a) Hier wird die Meinung vertreten, dass Ethik und Tugend, Verantwortung und Verfassungsmäßigkeit den zentralen Begriff der Politik im klassischen (aristotelischen) Sinne darstellt.
- b) Diese Kategorisierung wird als ein nach Macht und Herrschaft strebender Politikbegriff verstanden, wobei Macht als „jedwede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“ (Weber 1956: 28) und Herrschaft als die „Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden“ (Weber 1956: 108) verstanden wird.
- IV. Demokratie messbar machen
- V. Idealtypus „Polyarchy\" als Grundlage für die Suche nach einem empirischen Demokratiebegriff
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Verhältnis von Demokratie und Frieden. Es wird untersucht, ob und inwiefern Demokratie zur Herstellung von Frieden beiträgt und welche Probleme bei der Messung von Demokratie bestehen.
- Der Wandel des Demokratiebegriffs im Laufe der Zeit
- Die Rolle von Demokratie im internationalen Staatensystem
- Der „demokratische Frieden“ als Hypothese
- Die Herausforderung der Demokratiemessung
- Die „Polyarchy“ als theoretisches Modell für die Analyse von Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung:
Die Einleitung stellt die These auf, dass Demokratie und Frieden eng miteinander verbunden sind. Dabei wird betont, dass Demokratie bestimmte Ansprüche an Regierende und Volk stellt und ein breites Verständnis von Grundrechten und Gewaltenteilung voraussetzt.
II. Kriegsursachen und Definitionsproblem Frieden:
In diesem Kapitel werden verschiedene Ursachen für Konflikte und Kriege aufgezeigt, sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Zudem wird zwischen einem negativen und positiven Friedensbegriff unterschieden, wobei ersterer die Abwesenheit von Krieg und letzterer die Präsenz sozialer Gerechtigkeit und Grundrechte umfasst.
III. „Volksherrschaft“ - Frieden für alle?:
Das Kapitel untersucht verschiedene Verständnisse von Demokratie und Politik. Dabei wird insbesondere auf die Unterscheidung zwischen „Politik I“ (klassisch) und „Politik II“ (modern) nach Wilhelm Hennis eingegangen, die unterschiedliche Ansichten über die Rolle des Staates und die Priorität von ethischen und politischen Zielen vertreten.
IV. Demokratie messbar machen:
Das Kapitel beschäftigt sich mit dem Problem der Demokratiemessung. Es wird betont, dass die Messung von Demokratie für die empirische Forschung von großer Bedeutung ist und methodologische Herausforderungen birgt.
V. Idealtypus „Polyarchy\" als Grundlage für die Suche nach einem empirischen Demokratiebegriff:
Dieses Kapitel stellt den Idealtypus „Polyarchie“ nach Robert Dahl vor. Die „Polyarchie“ umfasst verschiedene Kriterien, die zur Bestimmung des Grades an Demokratie in einem Land beitragen, wie beispielsweise allgemeines Wahlrecht, politische Partizipation, Freiheit der Meinungsäußerung und politische Konkurrenz.
Schlüsselwörter
Demokratie, Frieden, Demokratisierung, Kriegsursachen, Demokratiemessung, Polyarchie, „demokratischer Frieden“, Internationale Beziehungen, Politik I, Politik II, Wilhelm Hennis, Robert Dahl.
Häufig gestellte Fragen
Besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Demokratie und Frieden?
Die Arbeit untersucht die Hypothese des "demokratischen Friedens", wonach Demokratien seltener Kriege gegeneinander führen, beleuchtet aber auch die Komplexität dieses Verhältnisses.
Was versteht Robert Dahl unter "Polyarchy"?
Polyarchie ist ein empirischer Demokratiebegriff, der Kriterien wie allgemeines Wahlrecht, Meinungsfreiheit und politischen Wettbewerb nutzt, um den Grad der Demokratisierung messbar zu machen.
Was ist der Unterschied zwischen positivem und negativem Frieden?
Negativer Frieden bezeichnet lediglich die Abwesenheit von Krieg, während positiver Frieden auch soziale Gerechtigkeit und die Garantie von Grundrechten umfasst.
Warum ist die Messung von Demokratie eine Herausforderung?
Es bestehen methodologische Schwierigkeiten, da Demokratie ein vielschichtiger Begriff ist und verschiedene Indikatoren (wie Partizipation und Wettbewerb) unterschiedlich gewichtet werden können.
Wie beeinflusst das Demokratie-Verständnis die Außenpolitik?
Der Text erwähnt, dass Staaten (wie die USA) Demokratisierung oft als Ziel ihrer Außenpolitik verfolgen, teils auch durch militärische Interventionen zur "Befriedung".
- Arbeit zitieren
- Katharina Miraus (Autor:in), 2007, Demokratie gleich Frieden?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163661