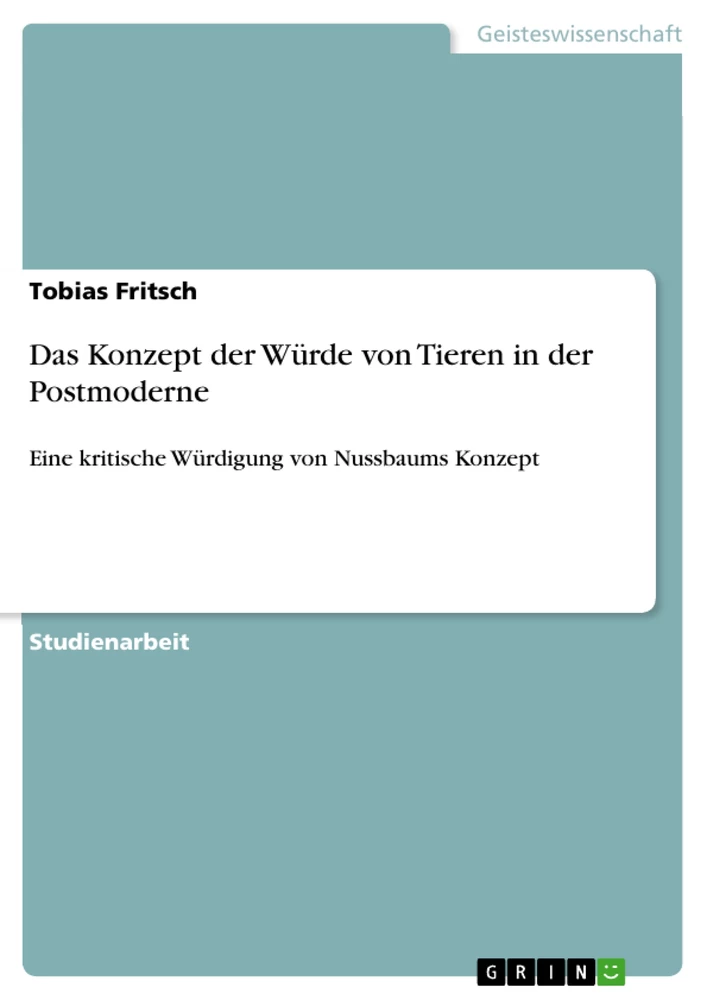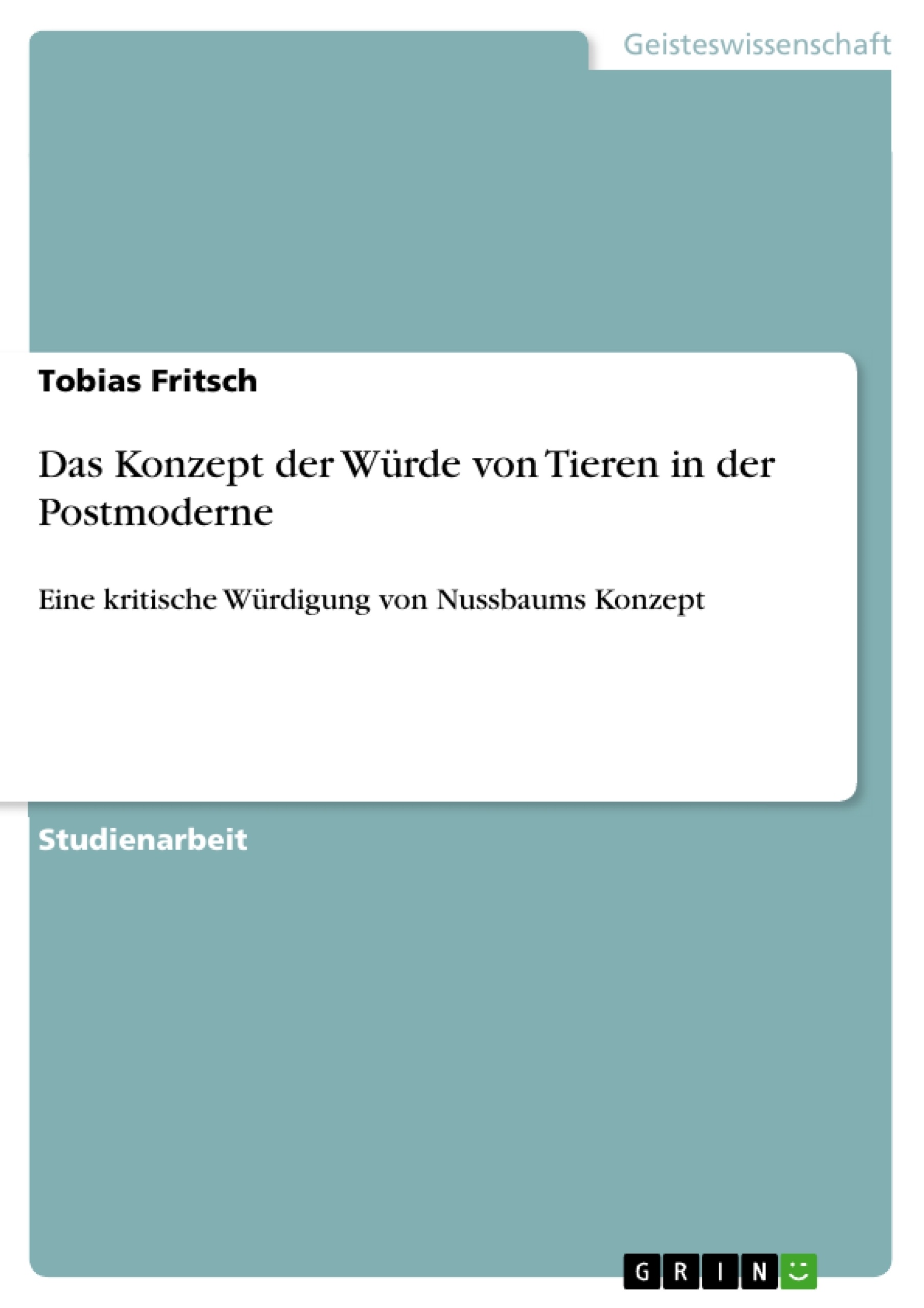Die Hausarbeit beschreibt das von Nussbaum ausgeführte Konzept der Würde und dessen Ausweitung bezogen auf Tiere. Dabei werden zunächst wichtige Begriffe in diesem Kontext definiert – z.B. die Menschenwürde, der Stoizismus und der Präferenzutilitarismus.
Innerhalb dieser Erweitung auf die Tierwelt, wird der bei Nussbaum vorgeschlagene Würdebegriff zunächst gegenüber anderen Konzeptionen von Würde abgegrenzt. Darauf aufbauend beschäftigt sich die Fragestellung primär mit den Fähigkeiten (engl. capabilities) von Tieren. Da Nussbaum die Definition von Würde über das Konzept der Fähigkeiten herleitet, gilt es dabei zu hinterfragen, ob eine Erklärung durch Fähigkeiten alleine hinreichend ist, um trennscharf zu argumentieren.
So beschreibt die Arbeit entlang der Leitfrage der Trennschärfe den Vergleich der kognitiven Fähigkeiten. Dabei wird unter anderem der Vergleich zwischen hochentwickelte Primaten aus dem Tierreich und geistig behinderten Menschen aufgebaut. Dieses Beispiel dient als Indikator für die Schwierigkeit in der Differenzierung solcher Randbereiche durch Nussbaums Würdekonzeption. Ab welchem Niveau von Fähigkeiten kann von Menschenwürde gesprochen werden und wie stark muss eine solche Konzeption auf Spezieszuordnungen zurückgreifen, um weiterhin konsistent zu bleiben?
Innerhalb des kritischen Diskurses wird die Würdekonzeption anhand dieses Beispiels gegenüber dem Präferenzutilitarismus, sowie dem Stoizismus unter dem Aspekt der Vagness und dem damit verbundenen Sorites-Paradoxon abgewogen. Die unterschiedlichen konzeptionellen Herangehensweisen werden dabei kritisch verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Abstrakt
- 1.2. Problemstellung
- 1.3. Aufbau der Hausarbeit
- 2. Hintergrund
- 2.1. Menschenwürde
- 2.2. Erweiterbarkeit des Würdebegriffs auf die Tierwelt
- 2.3. Vagness von Begriffen und das Sorites-Paradoxon
- 3. Konzepte der Menschenwürde
- 3.1. Stoizismus
- 3.2. Präferenzutilitarismus
- 3.3. Nussbaums Konzept
- 4. Kritischer Diskurs
- 5. Zusammenfassung
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert das von Nussbaum entwickelte Konzept der Würde und untersucht seine Anwendbarkeit auf Tiere. Zunächst werden grundlegende Begriffe wie die Menschenwürde, Stoizismus und Präferenzutilitarismus definiert. Die Arbeit konzentriert sich anschließend auf die von Nussbaum vorgeschlagene Erweiterung des Würdebegriffs auf die Tierwelt und analysiert seine Limitationen.
- Die Erweiterbarkeit des Würdebegriffs von der Menschenwürde auf Tiere
- Das Konzept der Fähigkeiten (Capabilities) in der Definition von Würde
- Die Vergleichbarkeit von Tieren und geistig behinderten Menschen
- Der Vergleich mit anderen Würdekandidaten wie Stoizismus und Präferenzutilitarismus
- Das Sorites-Paradoxon und die Vagness des Würdebegriffs
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 legt den Fokus auf die Entwicklung des Würdebegriffs in der Philosophie, insbesondere im Hinblick auf die Abgrenzung zur Tierwelt. Es thematisiert die aktuelle Definition der Menschenwürde im Grundgesetz der BRD und setzt sie in Relation zu historischen Konzepten der Würde, wobei die Ambivalenz des Begriffs und die damit verbundenen Unschärfen im Vordergrund stehen.
Kapitel 3 beleuchtet verschiedene Modelle der Menschenwürde, darunter den stoischen Ansatz, den präferenzutilitaristischen Ansatz und das Konzept der Erweiterbarkeit von Nussbaum. Dabei wird insbesondere der Fokus auf die Anwendung des Würdebegriffs auf Tiere gelegt.
Kapitel 4 setzt sich mit der Frage auseinander, ob Tieren Würde zukommen kann und wie sich dies auf den Grenzfall des Vergleichs zwischen Tieren und geistig behinderten Personen auswirken könnte. Der Vergleich der drei verschiedenen Theorien aus Kapitel 3 ermöglicht eine kritische Analyse der Anwendbarkeit des Würdebegriffs auf den Bereich der Tiere und die damit verbundenen ethischen Fragen.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit fokussiert auf die Konzepte der Würde und deren Anwendbarkeit auf Tiere, wobei Nussbaums "capabilities" eine zentrale Rolle spielen. Sie untersucht die Herausforderungen der Begriffsabgrenzung und die Grenzen der konzeptionellen Erweiterbarkeit auf das Tierreich. Weitere zentrale Aspekte sind der Vergleich mit dem Stoizismus und dem Präferenzutilitarismus, die Frage nach der Vagness des Würdebegriffs sowie das Sorites-Paradoxon.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Würde von Tieren“ nach Martha Nussbaum?
Nussbaum leitet Würde aus dem Konzept der Fähigkeiten (Capabilities) her: Jedes Lebewesen hat eine Würde, wenn es über bestimmte Potenziale verfügt, die geschützt werden müssen.
Wie unterscheidet sich Nussbaums Ansatz vom Präferenzutilitarismus?
Während der Utilitarismus auf Leidvermeidung und Lustmaximierung setzt, betont Nussbaum den inhärenten Wert der Entfaltung natürlicher Fähigkeiten.
Kann man Tieren die gleiche Würde wie Menschen zusprechen?
Dies ist umstritten. Die Arbeit untersucht Grenzfälle, wie den Vergleich zwischen Primaten und geistig behinderten Menschen, um die Trennschärfe von Würdekonzepten zu prüfen.
Was ist das Sorites-Paradoxon im Kontext der Tierethik?
Es beschreibt das Problem der Unschärfe: Ab wann genau (welchem Niveau an Fähigkeiten) spricht man von Würde? Es gibt keinen exakten Punkt, an dem Würde plötzlich entsteht.
Welche Rolle spielen kognitive Fähigkeiten für den Würdebegriff?
Oft wird Würde an Vernunft gekoppelt. Nussbaum erweitert dies jedoch auf biologische Grundfunktionen und soziale Interaktionsfähigkeiten.
Ist Nussbaums Konzept konsistent?
Kritiker bemängeln die Vagheit des Fähigkeiten-Begriffs und die Schwierigkeit, ohne Rückgriff auf die Spezieszugehörigkeit klare ethische Grenzen zu ziehen.
- Quote paper
- Dr. Tobias Fritsch (Author), 2010, Das Konzept der Würde von Tieren in der Postmoderne, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163756