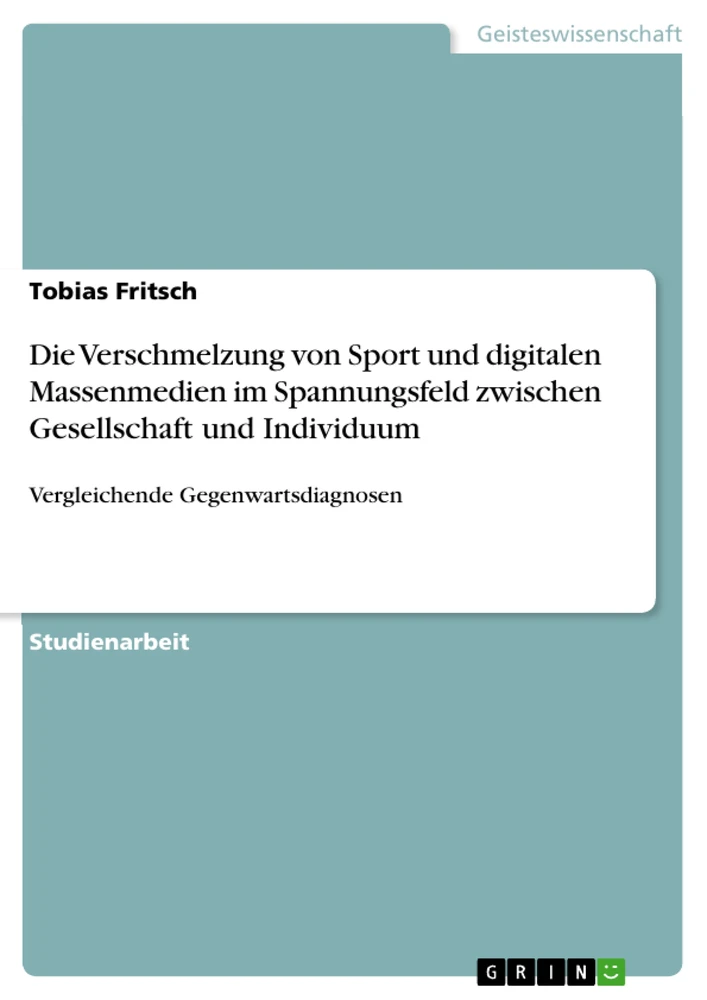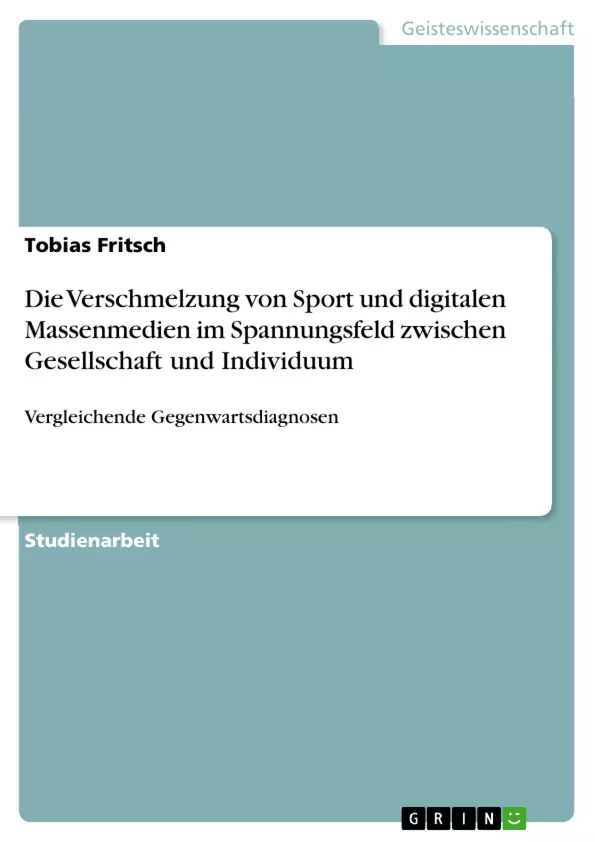In dieser Hausarbeit werden zwei exemplarische Gegenwartsdiagnosen bezüglich des gesellschaftlichen Teilsystems der Massenmedien miteinander verglichen. Im Zuge dieses Vergleichs werden zunächst die aktuellen Gegenwartsdiagnosen anhand von Primärliteratur zusammengefasst und die Kernaussagen extrahiert. Hierbei liegt der Betrachtungsfokus primär auf der Vorstellung von Hintergrundinformationen zu digitalen Massenmedien (also Computer, Internet und digitales Fernsehen).
Diese Hintergrundinformationen dienen als Themeneinstieg für die beiden betrachteten Gegenwartsdiagnosen. Zunächst werden die Inhalte und zum besseren Verständnis der Kernaussagen in separaten Kapiteln extrahiert. Anschließend folgt ein kritischer Vergleich in Bezug auf die Gültigkeit dieser Hauptaussagen sowohl für die Gesellschaft als auch für das Individuum. Diese beiden Gesichtspunkte (Individuum und Gesellschaft) bilden die Eckpunkte für die thematische Betrachtung innerhalb der Hausarbeit, in dem sie teils gleichermaßen teils unterschiedlich auf zeitgemäße Veränderungen reagieren.
Als konkretisierendes Beispiel wird zusätzlich ein aktueller Trend in die kritische Evaluation eingebunden – die Digitalisierung des Sports.
Die steigende Anzahl von E-Sport-Veranstaltungen und die Auswirkungen auf den real ausgeführten Sport werden dabei ebenso wie Beobachtungen aus anderen Massenmedien herangezogen. Innerhalb einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem Thema wird dabei evaluiert, inwiefern dieses Referenzbeispiel Abstraktionspunkte bietet, die gegebenenfalls verallgemeinert werden können. Außerdem wird überprüft, wie graduell es erscheint und ob das Beispiel konträr zu den Kernaussagen beider Gegenwartsdiagnosen steht.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Abstrakt
1.2. Problemstellung
1.3. Aufbau der Hausarbeit
2. Hintergrund
2.1. Gegenwartsdiagnosen
2.2. Gesellschaft und Individuum
2.3. Elektronischer Sport
3. Richard Münch: Kommunikationsgesellschaft und Massenmedien
3.1. Annahmen
3.2. Kernthesen
4. Jean Baudrillard: Die Illusion des Endes
4.1. Annahmen
4.2. Kernthesen
5. Kritischer Diskurs
5.1. Vergleich bestehender Kritik der Gegenwartsdiagnosen
5.1.1. Auswirkungen auf die Gesellschaft
5.1.2. Auswirkungen auf das Individuum
5.2. Schwerpunkt: Digitalisierung des Sports
6. Zusammenfassung
7. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen digitale Massenmedien den modernen Sport?
Digitale Medien führen zu einer Verschmelzung von Sportkonsum und interaktiven Inhalten, was sich besonders im Aufstieg des E-Sports zeigt.
Welche Thesen vertritt Richard Münch zur Kommunikationsgesellschaft?
Münch analysiert, wie Massenmedien als Teilsystem der Gesellschaft die öffentliche Kommunikation und soziale Strukturen prägen.
Was bedeutet Jean Baudrillards „Illusion des Endes“?
Baudrillard kritisiert die Hyperrealität der Medien, in der Bilder und Simulationen die reale Erfahrung ersetzen und eine Illusion der Geschichte erzeugen.
Inwiefern verändert E-Sport den real ausgeführten Sport?
Die Arbeit evaluiert, ob die Digitalisierung des Sports zu neuen Verhaltensmustern beim Individuum führt und wie sich die Wahrnehmung von sportlicher Leistung wandelt.
Was ist der Fokus des kritischen Diskurses in dieser Arbeit?
Der Vergleich der Auswirkungen medialer Veränderungen auf das Individuum im Gegensatz zu den Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft.
- Quote paper
- Dr. Tobias Fritsch (Author), 2010, Die Verschmelzung von Sport und digitalen Massenmedien im Spannungsfeld zwischen Gesellschaft und Individuum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163763