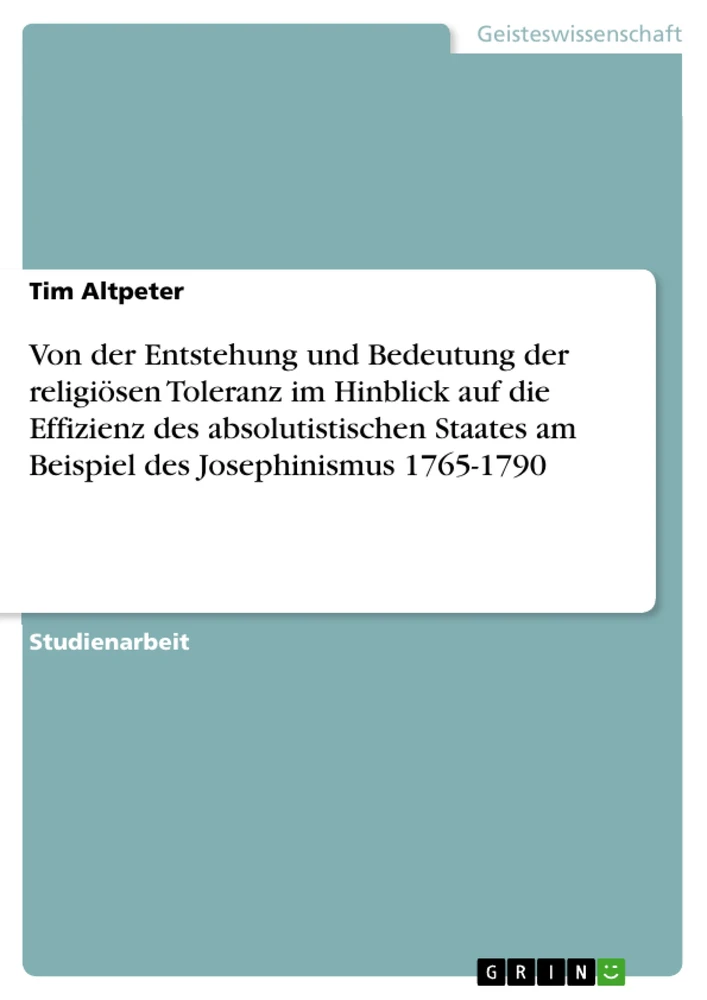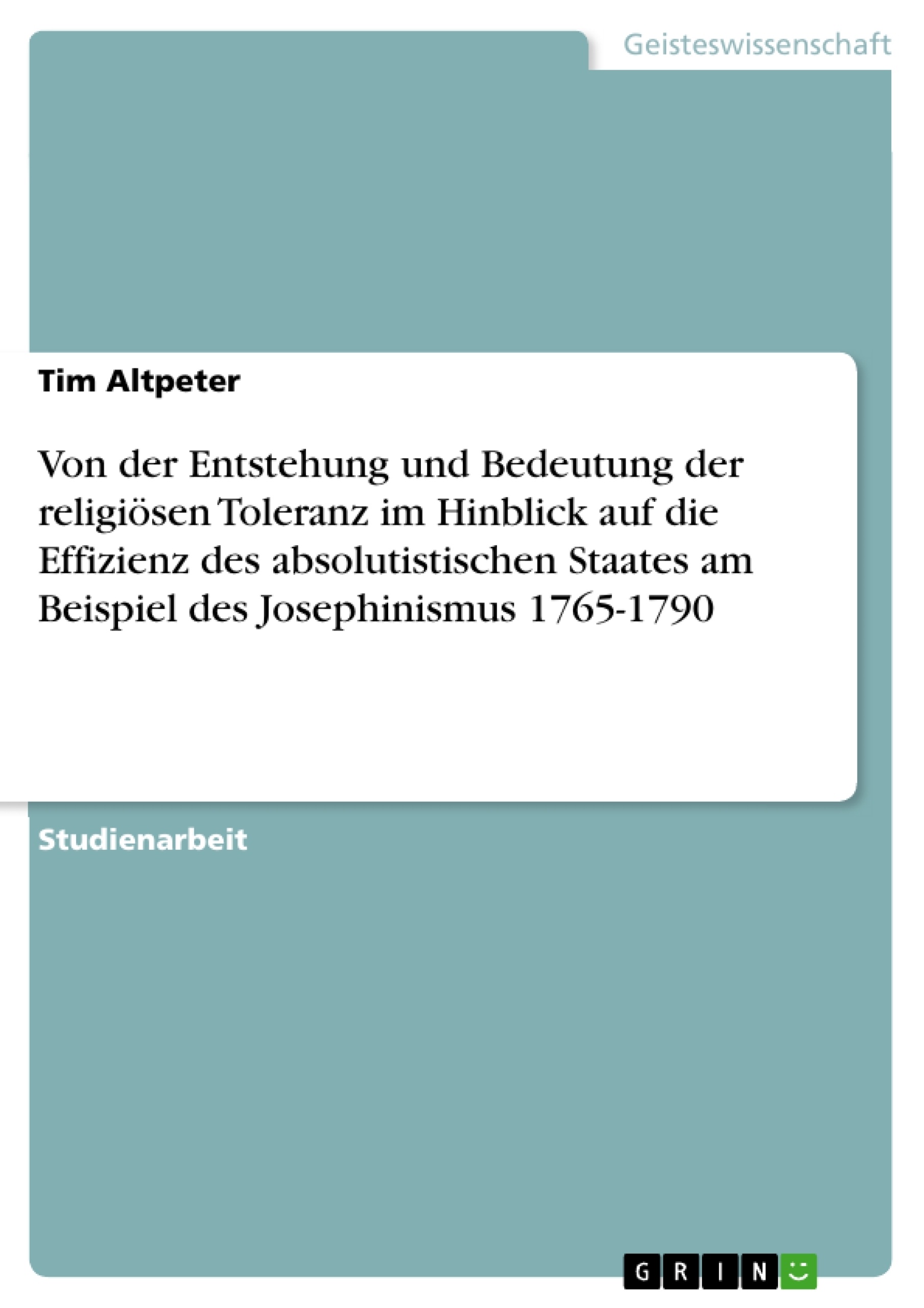Heute wird das 18. Jahrhundert in der Forschung meistens, wenn nicht als das „Jahrhundert der Toleranz“, so als Zeitalter in dem die Forderung nach Toleranz eine primäre Rolle spielte, definiert. Gerade in den bi- oder mehrkonfessionellen Staaten, wie Österreich musste die Forderung nach religiöser Toleranz eine entscheidende Rolle für das Staatsverständnis und Überleben der Dynastie spielen. Denn der Westfälische Friede von 1648 und die damit verbundene gegenseitige Anerkennung von katholischem-tridentinischen und reformierten Glauben, brachte für die Kronländer des Hauses Habsburg keine religiöse Entspannung. In den habsburgischen Erblanden existierten weiterhin, starke religiöse Minderheiten, die im gesellschaftlichen Leben stark benachteiligt waren, wie den Juden in Österreich, den Lutheranern und Kalvinisten in Böhmen und Ungarn, sowie den orthodoxen Christen in Siebenbürgen und im Banat. Der Vielvölkerstaat war Mitte des 18. Jahrhunderts ein durch die katholische Barockfrömmigkeit im aufklärerisch-innovativen Sinne erstarrtes Gebilde, das zugleich, durch die schlechte außen- und innenpolitische Lage mit starken politischen und religiösen Zerreißkräften konfrontiert wurde. Denn zusammengehalten wurde dieses Riesenreich allein durch die Personalunion der habsburgischen Dynastie, die über Jahrhunderte hinweg den Schutz des Katholizismus zu ihrem politischen Programm machte, und der wirtschaftlichen Pulsader des Landes: die Donau. Der gegenreformatorisch-tridentinische Katholizismus mit seinen machtvollen Institutionen wie dem Jesuitenorden war der wesentliche Garant zur Gewährleistung der gesellschaftlichen Wohlfahrt, Sittenlehre und Bildung. Doch zugleich waren die ausgedehnten Besitzungen der Kirchenorden, der Hochstifte und Bruderschaften, ein wirtschaftlicher und politischer Hemmfaktor, für den im 17. und 18. Jahrhundert, in Europa zunehmenden Staatsbildungsprozess und der damit einhergehenden Säkularisierung und Effizienzsteigerung. Es ist also nicht von der Hand zu weisen, dass es für das Haus Habsburg überlebenswichtig war, die religiösen und damit politischen Probleme durch eine neuartige Toleranzpolitik zu lösen.
In dieser Arbeit wird zu zeigen sein, wodurch in Österreich zwischen 1765 und 1790 eine, in dieser Form und Radikalität noch nie dagewesene, Toleranzpolitik nötig und möglich wurde und was ihre primären Ziele sein sollte.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Strukturelle Erfordernisse der Toleranzpolitik
- 1.1. Österreichs außenpolitische Situation
- 1.2. Österreichs innenpolitische Situation
- 2. Kaiser Josephs II. persönliche Beweggründe für die Toleranzpolitik
- 2.1. Ausbildung, Lehrer, Einflüsse
- 2.2. Josephs Staatsziele im Verhältnis zu Kirche und Toleranz
- 3. Das Toleranzpatent von 1781
- 1. Strukturelle Erfordernisse der Toleranzpolitik
- III. Schluss
- Fazit
- IV. Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Bedeutung der religiösen Toleranz im Kontext des österreichischen Absolutismus unter Kaiser Joseph II. Im Mittelpunkt steht die Frage, warum diese Toleranzpolitik erst im 18. Jahrhundert ihren Durchbruch erlebte, während andere europäische Staaten wie Preußen und die Niederlande bereits früher eine tolerante Politik betrieben.
- Die strukturellen Bedingungen, die die Effizienzsteigerung durch religiöse Toleranz im Habsburgerreich erforderlich machten.
- Die persönlichen Beweggründe Kaiser Josephs II. für seine Toleranzpolitik, einschließlich seiner Ausbildung, intellektuellen Einflüsse und zeitgenössischen Staatsziele.
- Die Bedeutung des Toleranzpatents von 1781 als Beispiel dafür, wie religiöse Toleranz die staatliche Effizienz verändern konnte.
- Die Rolle der religiösen Minderheiten, insbesondere der Juden, Lutheraner, Kalvinisten und orthodoxen Christen, in der Habsburger Monarchie.
- Der Vergleich des österreichischen Staatsmodells mit anderen europäischen Ländern, insbesondere Preußen, im Hinblick auf Toleranz und Effizienz.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Entstehung und Bedeutung der Toleranzpolitik im österreichischen Absolutismus dar. Sie analysiert den historischen Kontext, insbesondere die religiösen und politischen Spannungen im Habsburgerreich und die Rolle der katholischen Barockfrömmigkeit.
Der Hauptteil untersucht die strukturellen und persönlichen Gründe für die Toleranzpolitik Josephs II. Kapitel 1 beleuchtet die außenpolitische Situation Österreichs im 18. Jahrhundert, insbesondere den Vergleich mit dem aufstrebenden Preußen, und die Notwendigkeit der Steigerung der Staatseffizienz durch Toleranz. Kapitel 2 befasst sich mit Josephs II. persönlichen Beweggründen, seinen intellektuellen Einflüssen und seinen Staatszielen im Verhältnis zu Kirche und Toleranz. Kapitel 3 analysiert das Toleranzpatent von 1781 als Beispiel dafür, wie religiöse Toleranz konkrete Auswirkungen auf die Staatseffizienz haben konnte.
Schlüsselwörter
Religiöse Toleranz, Josephinismus, Absolutismus, Staatseffizienz, Österreich, Habsburger, Toleranzpatent, Preußen, katholische Barockfrömmigkeit, Minderheiten, Juden, Lutheraner, Kalvinisten, Orthodoxe Christen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff „Josephinismus“?
Es bezeichnet die Reformpolitik Kaiser Josephs II. im 18. Jahrhundert, die auf eine Stärkung des Staates gegenüber der Kirche und eine Modernisierung der Verwaltung abzielte.
Warum führte Joseph II. das Toleranzpatent von 1781 ein?
Das Ziel war die Steigerung der staatlichen Effizienz. Durch religiöse Toleranz sollten Minderheiten wie Protestanten und Juden besser in die Gesellschaft integriert und wirtschaftlich nutzbar gemacht werden.
Welche religiösen Minderheiten profitierten von der Toleranzpolitik?
Vor allem Lutheraner, Kalvinisten, orthodoxe Christen und Juden erhielten durch die Patente verbesserte Rechte und Möglichkeiten zur Religionsausübung.
Wie unterschied sich Österreich von Preußen in Bezug auf Toleranz?
Während Preußen bereits früher aus pragmatischen Gründen tolerant war, musste Österreich die starre katholische Barockfrömmigkeit erst durch radikale Reformen aufbrechen.
War die Toleranzpolitik Josephs II. rein religiös motiviert?
Nein, sie war primär machtpolitisch und ökonomisch motiviert, um die „Zerreißkräfte“ im Vielvölkerstaat zu bändigen und die Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Mächten zu sichern.
- Quote paper
- Tim Altpeter (Author), 2009, Von der Entstehung und Bedeutung der religiösen Toleranz im Hinblick auf die Effizienz des absolutistischen Staates am Beispiel des Josephinismus 1765-1790, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163793