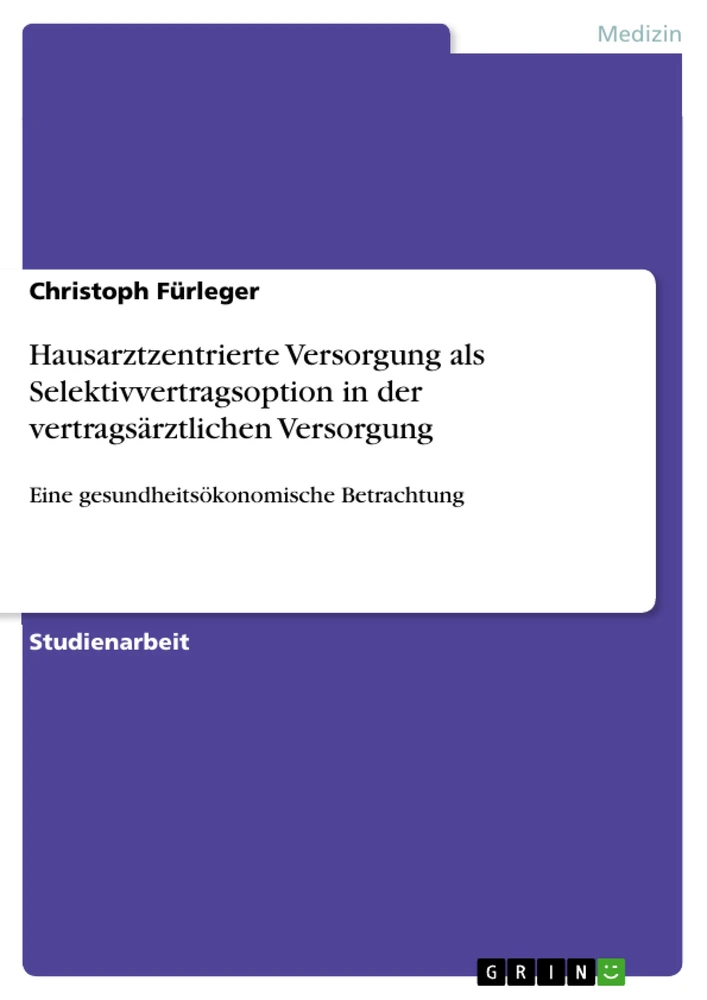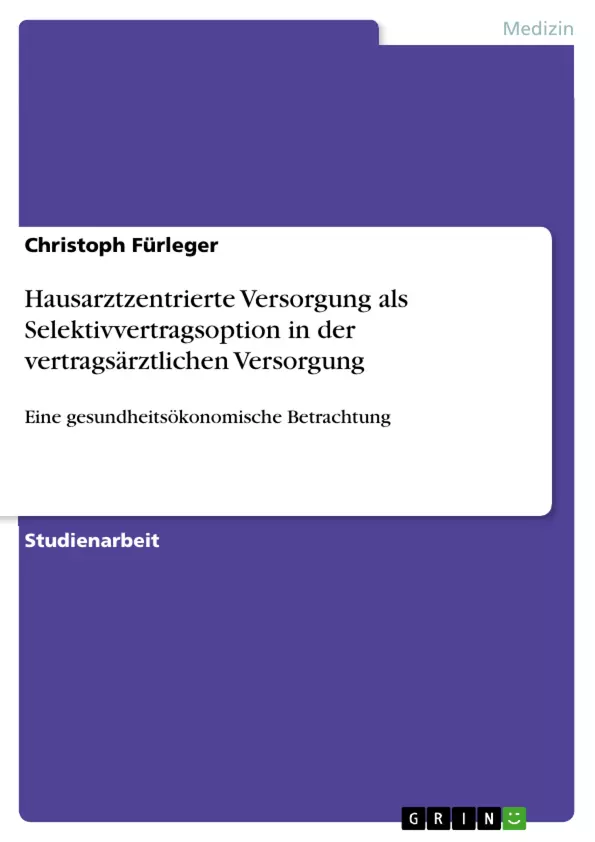Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Implementierung eines Gatekeepingmodells im deutschenGesundheitswesen. Dazu werden zunächst im Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen und Ausgestaltungsoptionen des Versorgungmodellsnäher dargestellt. Im Kapitel 3 wird ein umfassender Überblick über die empirischen Untersuchungen zu den verschiedenen Ergebnisparametern gegeben, die mit der hausarztzentrierten Versorgung einhergehen.Im Kapitel 4 werden die möglichen Effekte der der derzeitigen Ausgestaltung der hausarztzentrierten Versorgung in Deutschland eruiert und diskutiert.Daran schließt eine Bewertung der aktuellen Gesetzeslage und der damit verbundenen Konsequenzen für die Krankenkassen an. Ein Ausblick beendet die Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Managed Care Programme
- Das Modell der hausarztzentrierten Versorgung
- Ziele der hausarztzentrierten Versorgung
- Empirische Untersuchungen
- Ergebnisparameter der hausärztlichen Versorgung
- Empirische Ergebnisse
- Klinische Qualität der Behandlung
- Patientenzufriedenheit
- Prozessqualität/Koordinierung
- Ärztliche Kontaktzahlen und Kontinuität der Behandlung
- Arzneimittelverordnungen
- Doppeluntersuchungen
- Ökonomische Bewertung
- Gesamtbewertung
- Hausarztzentrierte Versorgung in Deutschland
- Einführung der hausarztzentrierten Versorgung
- Der Status quo der hausarztzentrierten Versorgung in Deutschland
- Bewertung der hausarztzentrierten Versorgung in Deutschland
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die hausarztzentrierte Versorgung als Selektivvertragsoption im deutschen Gesundheitssystem aus gesundheitsökonomischer Sicht. Sie analysiert die Modellkonzepte, die empirischen Befunde und die aktuelle Situation der hausarztzentrierten Versorgung in Deutschland.
- Modellkonzepte der hausarztzentrierten Versorgung
- Empirische Untersuchungen zur Effektivität und Effizienz der hausarztzentrierten Versorgung
- Gesundheitsökonomische Bewertung der hausarztzentrierten Versorgung
- Entwicklung und Status quo der hausarztzentrierten Versorgung in Deutschland
- Ausblick auf die Zukunft der hausarztzentrierten Versorgung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der hausarztzentrierten Versorgung ein und erläutert die Relevanz der gesundheitsökonomischen Betrachtung.
- Managed Care Programme: Dieses Kapitel präsentiert das Modell der hausarztzentrierten Versorgung, beschreibt seine Ziele und erläutert die theoretischen Grundlagen.
- Empirische Untersuchungen: Hier werden empirische Studien zur hausarztzentrierten Versorgung vorgestellt, wobei die Ergebnisse hinsichtlich klinischer Qualität, Patientenzufriedenheit, Prozessqualität, ärztlichen Kontaktzahlen, Arzneimittelverordnungen, Doppeluntersuchungen und ökonomischer Bewertung analysiert werden.
- Hausarztzentrierte Versorgung in Deutschland: Dieses Kapitel untersucht die Einführung und den aktuellen Stand der hausarztzentrierten Versorgung in Deutschland, einschließlich der Bewertung ihrer Rolle im deutschen Gesundheitssystem.
Schlüsselwörter
Hausarztzentrierte Versorgung, Selektivvertrag, Managed Care, Gesundheitsökonomie, Empirische Studien, Effektivität, Effizienz, Patientenzufriedenheit, Qualität, Kosten, Deutschland, Gesundheitssystem.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der hausarztzentrierten Versorgung (HZV)?
Das Ziel ist eine bessere Koordinierung der Behandlung durch den Hausarzt als „Gatekeeper“, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden und die Behandlungsqualität zu steigern.
Was bedeutet „Gatekeeping“ im Gesundheitssystem?
Gatekeeping bedeutet, dass der Patient zuerst den Hausarzt aufsucht, der dann entscheidet, ob eine Überweisung zum Facharzt medizinisch notwendig ist.
Welche empirischen Ergebnisse liefert die Arbeit zur Patientenzufriedenheit?
Die Arbeit gibt einen Überblick über Studien, die untersuchen, wie sich Gatekeeping-Modelle auf die Zufriedenheit der Patienten auswirken.
Wie wirkt sich die HZV auf Arzneimittelverordnungen aus?
Durch die zentrale Koordinierung beim Hausarzt können Medikationspläne besser überwacht und unnötige oder riskante Verordnungen reduziert werden.
Was ist die aktuelle Gesetzeslage in Deutschland zur HZV?
Die Arbeit bewertet die aktuelle Gesetzeslage zu Selektivverträgen und die damit verbundenen Konsequenzen für Krankenkassen und die vertragsärztliche Versorgung.
- Quote paper
- Christoph Fürleger (Author), 2010, Hausarztzentrierte Versorgung als Selektivvertragsoption in der vertragsärztlichen Versorgung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163801