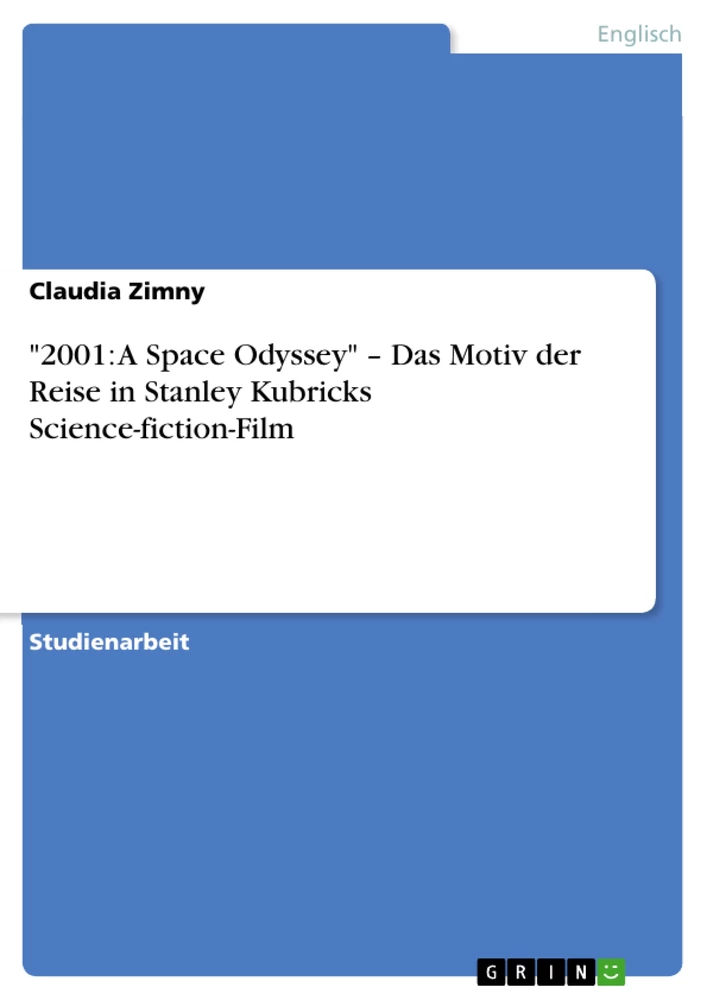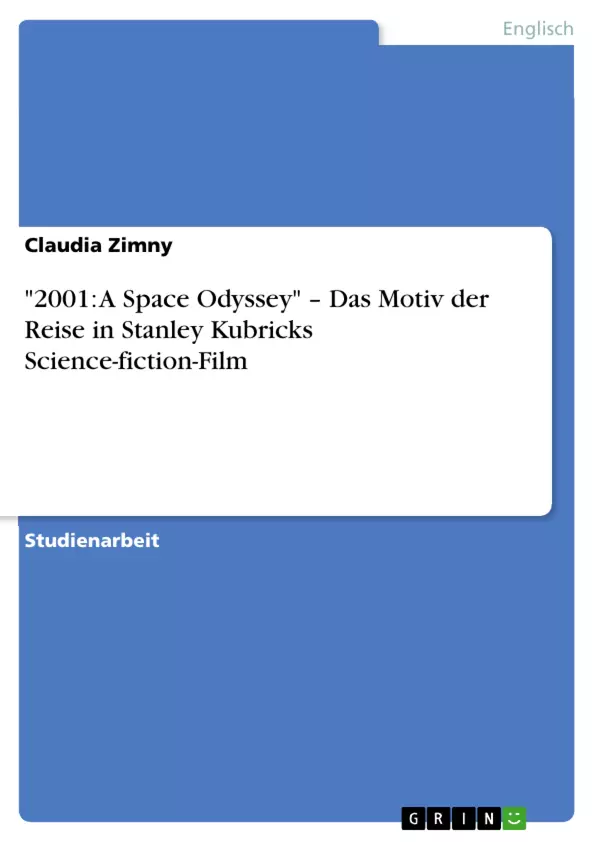Jeder hat schon einmal in irgendeiner Form eine Reise angetreten, sei es eine Erholungsreise, eine Abenteuerreise, eine Pilgerreise oder eine Bildungsreise. Die wachsende Tourismusbranche zeigt, dass die Zahl der Reisenden (oft zu immer exotischeren Zielen) Jahr für Jahr zunimmt. Warum birgt die Vorstellung, für eine gewisse Zeit aus dem gewohnten Umfeld auszubrechen, eine Faszination, der man sich nur schwer entziehen kann?
Der amerikanische Regisseur Stanley Kubrick griff 1968 *das* klassische Motiv der Reise, die Odyssee, wieder auf und setze es mit seinem Science fiction Film "2001: A Space Odyssey" in den modernen Kontext der Weltraumfahrt. In der vorliegenden Arbeit soll an Hand von "2001" die Darstellung der "Reise" als Symbol für den Lebens- oder Entwicklungsweg des Menschen analysiert werden. Das Ziel der Arbeit ist, die bleibende Faszination am Thema der Reise (und zu reisen) zu ergründen, die eng verbunden ist mit dem Phänomen, dass Kubricks Science fiction Film auch nach fast 30 Jahren nichts von seiner Aussagekraft eingebüßt hat.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- I. EINLEITUNG: DAS ZIEL DIESER ARBEIT
- II. INHALTSANGABE
- .1
- ..2
- ..3
- ..3
- III. VORBEMERKUNGEN ZUR ANALYSE
- IV. ANALYSE DES FILMS 2001
- V. ZUSAMMENFASSUNG - EIN FILM OHNE BOTSCHAFT?
- VI. SCHLUSSBETRACHTUNGEN - 2001 ALS ZEITLOSER KOMMENTAR ZUR,,PHANTASTISCHEN REISE\" DES LEBENS.
- VII. ANHANG
- VIII. QUELLEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Stanley Kubricks Film „2001: A Space Odyssey“ im Hinblick auf die Darstellung der Reise als Metapher für den Lebensweg des Menschen. Sie untersucht, wie Kubrick das antike Motiv der Odyssee in den modernen Kontext der Weltraumfahrt setzt und so die bleibende Faszination des Themas der Reise und die Aussagekraft des Films auch nach Jahrzehnten beleuchtet.
- Die Reise als Symbol für den Lebensweg des Menschen
- Die Darstellung der Transformation und Entwicklung
- Die Rolle des Monolithen als Katalysator der Evolution
- Die Begegnung mit dem Unbekannten und der Suche nach Erkenntnis
- Der Einfluss von Technologie und Fortschritt auf die menschliche Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Zielsetzung der Arbeit und die Relevanz des Themas Reise im Kontext des Films „2001: A Space Odyssey“ herausstellt. In der Inhaltsangabe werden die wichtigsten Handlungspunkte des Films zusammengefasst, beginnend mit der Darstellung der Frühzeit der Menschheit und der Begegnung mit dem Monolithen, über die Entdeckung auf dem Mond bis hin zur Reise zum Jupiter. In Kapitel III werden Vormerkungen zur Analyse gemacht, bevor in Kapitel IV eine detaillierte Analyse des Films erfolgt, wobei die Darstellung der Reise als Lebensweg im Vordergrund steht. Die Zusammenfassung in Kapitel V befasst sich mit der Frage, ob der Film eine Botschaft vermittelt, während die Schlussbetrachtungen in Kapitel VI den Film als zeitlosen Kommentar zur „phantastischen Reise“ des Lebens interpretieren.
Schlüsselwörter
2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick, Reise, Lebensweg, Entwicklung, Odyssee, Monolith, Weltraumfahrt, Technologie, Fortschritt, Transformation, Erkenntnis, Zukunft.
Häufig gestellte Fragen
Welche zentrale Metapher untersucht die Arbeit in Kubricks Film?
Die Arbeit analysiert die "Reise" als Symbol für den Lebens- und Entwicklungsweg des Menschen sowie für die Evolution der Menschheit.
Was bedeutet der Titel „2001: A Space Odyssey“?
Der Titel greift das klassische Motiv der Odyssee auf und setzt es in den modernen Kontext der Weltraumfahrt und der menschlichen Zukunft.
Welche Rolle spielt der Monolith im Film?
Der Monolith fungiert als Katalysator der Evolution, der in entscheidenden Momenten der Menschheitsgeschichte Transformation und Fortschritt auslöst.
Warum fasziniert der Film auch nach Jahrzehnten noch?
Die Faszination liegt in der zeitlosen Aussagekraft über die Suche des Menschen nach Erkenntnis und der Begegnung mit dem Unbekannten.
Wie wird die technische Entwicklung im Film dargestellt?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Technologie und Fortschritt auf die menschliche Entwicklung und deren ambivalente Rolle im Lebensweg.
- Quote paper
- Claudia Zimny (Author), 1996, "2001: A Space Odyssey" – Das Motiv der Reise in Stanley Kubricks Science-fiction-Film, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163816