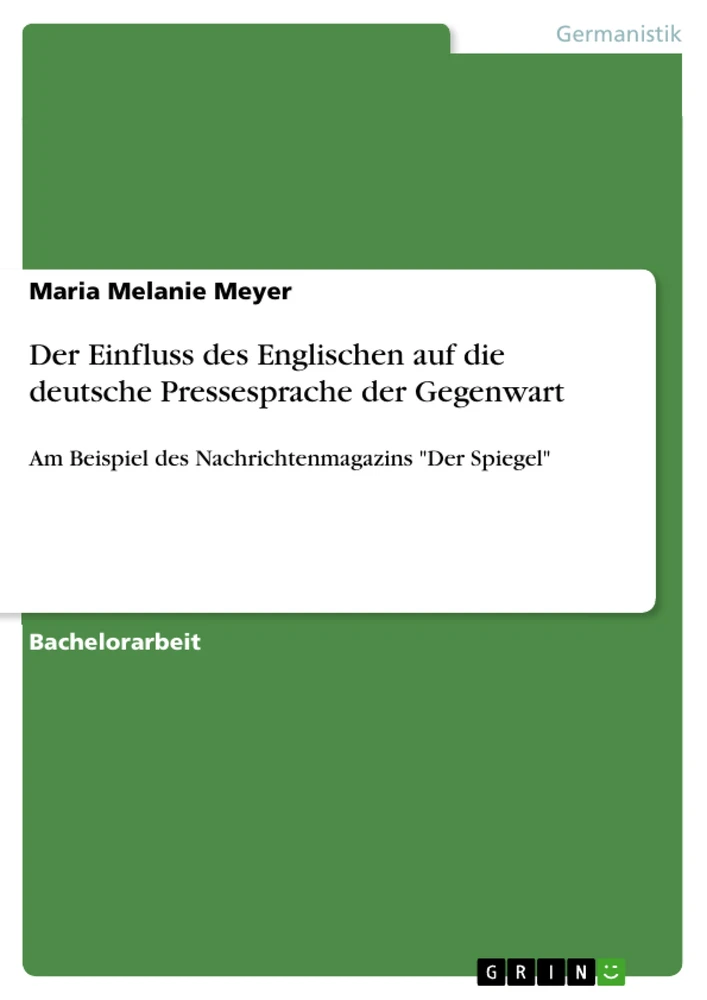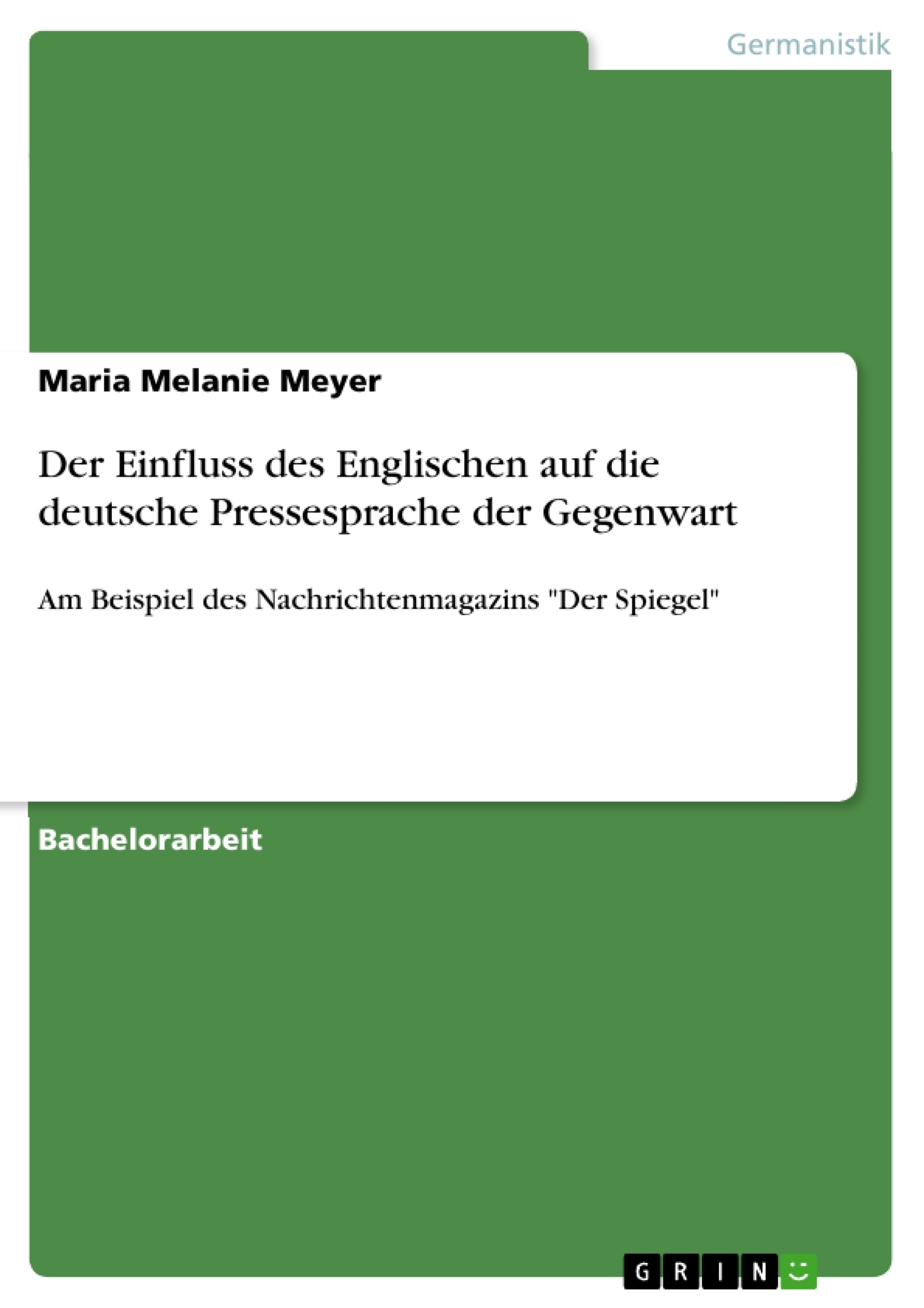„Rettet dem Deutsch! Die Verlotterung der Sprache“ – derart plakativ titelte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel am 02. Oktober 2006, um auf den drohenden Verfall der deutschen Sprache aufmerksam zu machen. Diese Auffassung scheint mit der allgemeinen Sprachbefindlichkeit der deutschen Bürger konform zu sein: So gab im Rahmen einer Repräsentativumfrage die Mehrzahl der Befragten an, „die derzeitige Sprachentwicklung für besorgniserregend [beziehungsweise] für teilweise bedenklich“ (Stickel 1999: 42) zu halten. In diesem Zusammenhang sprechen manche gar von einer „‚Pidginisierung’ der deutschen Sprache.“ (Gärtner 1999: 25)
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ist das Deutsche auf dem Weg zur Pidgin-Sprache?
- 2 Der englisch-deutsche Sprachkontakt
- 2.1 Die Geschichte des englischen Spracheinflusses
- 2.2 Potentielle Ursachen für die Entlehnungsprozesse
- 3 Entlehnungen englischen Ursprungs
- 3.1 Die Klassifikation von Entlehnungen
- 3.2 Begriffsklärung: Was ist ein Anglizismus?
- 4 Forschungsüberblick: Anglizismen in der Pressesprache
- 4.1 Studien zu qualitativen und quantitativen Aspekten
- 4.2 Studien zur Funktion von Anglizismen
- 5 Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel
- 5.1 Der Spiegel innerhalb der deutschen Medienlandschaft
- 5.2 Die Spiegel-Sprache
- 6 Ergebnisse der Untersuchung
- 6.1 Auszählungsgrundlagen
- 6.2 Häufigkeit von Anglizismen
- 6.3 Verteilung der Wortarten
- 6.4 Verteilung auf Sachbereiche
- 6.5 Die häufigsten Anglizismen
- 7 Das Englische in der deutschen Pressesprache der Gegenwart
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der englischen Sprache auf die deutsche Pressesprache der Gegenwart am Beispiel des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Ziel ist es, die Häufigkeit und Art von Anglizismen in der Spiegel-Sprache zu analysieren und deren Funktion im Kontext der deutschen Medienlandschaft zu beleuchten.
- Die Geschichte des englischen Spracheinflusses auf das Deutsche
- Die Ursachen und Gründe für die Entlehnung von englischen Wörtern in die deutsche Sprache
- Die Klassifizierung von Anglizismen und die Definition des Anglizismusbegriffs
- Die Rolle von Anglizismen in der deutschen Pressesprache
- Die Verwendung von Anglizismen im Nachrichtenmagazin Der Spiegel
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die Debatte um die „Pidginisierung“ des Deutschen, die durch die Verwendung von Anglizismen ausgelöst wird. Es werden verschiedene Perspektiven auf diese Thematik vorgestellt und die Bedeutung der Pressesprache als Gegenstand der Untersuchung hervorgehoben.
Kapitel 2 befasst sich mit dem englisch-deutschen Sprachkontakt und zeichnet die Geschichte des englischen Einflusses auf das Deutsche nach. Es werden verschiedene historische Phasen und deren Auswirkungen auf die Sprache dargestellt.
Kapitel 3 analysiert die Klassifizierung von Entlehnungen und die Definition des Anglizismusbegriffs. Es werden verschiedene Kategorien von Anglizismen vorgestellt und deren Bedeutung für die wissenschaftliche Analyse erläutert.
Kapitel 4 bietet einen Forschungsüberblick über Anglizismen in der Pressesprache. Es werden wichtige Studien vorgestellt, die sich mit den qualitativen und quantitativen Aspekten sowie der Funktion von Anglizismen in der deutschen Medienlandschaft befassen.
Kapitel 5 stellt das Nachrichtenmagazin Der Spiegel als Untersuchungsgegenstand vor und beleuchtet seine Bedeutung innerhalb der deutschen Medienlandschaft. Es wird zudem die sprachliche Eigenart des Spiegels analysiert.
Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung der Anglizismen im Spiegel. Es werden die Häufigkeit, die Verteilung der Wortarten und der Sachbereiche sowie die häufigsten Anglizismen im untersuchten Textkorpus ausgewertet.
Schlüsselwörter
Anglizismen, Pressesprache, Medienlandschaft, Sprachwandel, Entlehnung, Geschichte, Klassifikation, Forschungsüberblick, Nachrichtenmagazin, Der Spiegel, Deutsch, Englisch
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst das Englische die deutsche Sprache im "Spiegel"?
Das Nachrichtenmagazin nutzt häufig Anglizismen, was oft als Indikator für den Sprachwandel in der deutschen Pressesprache analysiert wird.
Was ist ein Anglizismus?
Ein sprachliches Element, das aus dem Englischen in eine andere Sprache (hier Deutsch) übernommen wurde.
Ist das Deutsche auf dem Weg zur "Pidgin-Sprache"?
Die Arbeit untersucht die besorgte öffentliche Debatte um eine vermeintliche Verlotterung der Sprache durch übermäßigen englischen Einfluss.
In welchen Sachbereichen treten Anglizismen am häufigsten auf?
Besonders stark vertreten sind sie in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Lifestyle und Politik.
Welche Funktion haben Anglizismen in der Presse?
Sie dienen oft der Präzision, der sprachlichen Ökonomie oder dem Ausdruck von Modernität und Internationalität.
- Arbeit zitieren
- Maria Melanie Meyer (Autor:in), 2009, Der Einfluss des Englischen auf die deutsche Pressesprache der Gegenwart, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163837