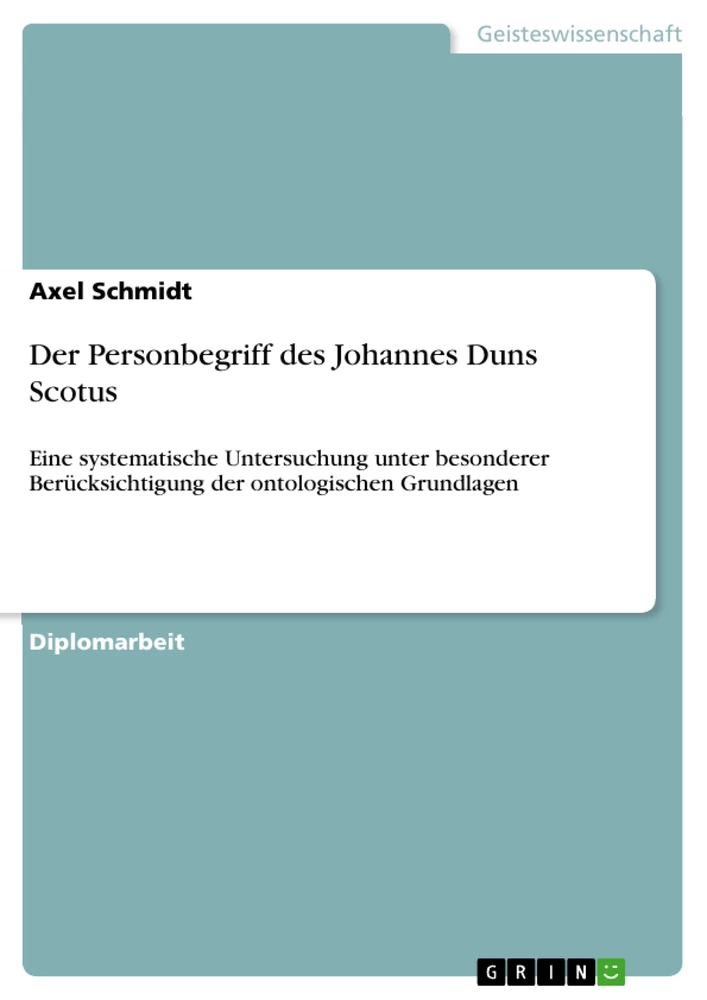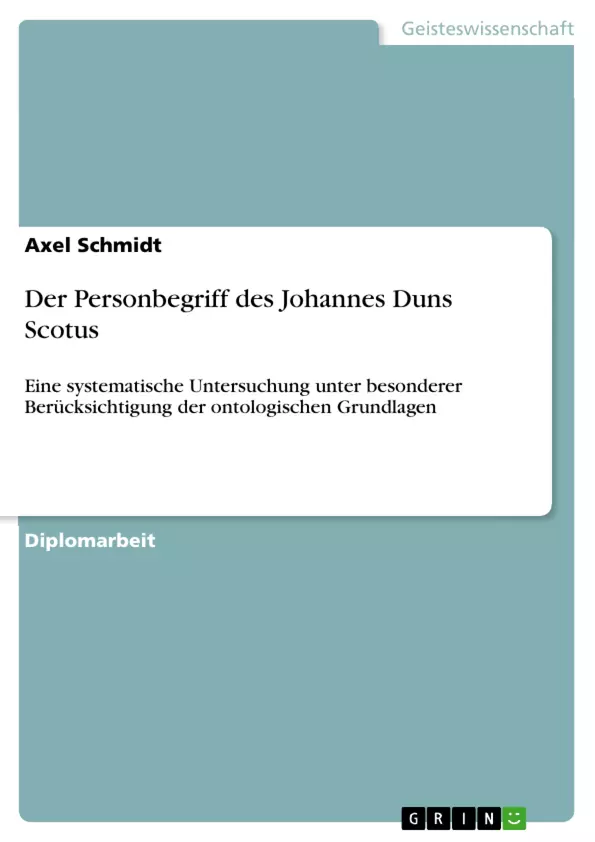Die Frage, was unter Person oder personalem Leben zu verstehen ist, bewegt heute viele Gemüter. Biologen, Mediziner und Juristen versuchen, den Beginn und das Ende menschlicher Personalität zu definieren, da diese zeitliche Festlegung heute zum Problem geworden ist angesichts der Debatten um die sittliche Erlaubtheit der Abtreibung und der (aktiven) Euthanasie.
Einige Moraltheologen unterscheiden zwischen biologisch-menschlichem und personal-menschlichem Leben, als gäbe es eine Zeitspanne, in der ein Mensch noch nicht Person ist (und eine solche, in welcher er nicht mehr Person ist?). Häufig läßt man sich bei solchen Überlegungen von pragmatischen Gesichtspunkten leiten, oder man interpretiert gewisse empirische Erkenntnisse aus der Embryonalentwicklung oder aus der Gehirnphysiologie voreilig als metaphysisch relevante Aussagen über das Wesen des Menschen und seines Personseins.
Demgegenüber tut eine genuin philosophische Besinnung über das Wesen der Person not. Eine Hauptursache der heutigen Unklarheit über den Personbegriff besteht darin, daß nicht mehr klar zwischen Vermögen und aktueller Ausübung desselben unterschieden wird, oder ontologisch gesagt: zwischen actus primus und secundus.
Wenn auch ungeborene Kinder, Unmündige oder geistig Behinderte nicht aktuell in der Lage sind, gewisse Akte zu setzen, die man zu Recht als personal bezeichnet (z.B. freie Willensentscheidungen, Vernunftgebrauch, Kommunikation mit anderen usw.), so besagt dies noch nichts über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der realen Vermögen zu solchen Akten.
Die Würde der Person besteht nicht in der tatsächlichen (und damit zufälligen) Ausübung gewisser Fähigkeiten, sondern ist begründet in ihrem Wesen als Inhaberin einer geistigen Natur. Was darunter zu verstehen ist, ist eine rein philosophische Frage, zu deren Beantwortung in dieser Arbeit der große scholastische Denker Johannes Duns Scotus herangezogen werden soll. Daß Scotus nicht unmittelbar Antworten auf Fragen unserer Zeit geben kann, ist klar; aber es könnte sich herausstellen, daß dieser Philosoph uns heute mehr zu sagen hat, als man auf den ersten Blick anzunehmen geneigt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Aktualität des Problems
- Der Personbegriff in der geschichtlichen Entfaltung
- Zum geschichtlichen Ort der Philosophie und Theologie des Duns Scotus
- Einige Grundelemente der Philosophie des Duns Scotus
- Die univocatio entis und die erweiterte Transzendentalienlehre
- Die distinctio formalis (a parte rei) als neues Denkmittel
- Der Zusammenhang von Schöpfung, Freiheit und Kontingenz
- Die Situation „pro statu isto“ und das Verhältnis von Theologie und Philosophie
- Zum Aufbau und methodischen Vorgehen dieser Arbeit
- Erster Hauptteil: Ontologische Grundlagen
- Die Bestimmung des Personbegriffs im Rahmen der Ontologie bzw. Metaphysik
- Das Individuationsprinzip: natura communis und haecceitas
- Vom Individuellen zum Allgemeinen
- Vom Allgemeinen zum Individuellen
- Die haecceitas
- Natur und Suppositum
- „abstractio totalis“ und „abstractio formalis“
- Geschöpfliche Natur und Suppositum: Mitteilung der Natur durch Teilung und Vervielfältigung
- Göttliche Natur und Suppositum: Mitteilung des Wesens Gottes ohne Teilung und Vervielfältigung
- [Exkurs:] Die formale Distinktion von Natur und Suppositum in Gott
- Zweiter Hauptteil: Die göttlichen Personen
- Definition und Definierbarkeit der (göttlichen) Personen
- Die blickweise Erkenntnismethode und die Lehre von den intentiones primae et secundae
- Der Personbegriff
- Person und Relation
- Die Einfachheit der göttlichen Personen
- Dritter Hauptteil: Die menschliche Person
- Die Inkommunikabilität der Person als doppelte negatio dependentiae actualis et aptitudinalis
- Menschliche Person und Leiblichkeit
- Person und Wille
- Vergleich der beiden Wirklichkeiten Person und Wille
- Die personale Liebe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Personbegriff des Johannes Duns Scotus. Sie verfolgt das Ziel, die ontologischen Grundlagen dieses Begriffs systematisch zu untersuchen. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Rolle der haecceitas und die Beziehung zwischen Natur und Suppositum gelegt.
- Ontologische Grundlagen des Personbegriffs bei Duns Scotus
- Das Verhältnis von Natur und Suppositum
- Die Bedeutung der haecceitas für die Individualität
- Der Personbegriff in der Trinitätslehre
- Die menschliche Person im Licht der scholastischen Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problematik des Personbegriffs ein, beleuchtet dessen Aktualität und skizziert die geschichtliche Entwicklung. Sie stellt Johannes Duns Scotus als zentralen Bezugspunkt vor und umreißt seine philosophischen Grundannahmen. Im ersten Hauptteil werden die ontologischen Grundlagen des Personbegriffs bei Scotus analysiert, insbesondere das Individuationsprinzip, die haecceitas und das Verhältnis von Natur und Suppositum. Der zweite Hauptteil widmet sich den göttlichen Personen und untersucht ihre Definition, ihre Relation zueinander und ihre Einfachheit. Der dritte Hauptteil schließlich beleuchtet die menschliche Person, ihre Inkommunikabilität, die Beziehung zur Leiblichkeit und die Verbindung zum Willen.
Schlüsselwörter
Johannes Duns Scotus, Personbegriff, Ontologie, haecceitas, Natur, Suppositum, Trinitätslehre, menschliche Person, Individualität, Inkommunikabilität, Leiblichkeit, Wille.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Johannes Duns Scotus unter "haecceitas"?
Die "haecceitas" (Diesheit) ist das Individuationsprinzip, das eine allgemeine Natur zu einem einzigartigen, individuellen Einzelwesen macht.
Wie definiert Scotus den Begriff der Person?
Eine Person ist für Scotus ein inkommunikables Suppositum einer geistigen Natur, wobei die Inkommunikabilität die Einzigartigkeit und Unvertretbarkeit betont.
Was ist der Unterschied zwischen Natur und Suppositum?
Die Natur ist das "Was" (das Wesen), während das Suppositum das "Wer" (der Träger der Natur) ist. Die Person ist das Suppositum einer vernünftigen Natur.
Welche Rolle spielt der Wille im Personbegriff von Scotus?
Der Wille ist zentral für die menschliche Personalität, da erst durch den freien Willen Akte wie Liebe und moralische Entscheidungen möglich werden.
Wie lässt sich Scotus' Philosophie auf moderne ethische Debatten anwenden?
Scotus unterscheidet zwischen dem bloßen Vermögen (actus primus) und der Ausübung (actus secundus), was relevant für die Definition von Personalität bei Ungeborenen oder Behinderten ist.
- Quote paper
- Dr. Axel Schmidt (Author), 1985, Der Personbegriff des Johannes Duns Scotus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163882