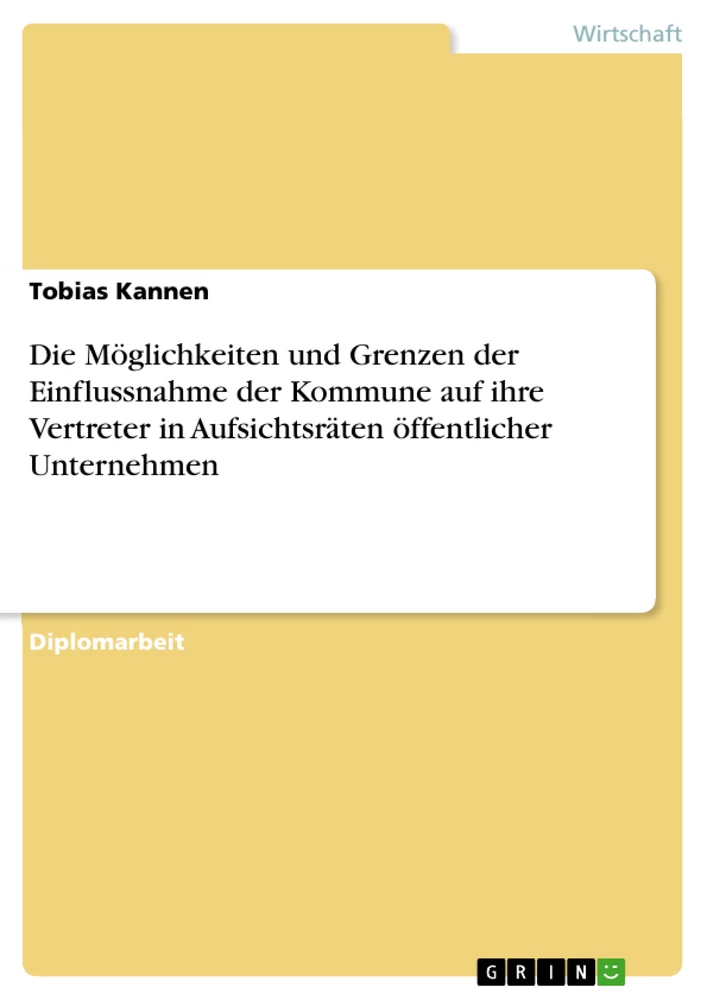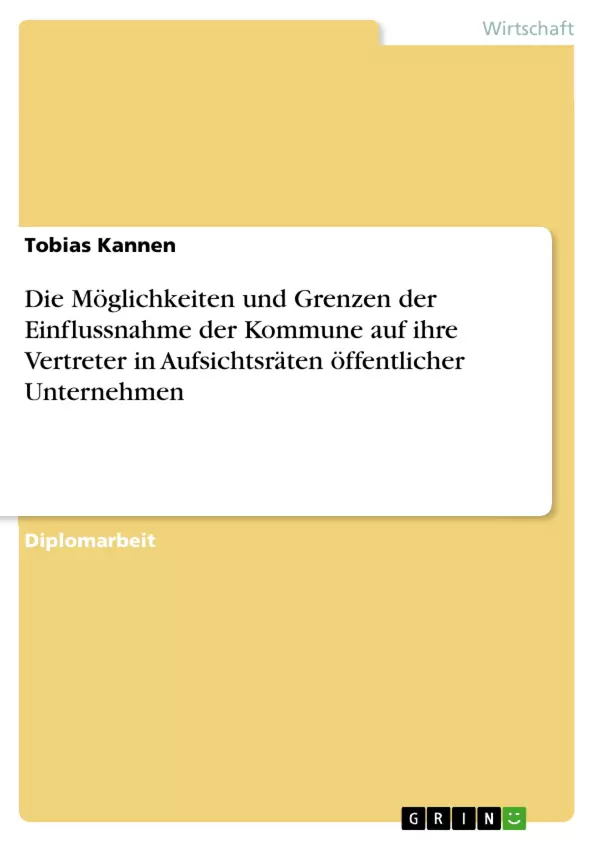Im Rahmen der Daseinsvorsorge können sich Kommunen zur Erfüllung ihrer Aufgaben unter bestimmten Voraussetzungen an privatrechtlichen Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft beteiligen. Hierdurch entsteht eine Schnittstelle zwischen Gesellschafts- und Kommunalrecht. Schwierige Rechtsprobleme gilt es überall dort zu lösen, wo Sachverhalte auf der Grenzlinie zweier verschiedener Rechtsgebiete angesiedelt sind. Nach dem Grundgesetz ist das Gesellschaftsrecht als Bundesrecht dem Kommunalrecht vorrangig. Gleichzeitig lässt sich aus dem Grundgesetz eine Einwirkungspflicht der Kommune auf ihre Unternehmen ableiten.
Trotz aller in den Gemeindeordnungen festgelegten Absicherungen (wie z.B. der Haftungsbegrenzung) können nicht alle Beteiligungsrisiken ausgeschlossen werden, da die Entscheidungen über Art und Ausmaß der Aufgabenerfüllung nicht von der Kommune bzw. deren Vertretung selbst, sondern von den Gesellschaftsorganen getroffen werden. Hieraus lässt sich die Frage ableiten, welchen Einfluss die Kommune auf diese Organe, im Speziellen auf den Aufsichtsrat, nutzen kann. Einwirkungsmöglichkeiten auf Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat kommunaler Unternehmen hat die Kommune weder als Aktionär einer Aktiengesellschaft noch als Gesellschafter einer GmbH. Etwas Anderes gilt für die kommunalen Vertreter. In dieser Arbeit wird die Frage erörtert, welche grundsätzlichen Möglichkeiten der Kommune zur Verfügung stehen, ihre Interessen durch ihre Vertreter in Aufsichtsräten kommunaler Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft vertreten zu lassen, und welche gesellschaftsrechtlichen Grenzen dabei zu beachten sind.
Die große Brisanz, die in diesem Thema steckt, hat sich nach der Abgabe dieser Abgabe weiter empirisch bestätigt. So gab es in einigen Kommunen Probleme mit der Verschwiegenheit kommunaler Aufsichtsräte, anderer Kommunen waren dabei, die Weisungsbefugnisse neu zu regeln
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Gang der Untersuchung
- 2. Kommunale Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft
- 2.1. Einführung
- Funktionssperre oder Subsidiaritätsklausel
- 2.2. Die kommunalrechtliche Schrankentrias
- 2.2.1. Öffentlicher Zweck
- 2.2.2. Leistungsfähigkeitsbezug
- 2.2.3. Subsidiaritätsklausel
- 2.3. Die Privatrechtsform
- 2.3.1. Gründe für die Wahl der Privatrechtsform
- 2.3.2. Folgen für die kommunalen Handlungsmöglichkeiten
- 2.3.3. Die Kapitalgesellschaft als privatrechtliche Rechtsform
- 3. Die Einwirkungspflicht der Kommune auf die Geschäftstätigkeit der kommunalen Unternehmen
- 3.1. Die Notwendigkeit kommunaler Einwirkung
- 3.2. Die verfassungsrechtlichen Gründe der Einwirkungspflicht
- 3.2.1. Demokratieprinzip
- 3.2.2. Rechtsstaatsprinzip
- 3.2.3. Sozialstaatsprinzip
- 3.3. Die Grenzen der Einwirkungspflicht
- 4. Der Aufsichtsrat - Grundlagen
- 4.1. Der Aufsichtsrat in der Aktiengesellschaft
- 4.2. Der Aufsichtsrat in der GmbH
- 4.2.1. Obligatorischer Aufsichtsrat
- 4.2.2. Fakultativer Aufsichtsrat
- 4.3. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats
- 4.4. Das Verhältnis des Aufsichtsrats zur Geschäftsführung
- 4.4.1. Die Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft
- 4.4.1.1. Der Vorstand als geschäftsführendes Organ der Aktiengesellschaft
- 4.4.1.2. Das Verhältnis zwischen der Geschäftsführung und den Gesellschaftern in der GmbH
- 4.4.1.2.1. Die Geschäftsführung
- 4.4.1.2.2. Die Gesellschafter
- 4.4.2. Die Überwachungsfunktion
- 4.4.2.1. Die Überwachung der Geschäftsführung in der Aktiengesellschaft
- 4.4.2.2. Die Überwachung der Geschäftsführung in der GmbH
- 4.4.3. Der Einfluss des Aufsichtsrats auf die Geschäftsführung
- 4.4.3.1. Zur Rechtslage bei der Aktiengesellschaft
- 4.4.3.2. Zur Rechtslage bei der GmbH
- 4.4.3.2.1. Die Kompetenzen des obligatorischen Aufsichtsrats
- 4.4.3.2.2. Die Kompetenzen des fakultativen Aufsichtsrats
- 4.4.3.3. Schlussfolgerungen
- 5. Kommunale Vertreter im Aufsichtsrat
- 5.1. Grundlegendes
- 5.2. Die Erlangung und Beendigung des Mandats als kommunales Mitglied des Aufsichtsrats
- 5.2.1. Die Mandatserlangung
- 5.2.1.1. Die Mandatserlangung in der Aktiengesellschaft
- 5.2.1.2. Die Mandatserlangung in der GmbH
- 5.2.2. Die Mandatsbeendigung
- 5.2.2.1. Die Mandatsbeendigung in der Aktiengesellschaft
- 5.2.2.2. Die Mandatsbeendigung in der GmbH
- 6. Die Verschwiegenheitspflicht kommunaler Aufsichtsräte
- 6.1. Der Pflichtenkonflikt kommunaler Vertreter im Aufsichtsrat
- 6.1.1. Die Verschwiegenheitspflicht von Aufsichtsräten im Allgemeinen
- 6.1.1.1. Die Verschwiegenheitspflicht von Aufsichtsräten in der Aktiengesellschaft
- 6.1.1.2. Die Verschwiegenheitspflicht von Aufsichtsräten in der GmbH
- 6.1.2. Die Auskunftspflicht kommunaler Vertreter im Aufsichtsrat
- 6.1.2.1. Regelungen im Gemeindewirtschaftsrecht
- 6.1.2.1.1. Gesetzliche Regelungen in Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
- 6.1.2.1.2. Gegenstand der Auskunftspflicht
- 6.1.2.2. Regelungen im Kommunalverfassungsrecht
- 6.2. Die Sondervorschriften der §§ 394 f. AktG
- 6.2.1. Die Regelungen der §§ 394 f. AktG
- 6.2.1.1. Hintergrund und Kurzdarstellung
- 6.2.1.2. Der Anwendungsbereich der §§ 394 f. AktG
- 6.2.1.3. Die Berichtspflicht gegenüber der Gebietskörperschaft als Voraussetzung der Anwendung des § 394 AktG
- 6.2.1.4. Die Berichtsempfänger nach §§ 394 f. AktG
- 6.2.2. Die analoge Anwendung der §§ 394 f. AktG bei der GmbH
- 7. Kritische Analyse der Weisungsbefugnis der Kommune
- 7.1. Darstellung der Problematik anhand von Fallbeispielen
- 7.2. Zur Lage in den einzelnen Gemeindeordnungen
- 7.2.1. Die Notwendigkeit der Differenzierung der kommunalen Vertreter im Aufsichtsrat
- 7.2.2. Die ausdrückliche Weisungsgebundenheit in Nordrhein-Westfalen
- 7.2.3. Analoge Regelungen der Weisungsbefugnis gegenüber dem Aufsichtsrat mit der Gesellschafterversammlung in Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt
- 7.2.4. Die Regelung der Weisungsbefugnis in Bayern
- 7.2.5. Die Regelung der Weisungsbefugnis in Schleswig-Holstein
- 7.2.6. Die Regelung der Weisungsbefugnis im Saarland
- 7.2.7. Unklare Regelung in Thüringen
- 7.2.8. Weisungsgebot nur für Gemeindevertreter in der Haupt- bzw. Gesellschafterversammlung in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Sachsen
- 7.3. Zur Lage im Gesellschaftsrecht
- 7.3.1. Die Rechtslage im Aktiengesetz
- 7.3.1.1. Gewählte Mitglieder des Aufsichtsrats
- 7.3.1.2. Entsandte Mitglieder des Aufsichtsrats
- 7.3.2. Die Rechtslage im Mitbestimmungsgesetz und Drittelbeteiligungsgesetz
- 7.3.3. Die Rechtslage im GmbH-Gesetz
- 7.4. Weisungsbindungen aufgrund öffentlich-rechtlicher Regelungen und deren Verhältnis zum Gesellschaftsrecht
- 7.4.1. Weisungsbindungen aufgrund des Beamtenrechts
- 7.4.2. Weisungsbindungen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen
- 7.5. Das Verhältnis zwischen Kommunal- und Gesellschaftsrecht
- 7.5.1. Die Ansichten vom „Vorrang des öffentlichen Rechts“
- 7.5.1.1. Die Argumentation des „Vorrangs des öffentlichen Rechts“
- 7.5.1.2. Kritische Würdigung der Argumentationen
- 7.5.2. Der Vorrang des Gesellschaftsrechts
- 7.6. Konsequenzen aus der Rechtslage für den Aufsichtsrat
- 7.6.1. Konsequenzen für den Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft und den obligatorischen Aufsichtsrat der GmbH
- 7.6.2. Konsequenzen für den fakultativen Aufsichtsrat der GmbH
- 7.7. Die Problematik der internen Weisungen
- 7.7.1. Die Ansichten der Zulässigkeit interner Weisungen
- 7.7.2. Kritische Würdigung
- 7.8. Unverbindliche Empfehlungen des Rats als Lösung der Weisungsproblematik
- 7.8.1. Die Ansichten der Zulässigkeit unverbindlicher Empfehlungen
- 7.8.2. Kritische Würdigung
- 8. Die Schnittstelle zwischen der Kommune und dem Aufsichtsrat kommunaler Unternehmen: Das öffentliche Beteiligungscontrolling
- 8.1. Begriffsklärung
- 8.2. Die Aufgaben des öffentlichen Beteiligungscontrollings
- 8.3. Die Zusammenarbeit zwischen dem Aufsichtsrat und dem öffentlichen Beteiligungscontrolling
- 8.3.1. Das öffentliche Beteiligungscontrolling als ein Instrument der Ermöglichung zielorientierter Unternehmensaufsicht
- 8.3.2. Kritische Analyse der Zusammenarbeit
- 9. Zur Handhabung der Einflussnahme in den Ländern: Eine empirische Studie
- 9.1. Vorgehensweise
- 9.2. Ergebnisse aus den einzelnen Ländern
- 9.2.1. Baden-Württemberg
- 9.2.2. Bayern
- 9.2.3. Brandenburg
- 9.2.4. Hessen
- 9.2.5. Mecklenburg-Vorpommern
- 9.2.6. Niedersachsen
- 9.2.7. Nordrhein-Westfalen
- 9.2.8. Rheinland-Pfalz
- 9.2.9. Saarland
- 9.2.10. Sachsen
- 9.2.11. Sachsen-Anhalt
- 9.2.12. Schleswig-Holstein
- 9.2.13. Thüringen
- Rechtliche Grundlagen der kommunalen Einflussnahme
- Die Rolle des Aufsichtsrats in Kapitalgesellschaften
- Pflichten und Kompetenzen kommunaler Aufsichtsräte
- Die Problematik der Weisungsbefugnis der Kommune
- Das öffentliche Beteiligungscontrolling als Instrument der Einflussnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit Kommunen Einfluss auf ihre Vertreter in Aufsichtsräten öffentlicher Unternehmen nehmen können. Dabei wird untersucht, welche Möglichkeiten und Grenzen sich aus den rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit führt in die Problemstellung ein und erläutert den Gang der Untersuchung. Kapitel 2 beleuchtet die Rechtsform kommunaler Unternehmen und die damit verbundenen rechtlichen Rahmenbedingungen. Kapitel 3 befasst sich mit der Einwirkungspflicht der Kommune auf die Geschäftstätigkeit ihrer Unternehmen, die sich aus verfassungsrechtlichen Gründen ergibt. Im vierten Kapitel werden die Grundlagen des Aufsichtsrats in Kapitalgesellschaften behandelt, wobei insbesondere auf die Überwachungsfunktion und den Einfluss des Aufsichtsrats auf die Geschäftsführung eingegangen wird. Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Erlangung und Beendigung des Mandats als kommunales Mitglied des Aufsichtsrats. Kapitel 6 analysiert die Verschwiegenheitspflicht kommunaler Aufsichtsräte im Kontext des Pflichtenkonflikts. Die kritische Analyse der Weisungsbefugnis der Kommune gegenüber ihren Vertretern im Aufsichtsrat bildet den Schwerpunkt des siebten Kapitels. Kapitel 8 beleuchtet das öffentliche Beteiligungscontrolling als Schnittstelle zwischen der Kommune und dem Aufsichtsrat kommunaler Unternehmen. Abschließend präsentiert Kapitel 9 die Ergebnisse einer empirischen Studie zur Handhabung der kommunalen Einflussnahme in den verschiedenen Bundesländern.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Themen kommunale Unternehmen, Aufsichtsrat, Einflussnahme, Weisungsbefugnis, Beteiligungscontrolling, Rechtliche Rahmenbedingungen, Gemeindewirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht.
Häufig gestellte Fragen
Darf eine Kommune Weisungen an ihre Vertreter im Aufsichtsrat erteilen?
Dies ist rechtlich umstritten. Während einige Gemeindeordnungen (z.B. NRW) eine Weisungsgebundenheit vorsehen, betont das Aktienrecht die eigenverantwortliche Pflicht der Aufsichtsräte gegenüber der Gesellschaft.
Was ist der Konflikt zwischen Kommunalrecht und Gesellschaftsrecht?
Das Kommunalrecht fordert die Einwirkung der Gemeinde zur Aufgabenerfüllung, während das Gesellschaftsrecht (AktG, GmbHG) die Unabhängigkeit der Organe und die Verschwiegenheit schützt.
Welche Verschwiegenheitspflichten gelten für kommunale Aufsichtsräte?
Aufsichtsräte müssen über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft Stillschweigen bewahren, was oft im Widerspruch zur Berichtspflicht gegenüber dem Gemeinderat steht.
Was regeln die §§ 394, 395 AktG?
Diese Sondervorschriften erlauben Vertretern von Gebietskörperschaften unter bestimmten Bedingungen die Berichterstattung an ihre entsendende Stelle, ohne die Verschwiegenheitspflicht zu verletzen.
Was ist die Aufgabe des öffentlichen Beteiligungscontrollings?
Es dient als Schnittstelle zwischen Verwaltung und Unternehmen, um die Zielerreichung der Beteiligungen zu überwachen und die Aufsichtsratsmitglieder fachlich zu unterstützen.
Gibt es Unterschiede zwischen GmbH und AG bei der kommunalen Einflussnahme?
Ja, in der GmbH haben Gesellschafter (die Kommune) grundsätzlich stärkere Weisungsrechte gegenüber der Geschäftsführung als in einer Aktiengesellschaft.
- Arbeit zitieren
- Tobias Kannen (Autor:in), 2005, Die Möglichkeiten und Grenzen der Einflussnahme der Kommune auf ihre Vertreter in Aufsichtsräten öffentlicher Unternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163992