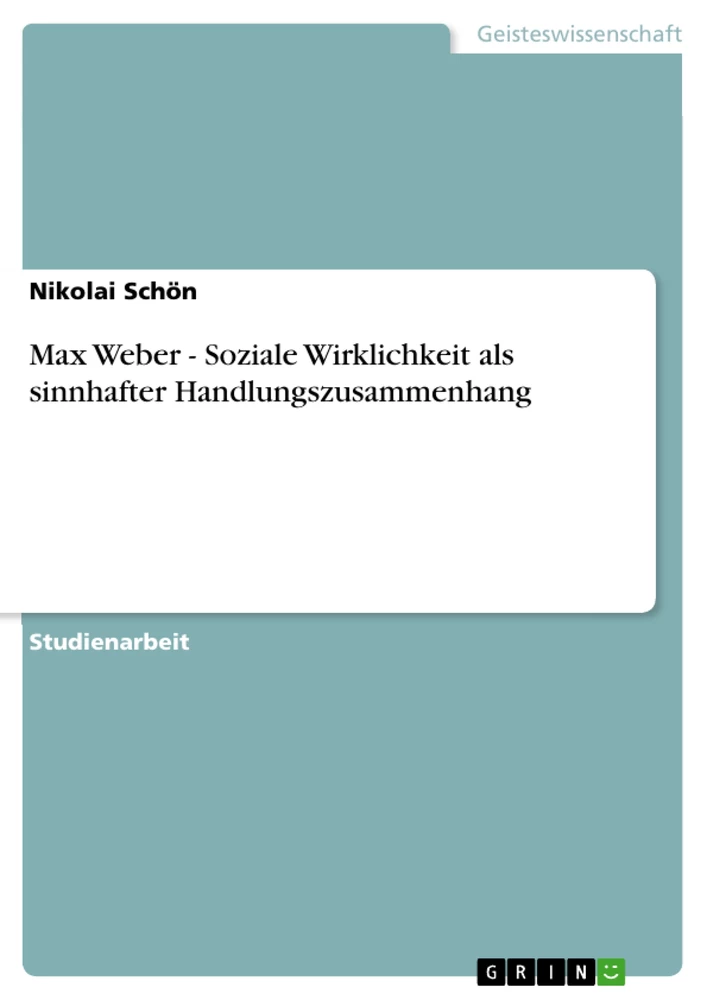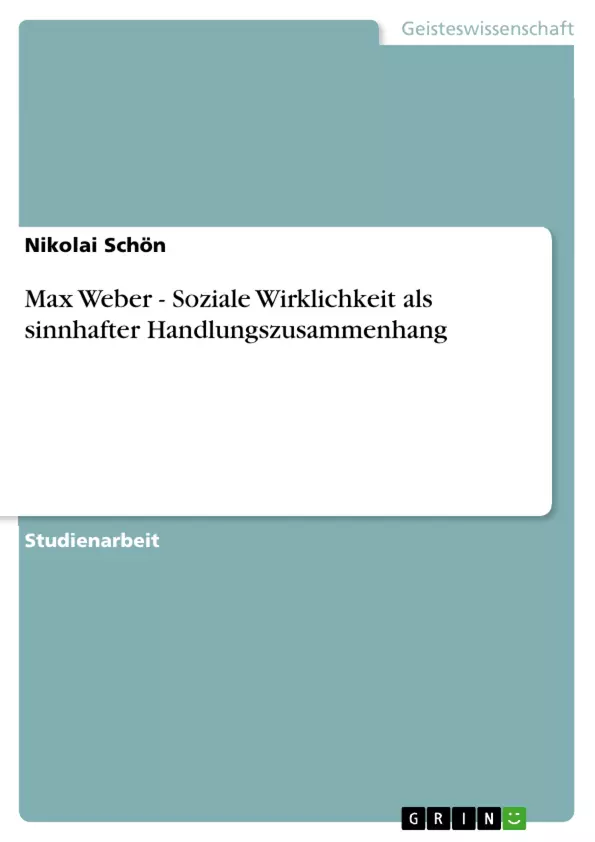Ziel dieser Hausarbeit ist es, die Ausgangslage sowie die wichtigsten Elemente der Theorie Webers darzustellen. Ein knapper Überblick über den Lebenslauf und die Darstellung eines Teiles seiner praktischen Forschungsarbeit sollen dabei einen Einblick in das Gesamtwerk gewährleisten. Die Gliederung der Arbeit separiert dabei die theoretische Ausgangslage Webers, die eigentliche soziologische Theorie und deren Grundbegriffe sowie einen Auszug aus der Forschungsarbeit hinsichtlich der Modernisierung in Europa. Da Webers Werk von immensem Umfang ist, können im Rahmen der Arbeit nur die jeweils wichtigsten Aspekte eines jeden Punktes beleuchtet werden. Dabei sollen Beispiele zur leichteren Verständlichkeit beitragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vita
- Webers theoretische Ausgangslage
- Das Konzept einer verstehenden Soziologie
- Das Postulat der „Werturteilsfreiheit“
- Soziologie als Wissenschaft vom sozialen Handeln
- Soziales Handeln
- Idealtypen
- Soziale Beziehung und legitime Ordnung
- Typen der legitimen Herrschaft
- Gründe der Modernisierung in Europa
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit zielt darauf ab, die Grundlage und die wichtigsten Elemente der Theorie von Max Weber darzustellen. Ein kurzer Überblick über sein Leben und einen Teil seiner praktischen Forschungsarbeit soll Einblicke in sein Gesamtwerk ermöglichen. Die Gliederung der Arbeit trennt dabei die theoretische Ausgangslage Webers, die eigentliche soziologische Theorie und ihre Grundbegriffe sowie einen Ausschnitt aus seiner Forschungsarbeit zur Modernisierung in Europa.
- Webers Konzept der verstehenden Soziologie
- Das Postulat der „Werturteilsfreiheit“
- Soziales Handeln und Idealtypen
- Soziale Beziehung und legitime Ordnung
- Gründe der Modernisierung in Europa
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung erläutert das Ziel der Arbeit, welches darin besteht, Webers Theorie und ihre wichtigsten Bestandteile darzustellen. Sie gibt einen kurzen Überblick über Webers Lebenslauf und seine praktische Forschungsarbeit, um Einblicke in sein Gesamtwerk zu ermöglichen. Die Arbeit gliedert sich in Webers theoretische Ausgangslage, die soziologische Theorie, ihre Grundbegriffe und einen Ausschnitt aus seiner Forschungsarbeit zur Modernisierung in Europa.
Vita
Dieses Kapitel beleuchtet Webers Lebensweg, beginnend mit seiner Geburt, seiner Kindheit und Jugend, über sein Studium, seine Habilitation und Professuren bis hin zu seinem Engagement in der Politik und seinem Tod. Es werden wichtige Stationen seines Lebens beleuchtet und seine Interessen und Einflüsse erörtert. Besonderes Augenmerk liegt auf Webers psychischer Erkrankung und deren Auswirkungen auf seine Karriere.
Webers theoretische Ausgangslage
Das Kapitel stellt Webers "verstehende Soziologie" vor und erläutert das Konzept der „Werturteilsfreiheit“. Es beleuchtet die wichtigsten Elemente seiner theoretischen Ausgangslage und ihre Bedeutung für seine soziologische Theorie.
Soziologie als Wissenschaft vom sozialen Handeln
Dieses Kapitel befasst sich mit Webers Definition von sozialem Handeln und der Rolle von Idealtypen in seiner Theorie. Es behandelt die Konzepte der sozialen Beziehung und der legitimen Ordnung sowie die Typen der legitimen Herrschaft. Es zeigt die Bedeutung des sozialen Handelns für das Verständnis gesellschaftlicher Prozesse auf.
Schlüsselwörter
Max Weber, Verstehende Soziologie, Werturteilsfreiheit, Soziales Handeln, Idealtypen, Legitime Ordnung, Soziale Beziehung, Herrschaftstypen, Modernisierung, Europa.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Max Webers Konzept der „Verstehenden Soziologie“?
Weber definiert Soziologie als eine Wissenschaft, die soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf ursächlich erklären will.
Was bedeutet das Postulat der „Werturteilsfreiheit“?
Wissenschaftler sollen ihre Forschung auf Fakten stützen und eigene moralische oder politische Wertungen von der wissenschaftlichen Analyse trennen.
Wie definiert Max Weber „soziales Handeln“?
Soziales Handeln ist ein Verhalten, das nach dem subjektiven Sinn des Handelnden auf das Verhalten anderer bezogen ist und daran in seinem Ablauf orientiert wird.
Was sind „Idealtypen“ in der soziologischen Theorie?
Idealtypen sind gedankliche Konstruktionen, die bestimmte Merkmale der sozialen Realität einseitig steigern, um Vergleiche und Analysen zu ermöglichen.
Welche Typen der legitimen Herrschaft unterscheidet Weber?
Weber unterscheidet drei reine Typen: die rationale (legale), die traditionale und die charismatische Herrschaft.
Warum hat sich laut Weber die Modernisierung in Europa vollzogen?
Die Arbeit beleuchtet Webers Thesen zu den Gründen der Modernisierung, insbesondere den Zusammenhang zwischen Rationalisierung und gesellschaftlicher Entwicklung.
- Citar trabajo
- Nikolai Schön (Autor), 2007, Max Weber - Soziale Wirklichkeit als sinnhafter Handlungszusammenhang, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164114