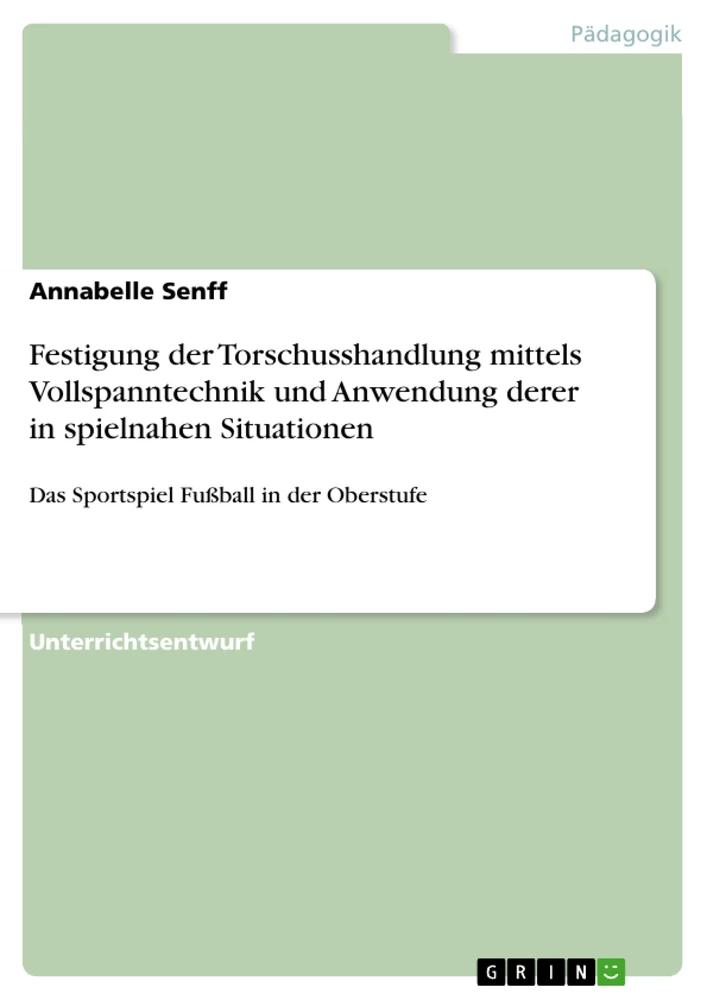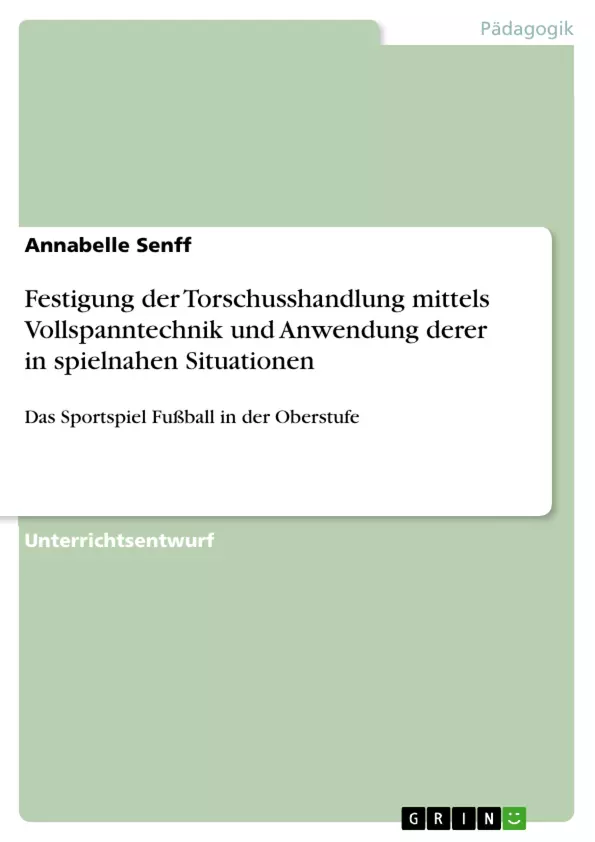Inhaltsverzeichnis: Ausführlicher Unterrichtsentwurf zu den Punkten
1. Bedingungsanalyse
1.1 Lerngruppe
1.2 Lehrer-Schüler-Verhältnis
1.3 Äußere Bedingungen
1.4 Schlussfolgerungen für die Unterrichtsgestaltung
2. Didaktisch-methodische Überlegungen und Begründungen
2.1 Stellung der Stunde in der Stoffeinheit
2.2 Sachanalyse sowie Auswahl und Begründung der Inhalte
2.3 Auswahl und Begründung der Lernziele
2.4 Begründung der didaktischen Stufung des Unterrichts und des gewählten Methodenkonzeptes
2.5 Aussagen zu Schülerleistungen
3. Verlaufsplanung
4. Literaturverzeichnis
5. Anhang (Technikleitbild, Korrektur- und Beobachtungsbogen, Skizzen zum organisatorischen Hallenaufbau, den einzelnen Stationen und dem Komplex-Parcours mit Durchführungshilfen und der Visualisierung des Übungsguts)
Die profunde Tiefgründigkeit und Ausführlichkeit des Entwurfes wurden im anschließenden Auswertungsgespräch besonders hervorgehoben. Die Arbeit enthält darüber hinaus anwendungsbereites Material im Anhang, das wiederum für den unmittelbaren Einsatz im Unterricht aufbereitet ist. Ferner inkludiert die Arbeit einen kompletten und in der Praxis erprobten Vorschlag (= Stoffverteilungsplan) für die Durchführung des Sportspiels „Fußball“ in der Oberstufe.
Inhaltsverzeichnis
- Bedingungsanalyse
- Lerngruppe
- Lehrer-Schüler-Verhältnis
- Äußere Bedingungen
- Schlussfolgerungen für die Unterrichtsgestaltung
- Didaktisch-methodische Überlegungen und Begründungen
- Stellung der Stunde in der Stoffeinheit
- Sachanalyse sowie Auswahl und Begründung der Inhalte
- Auswahl und Begründung der Lernziele
- Begründung der didaktischen Stufung des Unterrichts und des gewählten Methodenkonzeptes
- Aussagen zu Schülerleistungen
- Verlaufsplanung
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Unterrichtsentwurf zielt auf die Festigung der Torschusshandlung mittels Vollspanntechnik im Fußball ab und möchte die Anwendung dieser Technik in spielnahen Situationen ermöglichen. Der Entwurf fokussiert auf die didaktische Planung einer Unterrichtseinheit im Rahmen der 2. Sportart für Oberstufenschüler eines Spezialgymnasiums mit sportlicher Profilierung.
- Analyse der Lerngruppe und ihrer heterogenen Leistungsvoraussetzungen
- Sachanalyse der Torschusstechnik und deren Bedeutung im Fußball
- Entwicklung von Lernzielen und didaktischer Stufung des Unterrichts
- Einsatz geeigneter Methoden und Lernformen zur Festigung der Torschusstechnik
- Planung des Unterrichtsverlaufs mit Fokus auf spielnahe Situationen
Zusammenfassung der Kapitel
Bedingungsanalyse
Die Lerngruppe besteht aus 13 Schülern unterschiedlicher Klassenstufen, wobei die Mehrheit der Schüler aus der Oberstufe kommt. Die Schüler haben verschiedene Spezialdisziplinen, was zu unterschiedlichen Lernvoraussetzungen führt. Der Lehrer-Schüler-Verhältnis ist positiv, jedoch wird ein Schüler als „Problemfall“ identifiziert, der disziplinarische Herausforderungen stellt. Die äußeren Bedingungen sind durch eine hohe Fluktuation in der Lerngruppe, verkürzte Unterrichtszeiten und die Notwendigkeit von Leistungsnachweisen erschwert.
Didaktisch-methodische Überlegungen und Begründungen
Die Stunde ist in der Stoffeinheit „Sportspiele“ einzuordnen und soll den Schülern die Torschusstechnik mit Vollspanntechnik vermitteln. Die Inhalte werden in einem didaktisch gestuften Verlauf eingeführt und gefestigt. Die Lernziele beinhalten die Erarbeitung der korrekten Torschusstechnik und die Anwendung dieser in spielnahen Situationen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Vollspanntechnik beim Torschuss?
Bei der Vollspanntechnik wird der Ball mit dem Fußrücken (Spann) getroffen. Dies ermöglicht eine hohe Kraftübertragung und Ballgeschwindigkeit, erfordert aber eine präzise Fußhaltung.
Was ist das Ziel dieses Sportunterrichtsentwurfs?
Ziel ist die Festigung der Torschusstechnik und deren erfolgreiche Anwendung in spielnahen Situationen, besonders für Schüler der Oberstufe.
Warum ist eine Bedingungsanalyse der Lerngruppe wichtig?
Da Schüler oft unterschiedliche Leistungsvoraussetzungen und Spezialdisziplinen haben, muss der Unterricht differenziert geplant werden, um jeden Schüler optimal zu fördern.
Wie sieht die didaktische Stufung im Fußballtraining aus?
Der Unterricht folgt meist einer Stufung von der isolierten Technikübung (Vormachen/Nachmachen) hin zu komplexen Parcours und schließlich freien Spielformen.
Welche Materialien enthält der Anhang der Arbeit?
Der Anhang bietet ein Technikleitbild, Beobachtungsbögen, Skizzen zum Hallenaufbau sowie einen kompletten Stoffverteilungsplan für Fußball in der Oberstufe.
- Quote paper
- Annabelle Senff (Author), 2010, Festigung der Torschusshandlung mittels Vollspanntechnik und Anwendung derer in spielnahen Situationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164128