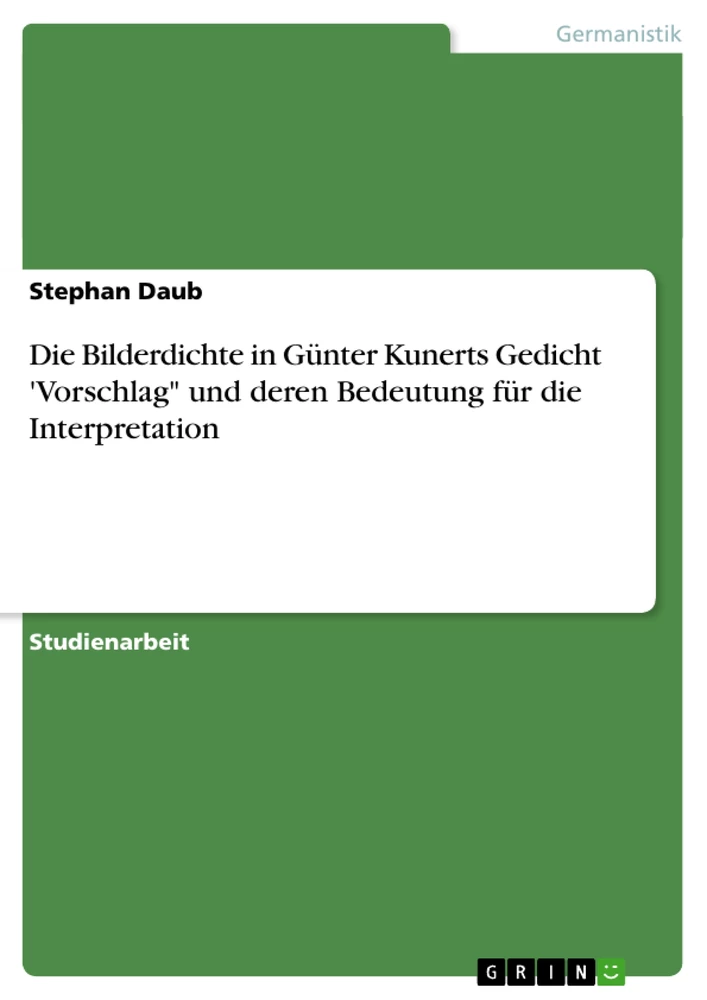Im Gegensatz zur Epik ist die Bilderdichte ein zentrales Merkmal von Gedichten. In der Germanistik gibt es eine Vielzahl an Stilmittel, die man verwenden kann. Am weit verbreitesten ist die Metapher. Darunter versteht man, „einen sprachlichen Ausdruck, bei dem ein Wort, eine Wortgruppe aus seinem eigentlichen Bedeutungszusammenhang in einen anderen übertragen wird, ohne dass ein direkter Vergleich zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem vorliegt; bildhafte Übertragung“ (Duden 2001: 629). Eine weitere rhetorische Figur ist die ‚Rhetorische Frage‘. Hierbei handelt es sich um eine „scheinbare Frage, bei der jeder die Antwort kennt“ (Biermann/Schurf 1999: 185). Ein drittes Stilmittel, welches ich im späteren Verlauf dieser Hausarbeit im Gedicht ‚Vorschlag‘ von Günter Kunert näher erläutern möchte, ist die
3
‚Ellipse‘. Dies ist ein „unvollständiger Satz; Auslassung eines Satzteils/Wortes, das leicht ergänzbar ist“ (Biermann/Schurf 1999: 184). Wichtig für die Analyse eines fiktionalen Textes ist die Grundfunktion der Sprache. Grundsätzlich unterscheidet man in appelativ (Autor bezieht Stellung zu politischen und moralischen Fragen und will mit seinem Text eine größtmögliche Wirkung beim Leser erreichen), darstellend (der Text bezieht sich auf eine Wirklichkeit und beschreibt diese) und expressiv (Autor bringt seine Stimmungen und Gefühle zum Ausdruck (Jeßing/Köhnen 2007: 3).
Die obengenannten rhetorischen Figuren (Metapher, rhetorische Frage, Ellipse), sowie die Funktion der Sprache möchte ich nun anhand des Gedichtes ‚Vorschlag‘ von Günter Kunert näher erläutern. Zudem werde ich untersuchen, welche Aussagen durch den Gebrauch der Figuren im Gedicht gestärkt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Schluss
- Literaturangaben
- Anlage: Günter Kunert, Vorschlag‘
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bilderdichte im Gedicht „Vorschlag“ von Günter Kunert und analysiert deren Bedeutung für die Interpretation. Sie beleuchtet die sprachlichen Mittel, die Kunert einsetzt, um seine Botschaft zu vermitteln und die Bedeutung der Bildsprache im Kontext der expressiven Funktion des Gedichtes.
- Analyse der Bilderdichte in "Vorschlag"
- Bedeutung der Metaphern und rhetorischen Figuren
- Funktion der Sprache im Gedicht
- Zusammenhang zwischen sprachlichen Mitteln und Interpretation
- Die Rolle des lyrischen Ichs und des Lesers
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Gattung „Lyrik“ vor. Sie beleuchtet wichtige Merkmale dieser Gattung und erläutert wichtige sprachliche Mittel wie die Metapher, die Rhetorische Frage und die Ellipse. Weiterhin werden verschiedene Grundfunktionen der Sprache vorgestellt.
Hauptteil
Der Hauptteil befasst sich mit der Analyse des Gedichtes „Vorschlag“ von Günter Kunert. Er untersucht die formale Struktur des Gedichtes, die Verwendung sprachlicher Mittel, die Funktion der Sprache und die Bedeutung der Bilderdichte für die Interpretation.
Schlüsselwörter
Lyrik, Bilderdichte, Metapher, Rhetorische Frage, Ellipse, Günter Kunert, "Vorschlag", Expressive Funktion, Interpretation, Sprache, Gedichtanalyse
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Gedichtanalyse von Günter Kunerts "Vorschlag"?
Die Arbeit untersucht die Bilderdichte und die Verwendung rhetorischer Stilmittel wie Metaphern, Ellipsen und rhetorische Fragen im Gedicht.
Was versteht man unter "Bilderdichte" in der Lyrik?
Bilderdichte bezeichnet die Häufung von bildhaften sprachlichen Ausdrücken (wie Metaphern), die eine starke visuelle oder emotionale Wirkung beim Leser erzielen.
Welche sprachlichen Mittel nutzt Kunert in "Vorschlag"?
Besonders hervorgehoben werden die Metapher (bildhafte Übertragung), die Ellipse (unvollständiger Satz) und die rhetorische Frage.
Was ist eine expressive Sprachfunktion?
Die expressive Funktion der Sprache dient dazu, die Stimmungen, Gefühle und die innere Haltung des Autors oder lyrischen Ichs zum Ausdruck zu bringen.
Wie hängen Bildsprache und Interpretation zusammen?
Die Wahl der Bilder verstärkt bestimmte Aussagen des Gedichts und ermöglicht es dem Leser, tiefere Bedeutungsebenen und politische oder moralische Botschaften zu erschließen.
Was ist eine Ellipse in der Lyrik?
Eine Ellipse ist das Auslassen von Satzteilen, die jedoch leicht ergänzt werden können. Sie dient oft dazu, die Sprache zu verdichten oder eine gehetzte Stimmung zu erzeugen.
- Quote paper
- Stephan Daub (Author), 2010, Die Bilderdichte in Günter Kunerts Gedicht 'Vorschlag" und deren Bedeutung für die Interpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164148