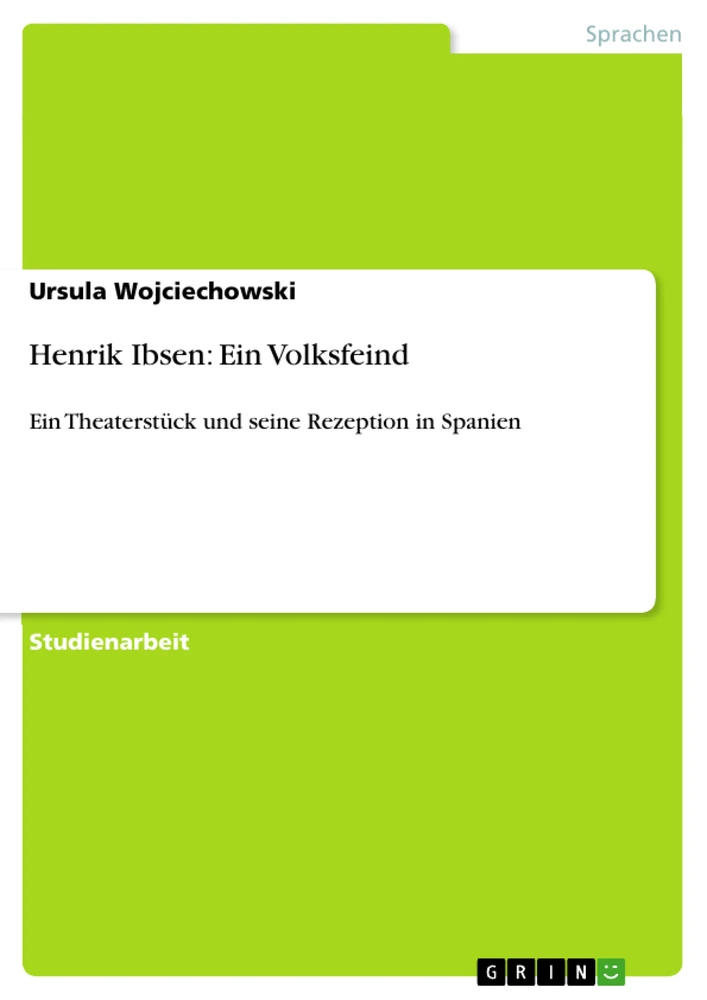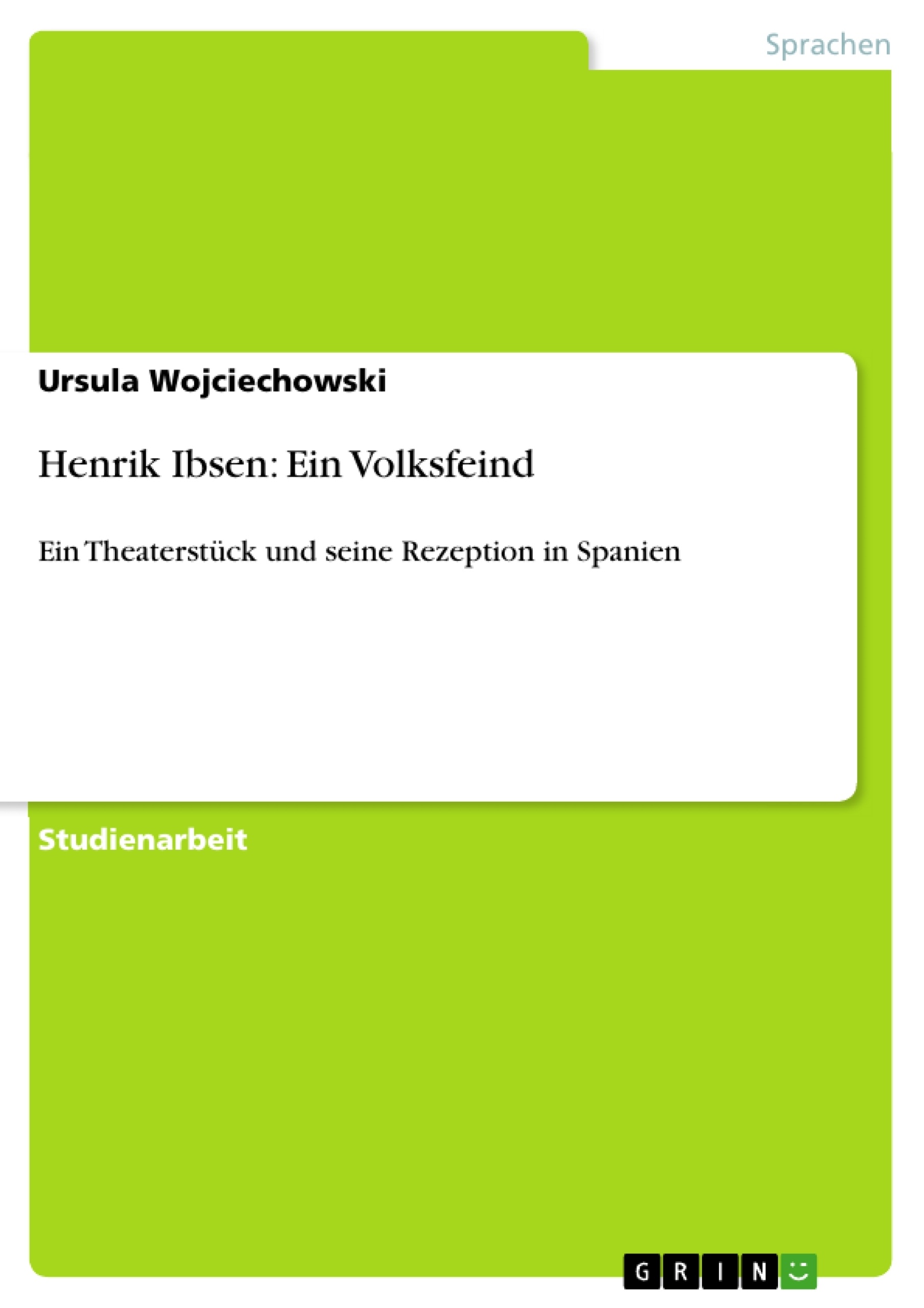Am 14. April 1893 wurde "Un enemigo del pueblo" ("Ein Volksfeind") in einer kastilischen Version im Teatre de Novetats in Barcelona uraufgeführt und war somit das erste Stück von Henrik Ibsen, das überhaupt in Spanien gespielt wurde, sicherlich nicht zuletzt deswegen, weil das Stück den politischen Interessen der Sponsoren sehr entgegenkam. Das künstlerische Interesse war dagegen zweitrangig.
Ibsen hatte zwar eigentlich keine politischen Ziele verfolgt, aber die spanischen Anarchisten (die vor allem in Barcelona stark vertreten waren) sahen in ihm einen Verfechter ihrer Ideen, vor allem, was den "Volksfeind" betraf, in dem einige Passagen zum Radikalismus aufzurufen scheinen. Der "Anarchismus" Ibsens war jedoch in erster Linie ein geistig-intellektueller; es ging Ibsen vor allem um die geistige Freiheit. Mit der vorliegenden Arbeit wurde versucht, dies zu belegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biografie Henrik Ibsens
- Ibsens Verhältnis zur Figur des Dr. Stockmann
- Aufbau und Hintergrund des Dramas
- Die Figuren neben Dr. Stockmann
- Liberalismus und Bürgertum zur Zeit Ibsens
- Die Entwicklung des Dr. Stockmann - Psychogramm eines \"Anarchisten\"?
- Der Freiheitsbegriff bei Ibsen
- Der Volksfeind in Spanien
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Henrik Ibsens Theaterstück "Ein Volksfeind" und analysiert dessen Aufbau, Figuren, Themen und Rezeption in Spanien. Das Ziel ist es, die Hintergründe des Stückes zu beleuchten, Ibsens Verhältnis zu den behandelten Themen zu ergründen und die Bedeutung des Dramas im Kontext der damaligen Gesellschaft zu verstehen.
- Ibsens Biografie und sein Verhältnis zur Figur des Dr. Stockmann
- Die Bedeutung von Liberalismus und Bürgertum im Kontext des Stückes
- Die Darstellung von Machtstrukturen und Konflikten zwischen Individuum und Gesellschaft
- Die Entwicklung der Hauptfigur Dr. Stockmann und seine Auseinandersetzung mit der Masse
- Die Rezeption des Stückes in Spanien und seine Aktualität
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Biografie Henrik Ibsens und erforscht die möglichen Verbindungen zwischen seinem Leben und dem Charakter des Dr. Stockmann. Das zweite Kapitel analysiert den Aufbau des Dramas und beleuchtet die Hintergründe seiner Entstehung. Die weiteren Kapitel untersuchen die Charaktere, Themen und den Freiheitsbegriff im Kontext des Stückes. Abschließend befasst sich die Arbeit mit der Rezeption des Dramas "Ein Volksfeind" in Spanien.
Schlüsselwörter
Henrik Ibsen, Ein Volksfeind, Drama, Liberalismus, Bürgertum, Individualismus, Gesellschaft, Machtstrukturen, Konflikt, Rezeption, Spanien, Dr. Stockmann, Anarchismus, Freiheitsbegriff,
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Ibsens Drama "Ein Volksfeind"?
Das Stück thematisiert den Konflikt zwischen dem Individuum (Dr. Stockmann) und der manipulierbaren Masse sowie die Korruption in einer bürgerlichen Gesellschaft.
War Henrik Ibsen ein Anarchist?
Ibsens "Anarchismus" war primär geistig-intellektuell; ihm ging es vor allem um die individuelle geistige Freiheit und nicht um politischen Umsturz.
Warum war das Stück in Spanien so erfolgreich?
Spanische Anarchisten sahen in Dr. Stockmann einen Verfechter ihrer Ideen, und das Stück kam den politischen Interessen der Sponsoren in Barcelona sehr entgegen.
Welche Rolle spielt die Figur des Dr. Stockmann?
Dr. Stockmann entdeckt eine Umweltverschmutzung und wird zum "Volksfeind", als er sich weigert, die Wahrheit aus wirtschaftlichen Interessen zu verschweigen.
Was kritisiert Ibsen am Bürgertum seiner Zeit?
Er kritisiert die "kompakte Majorität", die aus Bequemlichkeit und Profitgier moralische Werte opfert und den Fortschritt behindert.
- Quote paper
- Ursula Wojciechowski (Author), 1998, Henrik Ibsen: Ein Volksfeind, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164177