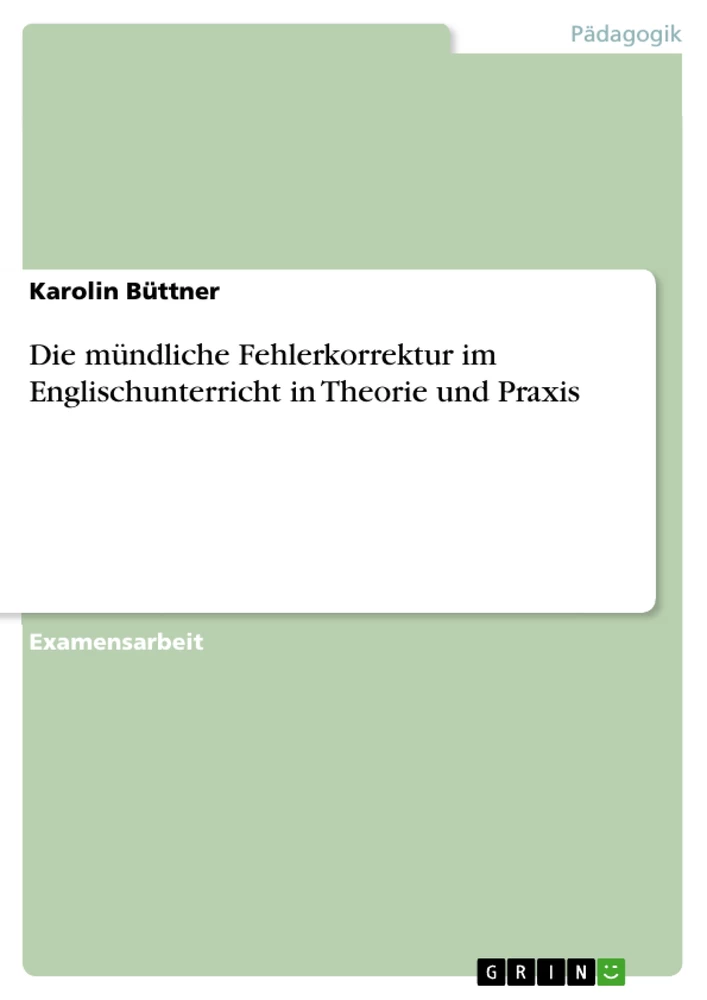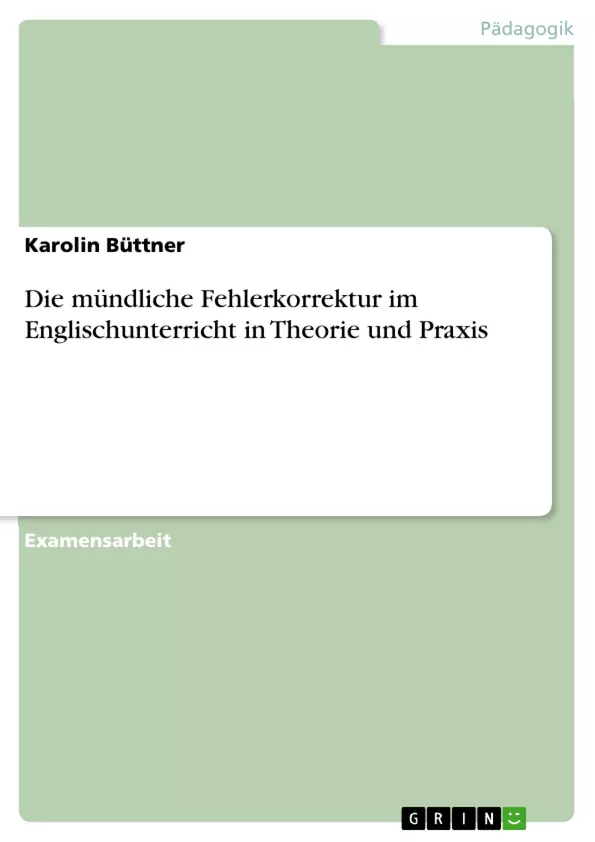The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one“ (Hubbard zit. nach Vetter 2007: 36). Dieses Zitat stammt von dem Schriftsteller und Verleger Elbert Hubbard und obwohl er im 19. Jahrhundert lebte, hat es immer noch seine Gültigkeit. Denn viele Schüler und Schülerinnen begehen diesen im Zitat erwähnten Fehler noch heute: Anstatt mündlich im Unterricht mitzuarbeiten, äußern sie sich lieber nicht in der Fremdsprache aus Angst, dass sie einen Fehler machen könnten. Jedoch wird die von der DESI-Studie konstatierte ‚Sprachlosigkeit’ im Unterricht nicht nur durch zeitliche und logistische Einschränkungen verursacht, sondern auch der Umgang mit Fehlern spielt dabei eine Rolle (Vetter 2007: 36). Wie Vetter schreibt, betrifft dies „einerseits die Sprachlerner und ihre Wahrnehmung der eigenen Leistung, andererseits aber die Fremdsprachenlehrkräfte, die mit ihrer Reaktion auf Feh-ler die Haltung der Lerner maßgeblich beeinflussen“ (Vetter 2007: 36). Lange Zeit herrschte bei Fachdidaktikern und Lehrern die Meinung, dass Fehler etwas Negatives und auf mangelnden Einsatz der Lernenden zurückzuführen und somit durch ständiges Verbessern auszumerzen seien. Dies stimmt aus heutiger Sicht jedoch nicht mehr. In der fachdidaktischen Literatur und Zweitspracherwerbsforschung besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass Fehler zum Lernprozess gehören und zeigen, dass Schüler Hypothesen über die zu lernende Sprache bilden, weshalb sie nicht als Defizite betrachtet werden dürfen, und dass sie Zwischenstufen auf dem Weg zur Zielsprache sind.
Inhaltsverzeichnis
- Verwendete Abkürzungen.
- Einleitung.
- I. Zweitspracherwerbshypothesen und Fehlerentstehungsfaktoren.
- 1. Fehlerdefinitionen.
- 2. Kontrastivhypothese.
- 2.1. Entstehung und Inhalte.
- 2.2. Kritik an der Kontrastivhypothese.
- 2.3. Fehlergenese.
- 3. Identitätshypothese.
- 3.1. Entstehung und Inhalt.
- 3.2. Kritik an der Identitätshypothese.
- 3.3. Fehlergenese.
- 4. Interlanguagehypothese.
- 4.1. Entstehung und Inhalt.
- 4.2. Fehlergenese.
- 4.3. Kritik an der Interlanguagehypothese.
- II. Die mündliche Fehlerdidaktik im Englischunterricht.
- 1. Formen der Reaktion auf Fehler.
- 2. Korrekturtypen.
- 3. Korrekturverhalten in Abhängigkeit von Lernstand, Unterrichtsphasen und anderen Bedingungen.
- III. Einstellung zu und Umgang mit mündlichen Fehlern bei Schülern und Lehrern in der Praxis - eine empirische Untersuchung.
- Schlusswort und Empfehlungen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der mündlichen Fehlerkorrektur im Englischunterricht. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen der mündlichen Fehlerkorrektur im Kontext des Zweitspracherwerbs zu beleuchten und diese Erkenntnisse mit der praktischen Anwendung in der Schule zu verbinden. Die Arbeit untersucht, welche Fehlerdefinitionen in der Forschungsliteratur vorherrschen, welche Hypothesen zur Erklärung von Fehlern im Spracherwerb relevant sind und wie die Reaktion auf Fehler im Unterricht erfolgen sollte. Die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, die die Einstellungen zu und den Umgang mit mündlichen Fehlern bei Schülern und Lehrern beleuchtet, werden mit den theoretischen Erkenntnissen verglichen.
- Fehlerdefinitionen im Spracherwerb
- Zweitspracherwerbshypothesen (Kontrastiv-, Identitäts-, Interlanguagehypothese)
- Formen der Reaktion auf Fehler im Unterricht
- Korrekturtypen und -verhalten in Abhängigkeit verschiedener Faktoren
- Empirische Untersuchung zur Einstellung zu und zum Umgang mit Fehlern in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Teil der Arbeit werden verschiedene Fehlerdefinitionen und die Entwicklung des Verständnisses des Fehlerbegriffs im Spracherwerb dargestellt. Die drei großen Hypothesen zur Erklärung von Fehlern im Zweitspracherwerb, die Kontrastiv-, Identitäts- und Interlanguagehypothese, werden vorgestellt und ihre Entstehung, Inhalte und Kritikpunkte beleuchtet. Der zweite Teil befasst sich mit der mündlichen Fehlerdidaktik im Englischunterricht. Es werden verschiedene Formen der Reaktion auf Fehler, wie Korrektur, Reparatur, Reformulation, Ignorieren, Missbilligen und Helfen, erläutert. Die unterschiedlichen Korrekturtypen, wie selbstinitiierte Selbst-/Fremdkorrektur oder fremdinitiierte Selbst-/Fremdkorrektur, werden anhand von Beispielen aus der Hospitationsphase erklärt und ihre Vor- und Nachteile beleuchtet. Der Einfluss verschiedener Faktoren, wie Lernstand, Unterrichtsphasen und Fehlerarten, auf das Korrekturverhalten wird untersucht. Der dritte Teil der Arbeit präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, die die Einstellung zu und den Umgang mit mündlichen Fehlern bei Schülern und Lehrern im Englischunterricht untersucht. Die Ergebnisse dieser Studie werden mit der Theorie der mündlichen Fehlerdidaktik und des Spracherwerbs verglichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen des Zweitspracherwerbs und der mündlichen Fehlerdidaktik im Englischunterricht. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe umfassen: Fehlerdefinitionen, Zweitspracherwerbshypothesen, Fehlerkorrektur, Korrekturtypen, Korrekturverhalten, empirische Untersuchung, Schüler- und Lehrerperspektive.
- Arbeit zitieren
- Karolin Büttner (Autor:in), 2010, Die mündliche Fehlerkorrektur im Englischunterricht in Theorie und Praxis, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164193