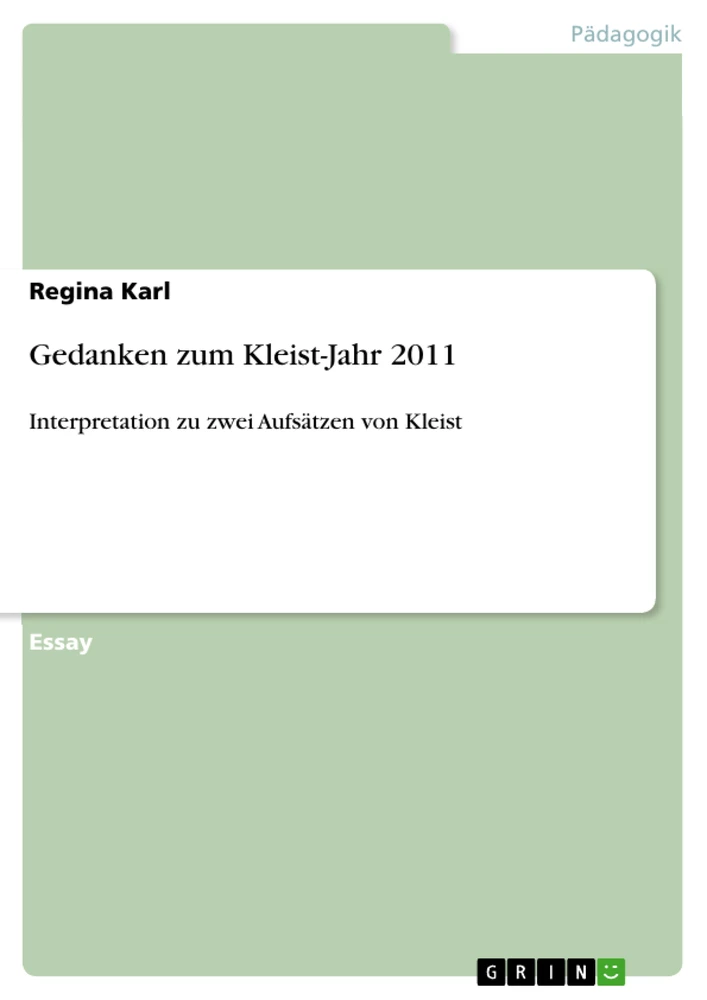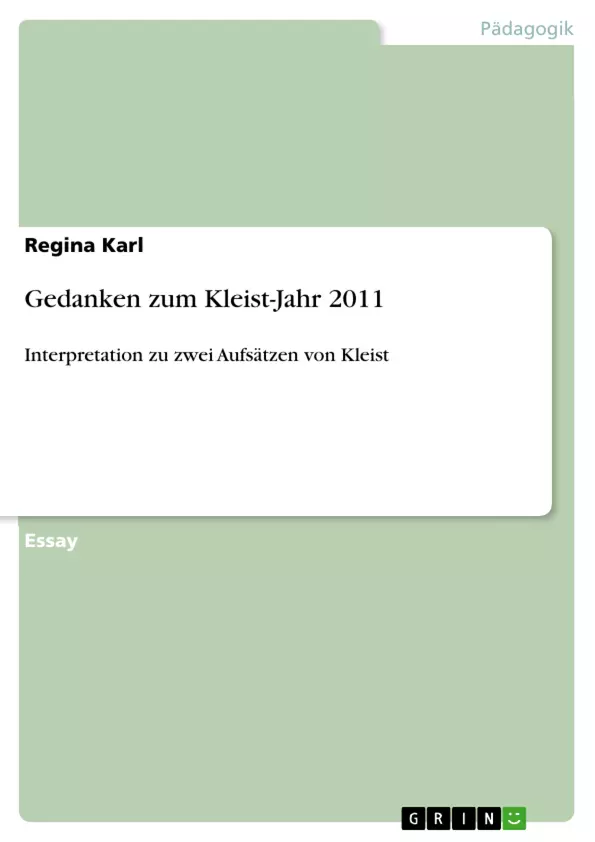Der vorliegende Text beschäftigt sich insbesondere mit der Person Heinrich von Kleist, dessen 200. Todestag 2011 gedacht wird. Behandelt werden zwei seiner Texte, welche eher unbekannt sind aber dennoch eine große und tiefgreifende Ausdruckskraft besitzen. Wer war Kleist – als Mensch und als Autor. Was können wir von seinen gedanklichen Werken profitieren. Bringt es uns heute noch einen Nutzen, sich damit zu beschäftigen? Eine Interpretation und ein Essay geben darüber Auskunft und bemühen sich, eine gedankliche Brücke aus der Zeit von Kleist bis in unsere heutige Zeit zu bauen. – Regina Karl.
Inhaltsverzeichnis
- Die Betrachtungen über den Weltlauf (Interpretation)
- Kleist als Mensch und Verfasser der Betrachtungen über den Weltlauf
- Die Bedeutung der ,,Betrachtungen über den Weltlauf"
- Die Außenseiter (ein Essay über das,,Marionettentheater\" von Kleist)
- Kleist ein Außenseiter seiner Zeit.
- Wissenschaft ist nichts – der Geist ist alles
- Die Marionetten und das Theater drum herum.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit der Person Heinrich von Kleist und analysiert zwei seiner weniger bekannten Werke, die „Betrachtungen über den Weltlauf“ und das „Marionettentheater“. Die Analyse untersucht die Bedeutung dieser Werke im Kontext von Kleists Leben und Werk sowie deren Relevanz für heutige Zeit.
- Kleists Lebensweg und die Suche nach geistigen Werten
- Die Kritik an der Wissenschaft und dem Symbolismus
- Die Bedeutung von Kunst und Kultur in Kleists Werk
- Kleist als Außenseiter und die Rolle des Individuums in der Gesellschaft
- Die Relevanz von Kleists Gedanken für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die „Betrachtungen über den Weltlauf“ von Heinrich v. Kleist
Dieses Kapitel untersucht Kleists „Betrachtungen über den Weltlauf“ und analysiert die Persönlichkeit des Autors im Kontext dieses Textes. Kleist zeigt in dem Aufsatz eine beeindruckende Wahrnehmungsgabe und Sensibilität, die ihn schon in jungen Jahren dazu bringt, die Unwirksamkeit von Regeln in einer Gesellschaft zu erkennen, in der die Herzen der Menschen diese ignorieren. Die Reife und Größe, die Kleist in seinen Werken zum Ausdruck bringt, erklären seine Rolle als Außenseiter seiner Zeit, die ihn auch in der jüngsten Vergangenheit als bedeutende Persönlichkeit der deutschen Literatur auszeichnete.
Kleist sucht mit 22 Jahren nach einem „festen und verbindlichen Lebensplan“, den er im Militär, welches ihm seine Eltern vorgegeben hatten, nicht findet. Seine Suche nach geistigen Werten führt ihn zur Rechtswissenschaft, vielleicht getrieben von seinem Verlangen nach Gerechtigkeit, und zur Naturwissenschaft, insbesondere zur Mathematik.
Kleists Streben nach geistig „endgültigen“ Antworten führt ihn auch in die Philosophie. Sein lebenslanges Streben nach geistigen Werten wird oft mit einem „unsteten Lebenswandel“ gleichgesetzt, doch ist dies nicht gerechtfertigt? Stellt nicht jeder Mensch, der sich auf der Suche befindet, eine stete Unstetheit dar?
Kleists Glaube an seine Ideale erfährt ab 1801 eine tiefe Erschütterung, die als Kant-Krise bekannt ist. Kants rationale Vernunft-Kritiken passen nicht zu Kleists Idealismus und Sensibilität.
Kleists spätere Anstellung im Finanzministerium deutet auf sein fortwährendes Streben nach verbindlichen Werten und Normen hin. Trotz der finanziellen Sicherheit bleibt sein geistiger Hunger ungestillt.
Kleists Selbstmord könnte auf die Summe aller Ereignisse zurückzuführen sein, die sein Leben erschütterten, darunter:
- Das Militär, welches zwar feste Normen bot, aber freies Denken verbot.
- Die lebenslange und vergebliche Suche nach geistigen Normen und Werten, die weit über das hinausgingen, was die Welt des 18. und 19. Jahrhunderts zu bieten hatte.
- Die menschliche Unvollkommenheit, die für Reibereien und Missverständnisse sorgte.
- Der gesundheitliche Zusammenbruch seiner Psyche.
- Die Überbewertung menschlich geschaffener Normen als „verbindliche Normen“ und die Erkenntnis, dass fehlerhafte Menschen nur Fehlerhaftes hervorbringen können.
Kleists Leben und Denken als Lehrbeispiel und Botschaft für eine menschlichere Zukunft zu verstehen, sollte ein dringliches Bedürfnis sein.
Die Bedeutung der „Betrachtungen über den Weltlauf“ von H. v. Kleist
Die „Betrachtungen über den Weltlauf“ sind ein sehr kurzes Werk, aber Kleist bringt in seinen knappen Gedanken tiefgreifende Wahrheiten zum Ausdruck. Kleist kritisiert die Wissenschaft seiner Zeit, die sich als „Wissenschaft der Tugend“ sieht und nach Symbolismus strebt, der seiner Meinung nach aus der Kunst, der „höchsten Stufe menschlicher Kultur“, stammt. Kleist verweist dabei auf die Antike, welche als „höchste, die erschwungen werden kann“ bezeichnet wird.
Kleist beschreibt im zweiten Abschnitt des letzten Satzes den Verfall menschlicher Ideale und Werte, der auch auf unsere heutige Zeit passt:
- „als sie in keiner menschlichen und bürgerlichen Tugend mehr Helden hatten, dichteten sie welche“
- „als sie keine mehr dichten konnten, erfanden sie dafür Regeln“
- „als sie sich in den Regeln verwirrten, abstrahierten sie die Weltweisheit selbst“
- „und als sie damit fertig waren, wurden sie schlecht“
Schlüsselwörter
Kleists Werk beschäftigt sich mit Themen wie der Suche nach geistigen Werten, der Kritik an der Wissenschaft und dem Symbolismus, der Bedeutung von Kunst und Kultur, dem Individuum in der Gesellschaft und der Relevanz seiner Gedanken für die heutige Zeit. Wichtige Konzepte sind die menschliche Unvollkommenheit, das Streben nach Ordnung und die Frage nach dem Sinn des Lebens.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Heinrich von Kleist?
Ein bedeutender deutscher Dramatiker und Erzähler, der als Außenseiter seiner Zeit galt und zeitlebens nach festen geistigen Werten suchte.
Was ist das Thema der „Betrachtungen über den Weltlauf“?
In diesem kurzen Werk kritisiert Kleist den Verfall menschlicher Ideale und die Unfähigkeit der Wissenschaft, wahre Tugend zu vermitteln.
Was versteht man unter der „Kant-Krise“ bei Kleist?
Eine tiefe Erschütterung seines Weltbildes durch Kants Philosophie, die ihn an der Erkennbarkeit der Wahrheit zweifeln ließ.
Welche Bedeutung hat das „Marionettentheater“?
Es ist ein Essay über Anmut, Bewusstsein und die Frage, wie der Mensch nach dem Verlust der Unschuld wieder zu einer höheren Harmonie finden kann.
Warum sind Kleists Gedanken heute noch relevant?
Seine Kritik an starren Regeln und seine Suche nach individueller Wahrheit und menschlicher Gerechtigkeit sind zeitlose Themen.
- Quote paper
- Regina Karl (Author), 2011, Gedanken zum Kleist-Jahr 2011, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164327