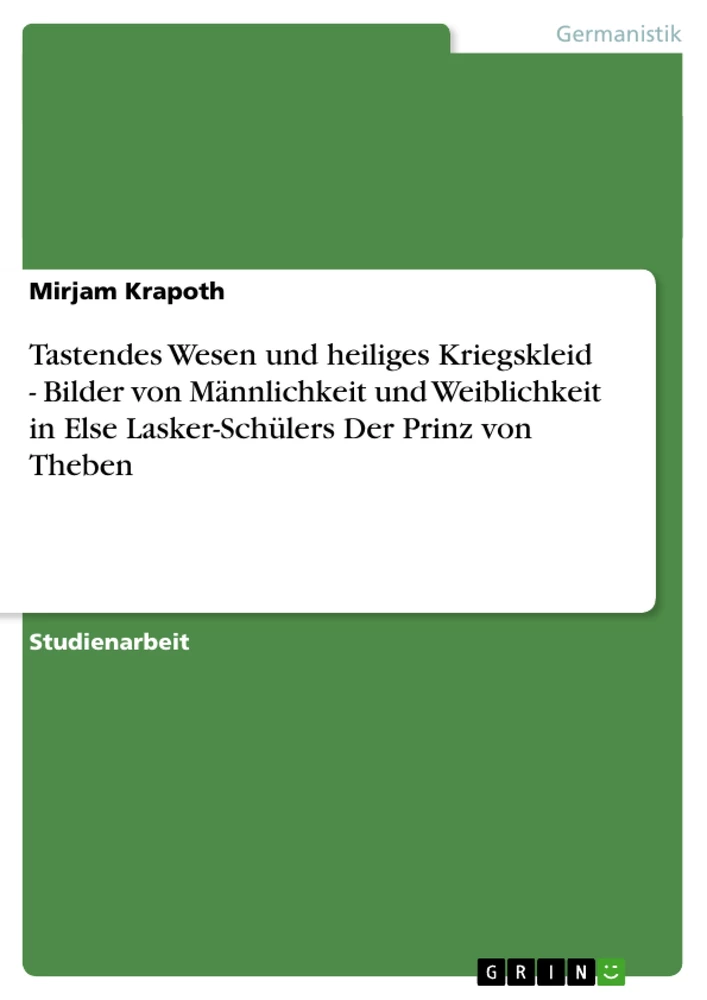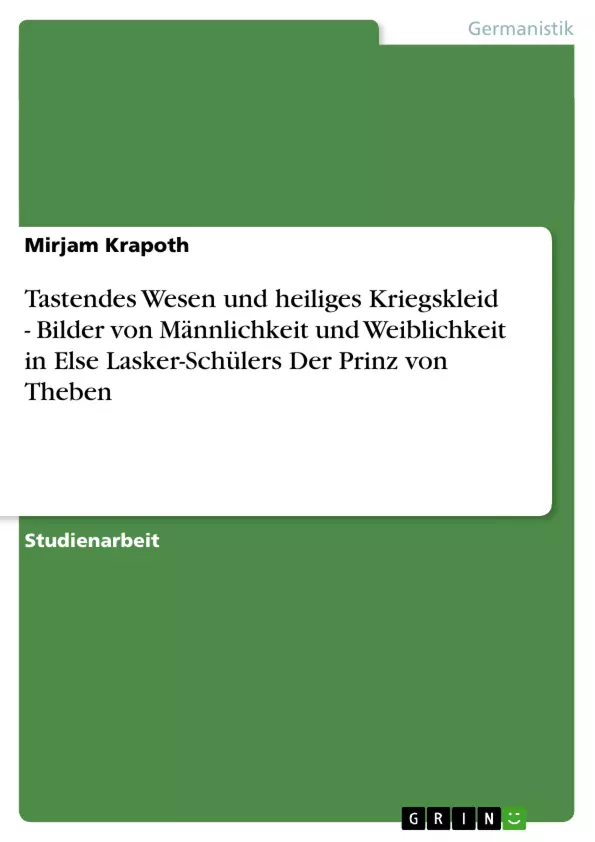„Mein Vater hat mir schon so oft die Geschichte aus dem Leben meines Urgroßvaters
erzählt, ich glaube nun, ich habe sie selbst erlebt.“: So beginnt Der Prinz von Theben, den
Else Lasker-Schüler (1869-1945) im Jahre 1914 schrieb. Sie malt in elf Erzählungen Bilder
von orientalischen Palästen, von Melechs und Oberpriestern, Haremsfrauen und
verschleierten Prinzessinnen, von Hochzeiten, blutigen Feiertagen und Liedern in fremden
Sprachen. In „Der Scheik“ wird die Beziehung zwischen einem muslimischen und einem
jüdischen Herrscher geschildert, die über die Grenzen ihrer Religionen hinweg befreundet
sind. „Tschandragupta“ ist die Geschichte eines heidnischen Häuptlingssohnes, der nach
Jericho kommt und sich bemüht, von den dort lebenden Menschen aufgenommen zu werden.
„Der Derwisch“ berichtet von den blutigen Geschehnissen an einem muslimischen Feiertag in
Kairo. In „Ein Brief meiner Base Schalôme“ schreibt diese über ihre Erlebnisse im Palast
ihres Großonkels in Konstantinopel, besonders mit den Frauen und dem Eunuchen des
Harems. Die nächste Geschichte, „Der Fakir“, spielt am Hofe des Emirs von Afghanistan. Die
Ich-Erzählerin ist dort zu Besuch und begegnet ihren drei Kusinen. Hierauf folgt das „Buch
der drei Abigails“, drei aufeinanderfolgender Herrscher von Theben. Hierzu gehören auch die
nächsten beiden kurzen Abschnitte „Singa, die Mutter des toten Melechs des Dritten“ und
„Eine Begebenheit aus dem Leben Abigail des Liebenden“. Den Schluß des Buches bildet
„Der Kreuzfahrer“, eine Erzählung über die christlichen Kreuzfahrer und ihre muslimischen
Widersacher in Jerusalem.
Diese kurze Zusammenfassung zeigt schon die Schwierigkeit auf, den Inhalt der
Geschichten konkret und faßbar zu machen. Es geht hier weniger um Ereignisse und Fakten,
als vielmehr um Sinneseindrücke, Stimmungen, Farben, Begierden. Was allen Erzählungen
gemeinsam ist, sind die Grenzen, die durch die traumähnliche Wirklichkeit, welche die
Dichterin erschafft, hindurchlaufen. Es sind Grenzen zwischen Erwartungen und ihrer
(Nicht-)Erfüllung, zwischen Religionen und Völkern, zwischen Menschen und Menschen.
Diese Grenzlinien können einengen, beschränken, Leben vernichten, und manchmal werden
sie auch überschritten. Solche Grenzüberschreitungen werden innerhalb des Textes gewagt,
aber auch der Text selbst stellt eine Grenzüberschreitung dar: [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konstruktionen von geschlechtlicher Identität im Prinzen von Theben
- Männlichkeit: „sein Wesen so liebevoll tastend“
- Weiblichkeit: sie „entfaltet ihr Angesicht“
- Die Erzählinstanz: „nie zog eine Prinzessin in die Schlacht“
- Sexualität: da „trafen sie sich einmal als junge Kinder und liebten sich“
- Vergleich mit Konstruktionen von geschlechtlicher Identität in sexualwissenschaftlichen Theorien um 1900
- Sigmund Freud: Infantile Sexualität
- Otto Weininger: Grenzen zwischen den Menschen
- Richard von Krafft-Ebing: Naturtrieb und Entwicklung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konstruktion von Männlichkeit und Weiblichkeit in Else Lasker-Schülers "Der Prinz von Theben". Ziel ist es, die Darstellung von Männern und Frauen, ihre zugeschriebenen Eigenschaften und Rollen, sowie die Rolle der Erzählinstanz zu analysieren. Ein weiterer Fokus liegt auf der Darstellung von Sexualität und den damit verbundenen Wertungen.
- Konstruktion von Männlichkeit und Weiblichkeit in Lasker-Schülers Werk
- Rolle der Erzählinstanz und ihre Perspektive
- Darstellung von Sexualität und deren Bedeutung
- Vergleich mit zeitgenössischen sexualwissenschaftlichen Theorien
- Grenzüberschreitungen und die traumähnliche Wirklichkeit in den Erzählungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in Else Lasker-Schülers "Der Prinz von Theben" ein und beschreibt kurz den Inhalt der elf Erzählungen, die sich durch ihre sinnlichen Eindrücke, Stimmungen und die Darstellung von Grenzen zwischen Erwartungen, Religionen und Menschen auszeichnen. Die Einleitung betont die Schwierigkeit, den Inhalt konkret zusammenzufassen, da es eher um Sinneseindrücke als um konkrete Ereignisse geht. Sie hebt die traumähnliche Wirklichkeit hervor und deutet auf die zentrale Rolle von Grenzüberschreitungen hin, sowohl innerhalb des Textes als auch des Textes selbst im Kontext der literarischen Konventionen. Die Einleitung zitiert Judith Kuckart, um die besondere, "mystische" und "hysterische" Sprache Lasker-Schülers zu charakterisieren und legt den Fokus der Arbeit auf die Konstruktion von Männlichkeit und Weiblichkeit im Text und deren Vergleich mit zeitgenössischen Theorien.
Konstruktionen von geschlechtlicher Identität im Prinzen von Theben: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit in den Erzählungen. Es untersucht die Eigenschaften, Verhaltensweisen und Rollen, die Lasker-Schüler Männern und Frauen zuschreibt, und beleuchtet die Interaktionen der Figuren. Die Rolle der Erzählinstanz und ihre Perspektive auf die geschlechtlichen Identitäten werden ebenfalls analysiert, ebenso wie die Darstellung von Sexualität und die damit verbundenen Wertungen. Der Abschnitt bietet eine detaillierte Interpretation der verschiedenen Facetten der Geschlechterrollen und deren Zusammenhang mit der Gesamtkomposition des Werkes.
Vergleich mit Konstruktionen von geschlechtlicher Identität in sexualwissenschaftlichen Theorien um 1900: Dieses Kapitel vergleicht die im "Prinzen von Theben" dargestellten Konstruktionen von geschlechtlicher Identität mit den Theorien von Sigmund Freud, Otto Weininger und Richard von Krafft-Ebing. Es untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den theoretischen Ansätzen und der poetischen Darstellung in Lasker-Schülers Werk. Ziel ist es, die Position des "Prinzen von Theben" innerhalb des zeitgenössischen Diskurses über Sexualität und Geschlecht zu bestimmen und die Eigenständigkeit von Lasker-Schülers Ansatz herauszuarbeiten.
Schlüsselwörter
Else Lasker-Schüler, Der Prinz von Theben, Männlichkeit, Weiblichkeit, Geschlechterrollen, Sexualität, Erzählinstanz, sexualwissenschaftliche Theorien, Freud, Weininger, Krafft-Ebing, Grenzüberschreitung, Traum, poetische Sprache.
Häufig gestellte Fragen zu Else Lasker-Schülers "Der Prinz von Theben"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Konstruktion von Männlichkeit und Weiblichkeit in Else Lasker-Schülers "Der Prinz von Theben". Sie untersucht die Darstellung von Männern und Frauen, ihre zugeschriebenen Eigenschaften und Rollen, die Rolle der Erzählinstanz und die Darstellung von Sexualität und den damit verbundenen Wertungen. Ein Vergleich mit zeitgenössischen sexualwissenschaftlichen Theorien (Freud, Weininger, Krafft-Ebing) wird ebenfalls durchgeführt.
Welche Themen werden im "Prinzen von Theben" behandelt?
Die elf Erzählungen des "Prinzen von Theben" zeichnen sich durch sinnliche Eindrücke, Stimmungen und die Darstellung von Grenzen zwischen Erwartungen, Religionen und Menschen aus. Die Arbeit betont die traumähnliche Wirklichkeit und die zentrale Rolle von Grenzüberschreitungen, sowohl im Text selbst als auch im Kontext literarischer Konventionen. Die Konstruktion von Männlichkeit und Weiblichkeit, die Rolle der Erzählinstanz und die Darstellung von Sexualität stehen im Mittelpunkt der Analyse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Analyse der geschlechtlichen Identität im "Prinzen von Theben", ein Kapitel zum Vergleich mit sexualwissenschaftlichen Theorien um 1900 und einen Schluss. Die Einleitung beschreibt den Inhalt und die Besonderheiten des Werkes. Das Hauptkapitel analysiert die Darstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit, die Rolle der Erzählinstanz und die Darstellung von Sexualität. Das Vergleichskapitel setzt die literarische Darstellung in Beziehung zu den Theorien von Freud, Weininger und Krafft-Ebing.
Welche Aspekte der Geschlechterrollen werden untersucht?
Die Analyse untersucht die Eigenschaften, Verhaltensweisen und Rollen, die Lasker-Schüler Männern und Frauen zuschreibt. Sie beleuchtet die Interaktionen der Figuren und die Perspektive der Erzählinstanz auf die geschlechtlichen Identitäten. Die Darstellung von Sexualität und die damit verbundenen Wertungen werden detailliert interpretiert.
Welche sexualwissenschaftlichen Theorien werden herangezogen?
Die Arbeit vergleicht die im "Prinzen von Theben" dargestellten Konstruktionen von geschlechtlicher Identität mit den Theorien von Sigmund Freud, Otto Weininger und Richard von Krafft-Ebing. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den theoretischen Ansätzen und der poetischen Darstellung werden untersucht, um die Position des Werkes im zeitgenössischen Diskurs über Sexualität und Geschlecht zu bestimmen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Else Lasker-Schüler, Der Prinz von Theben, Männlichkeit, Weiblichkeit, Geschlechterrollen, Sexualität, Erzählinstanz, sexualwissenschaftliche Theorien, Freud, Weininger, Krafft-Ebing, Grenzüberschreitung, Traum, poetische Sprache.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Die konkreten Schlussfolgerungen sind in der bereitgestellten Textvorlage nicht explizit formuliert und müssten aus der vollständigen Arbeit entnommen werden.) Die Arbeit zielt darauf ab, die Konstruktion von Geschlecht in Lasker-Schülers Werk zu analysieren und im Kontext der zeitgenössischen Debatten zu Sexualität und Geschlecht zu verorten.
- Quote paper
- Mirjam Krapoth (Author), 2003, Tastendes Wesen und heiliges Kriegskleid - Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit in Else Lasker-Schülers Der Prinz von Theben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16434