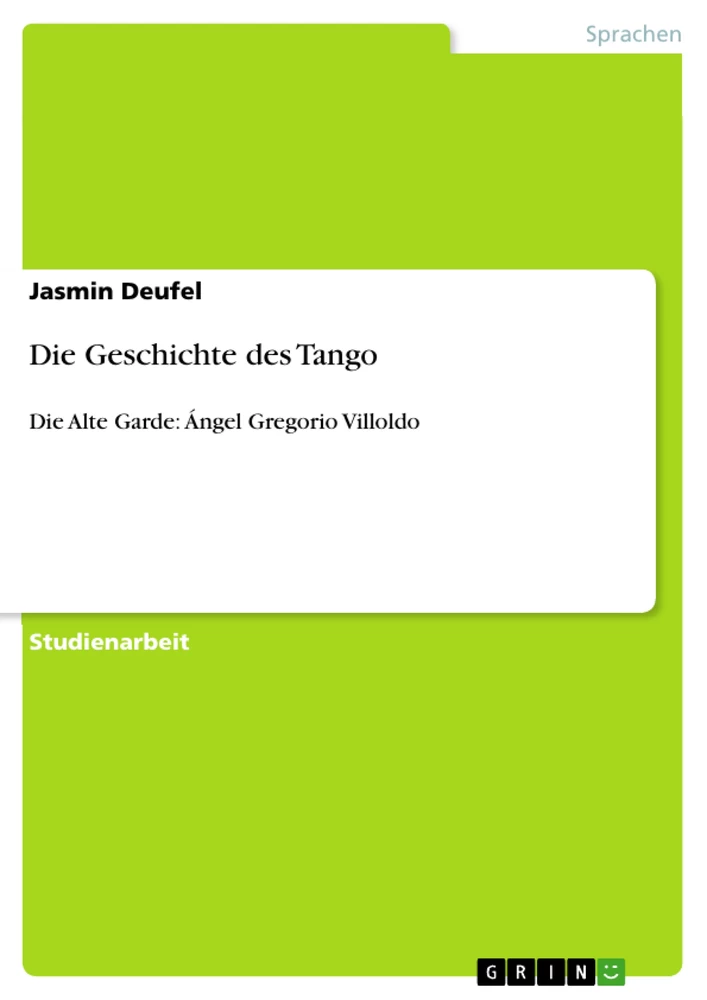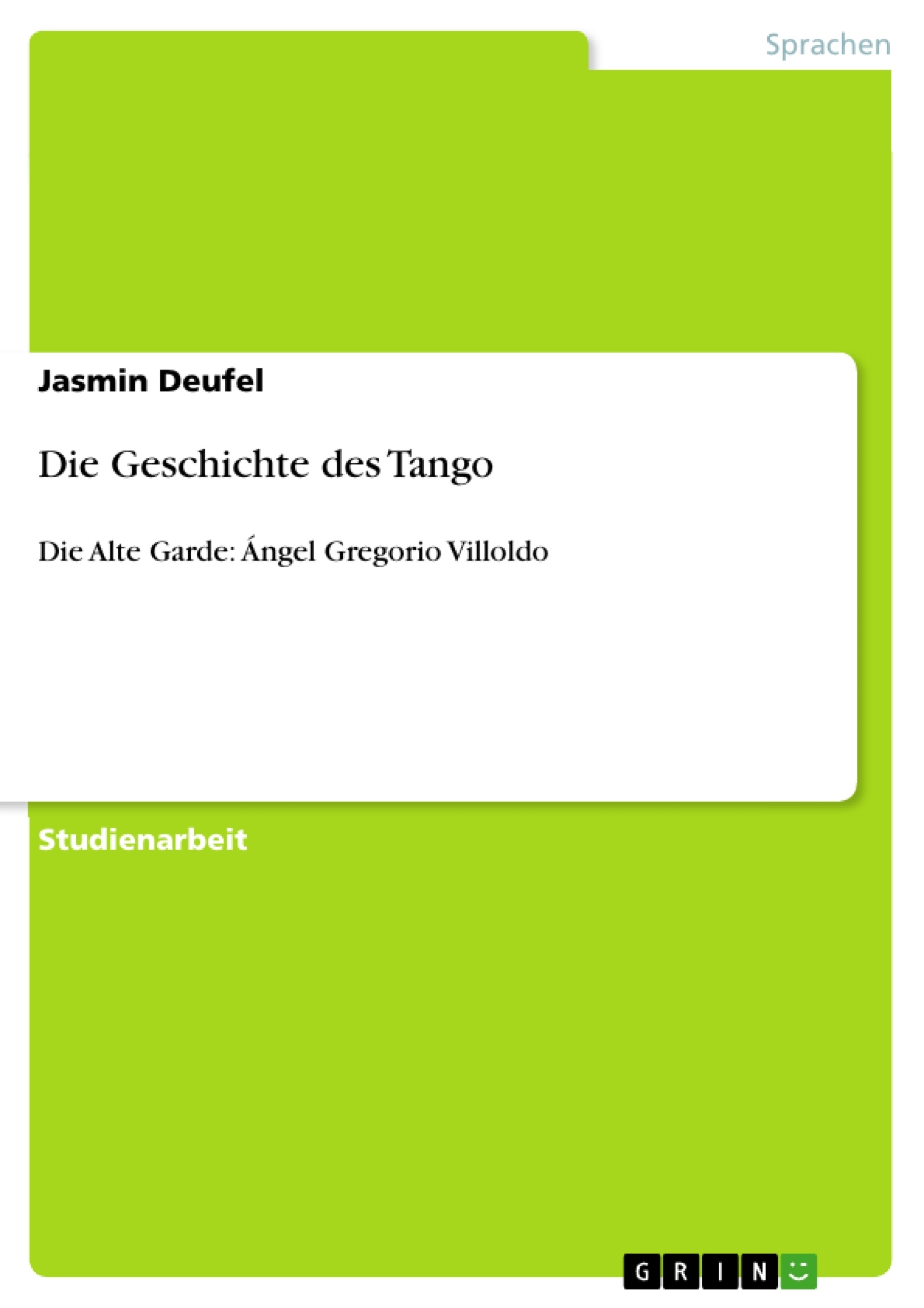Der Tango ist der Inbegriff für Argentiniens Kultur. Er erzählt die Geschichte des Landes, vor allem die der Hauptstadt Buenos Aires, und dessen Gesellschaft.
Der Mehrheit der Deutschen dürfte der Tango vorwiegend als Tanz geläufig sein. Dies stellt aber nur einen Teil seiner möglichen Ausdrucksformen dar, denn er hat sich im Verlauf der Zeit in weiteren Ausprägungen manifestiert: anfänglich war er ein Musikstil mit spontan gedichteten Texten, sowie ein improvisierter Tanz und erst im Lauf der Zeit setzte sich ebenfalls
das Tangolied durch, das sich durch feste Liedtexte auszeichnete.
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Frühzeit des Tango, der sogenannten Alten Garde, die während der Jahre 1895 – 1917 eingeordnet wird, und deren Hauptvertreter Ángel Gregorio Villoldo. Als Pionier des Tango repräsentiert er die Anfangsgeschichte des Tango wie kein anderer und erhielt so den Ehrennahmen ‘papá del tango criollo’.
Mit dieser Arbeit soll ein umfassender Einblick in den sozialen Kontext des damaligen Buenos Aires gegeben werden und auch die Entwicklungsbedingungen für den Tango dargelegt werden. Argentinien ist stark durch eine außergewöhnliche Einwanderungsgeschichte geprägt,die die Entfaltung des Tango auf diese Weise erst möglich machte. Der frühe Tango ist vor allem Ausdruck großer Sehnsucht der Immigranten.
Während seiner Entstehung wirkten verschiedene Einflüsse von Tänzen und Musikstilen auf den Tango ein. Hierzu zählen der Candombe der in Buenos Aires und Montevideo lebenden Afrokreolen, die Milonga mit argentinischem Ursprung, die aus Kuba stammende Habanera
und der südspanische Tango andaluz.
Außerdem wird auf die Frage eingegangen,inwiefern der Ruf des Tango als Kind des Bordells und Rotlichtmilieus berechtigt ist. Entstand er in den düsteren Winkeln von Buenos Aires oder wurde er vielleicht absichtlich aufgrund der strengen moralischen Auffassung seiner
Kritiker diffamiert? Fest steht, dass der Tango ein soziales Erzeugnis der rioplatensischen Vorstadt ist und sich langsam Anerkennung in ganz Argentinien verschafft hat, wozu die beliebten
Werke von Ángel G. Villoldo einen großen Teil beitrugen. El Porteñito und La Morocha sind zwei berühmte Tango von Villoldo, die später näher als Beispiele seines Schaffens betrachtet werden. Die Leistung für den Tango des facettenreiche Künstlers soll ausführlich
geschildert werden und somit ein Eindruck über die Entstehungsgeschichte des Tango gewährt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist der Tango?
- 2.1 Definition
- 2.2 Etymologie
- 3. Historische Entwicklung des Tango
- 3.1 Entstehung und Hintergründe
- 3.1.1 Ursprünge
- 3.1.2 Leben im arrabal und dessen conventillos
- 3.1.3 Tango als ein 'reptil de lupanar'?
- 3.1.4 Frauenmangel in Buenos Aires
- 3.2 Phasen der Entwicklung
- 3.2.1 Vor 1895
- 3.2.2 Alte Garde: 1895 – 1917
- 3.2.3 Neue Garde: ab ca. 1924
- 4. Einflüsse während der Entwicklung zum Tango
- 4.1 Candombe
- 4.2 Milonga
- 4.3 Habanera
- 4.4 Tango andaluz
- 5. Die Alte Garde und Ángel G. Villoldo
- 5.1 Bedeutung
- 5.2 Vertreter
- 5.3 Texte
- 6. Der 'papá del tango criollo': Ángel G. Villoldo
- 6.1 Leben (*1868/69 – †1919)
- 6.2 Pionier in Schallplatten- und Filmaufnahmen
- 6.3 Schlussbemerkung
- 7. Tango im Hafenviertel von Buenos Aires
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen umfassenden Einblick in die Entstehung und Entwicklung des Tango in der Frühzeit, der sogenannten Alten Garde (1895-1917), zu geben, mit besonderem Fokus auf Ángel Gregorio Villoldo als zentralen Vertreter dieser Epoche. Die Arbeit beleuchtet den sozialen Kontext des damaligen Buenos Aires und die Einflüsse verschiedener Tänze und Musikstile auf die Entwicklung des Tango.
- Soziale Bedingungen in Buenos Aires während der Entstehung des Tango
- Einflüsse verschiedener Musikstile und Tänze auf den Tango
- Die Rolle von Ángel Gregorio Villoldo in der Entwicklung des Tango
- Der Tango als soziales Produkt und Ausdruck der Immigrantenerfahrung
- Die Debatte um den Ruf des Tango als "Kind des Bordells"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Tango als zentralen Bestandteil der argentinischen Kultur vor und hebt dessen Vielschichtigkeit hervor – als Tanz, Musik und Lied. Sie fokussiert sich auf die Alte Garde (1895-1917) und Ángel Gregorio Villoldo als deren wichtigsten Vertreter. Die Arbeit zielt darauf ab, den sozialen Kontext in Buenos Aires während der Tango-Entstehung zu beleuchten und die Einflüsse verschiedener Kulturen und Musikstile aufzuzeigen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Einwanderungsgeschichte Argentiniens und deren Einfluss auf den Tango.
2. Was ist der Tango?: Dieses Kapitel definiert den Tango zunächst anhand von Lexikon-Einträgen, die jedoch nur den Aspekt des Tanzes berücksichtigen. Es betont die weiteren Ausprägungen als Musikform und Lied. Die Etymologie des Wortes "Tango" wird diskutiert, wobei verschiedene Theorien vorgestellt werden, die von lateinamerikanischen, spanischen, afrikanischen und Bantu-Wurzeln ausgehen. Die Unsicherheit über den genauen Ursprung wird explizit hervorgehoben.
3. Historische Entwicklung des Tango: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung und Entwicklung des Tango im Kontext der starken Bevölkerungsexplosion in Argentinien im 19. Jahrhundert, die durch eine gezielte Einwanderungspolitik bedingt war. Es beleuchtet den wirtschaftlichen Aufstieg Argentiniens und die Zusammensetzung der Einwanderungswellen. Es werden die verschiedenen Phasen der Tango-Entwicklung bis zur Neuen Garde vorgestellt und verschiedene Einflüsse wie Candombe, Milonga, Habanera und Tango Andaluz genannt. Der kontroverse Ruf des Tangos als Produkt des Bordells wird ebenfalls angesprochen.
4. Einflüsse während der Entwicklung zum Tango: Dieses Kapitel detailliert die verschiedenen Einflüsse auf die Entwicklung des Tango, darunter Candombe, Milonga, Habanera und Tango Andaluz. Es geht auf die jeweiligen Ursprünge und die Art und Weise ein, wie diese musikalischen und tänzerischen Stile in den Tango integriert wurden, und wie sie zu seinem einzigartigen Charakter beitrugen. Es wird analysiert, wie diese Verschmelzung verschiedener kultureller Elemente die Identität des Tangos prägte.
5. Die Alte Garde und Ángel G. Villoldo: Kapitel 5 stellt die "Alte Garde" des Tango vor und präsentiert Ángel G. Villoldo als wichtigen Vertreter dieser Epoche. Es wird die Bedeutung der "Alten Garde" für die Entwicklung des Tango erläutert, und die Rolle Villoldos als Pionier hervorgehoben. Die verschiedenen Aspekte seines künstlerischen Schaffens werden angerissen, um einen Einblick in seine Beiträge zur Tango-Musik zu geben.
6. Der 'papá del tango criollo': Ángel G. Villoldo: Dieses Kapitel widmet sich ausführlich dem Leben und Werk von Ángel G. Villoldo, der als "Vater des criollo-Tangos" bezeichnet wird. Es skizziert sein Leben, seine Bedeutung als Pionier in Schallplatten- und Filmaufnahmen und seine herausragende Rolle in der Entwicklung des Tango. Seine Kompositionen, wie "El Porteñito" und "La Morocha", werden als Beispiele für sein künstlerisches Schaffen erwähnt.
7. Tango im Hafenviertel von Buenos Aires: Dieses Kapitel beleuchtet die Verbindung zwischen dem Tango und dem Hafenviertel von Buenos Aires, dem Ort seiner Entstehung. Es untersucht den sozialen Kontext, die kulturelle Mischung und die atmosphärischen Bedingungen, die die Entwicklung des Tangos prägten. Es zeigt den Tango als Spiegelbild der sozialen und kulturellen Realitäten des Hafenviertels.
Schlüsselwörter
Tango, Alte Garde, Ángel Gregorio Villoldo, Buenos Aires, Argentinien, Einwanderung, soziale Bedingungen, Musikeinflüsse, Candombe, Milonga, Habanera, Tango Andaluz, Entwicklung des Tango, soziale Geschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text über den Tango und Ángel G. Villoldo
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über die Entstehung und Entwicklung des Tangos in seiner Frühzeit, der sogenannten „Alten Garde“ (1895-1917), mit besonderem Fokus auf Ángel Gregorio Villoldo als zentralen Vertreter dieser Epoche. Er beleuchtet den sozialen Kontext des damaligen Buenos Aires und die Einflüsse verschiedener Tänze und Musikstile auf die Entwicklung des Tangos.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: die Definition des Tangos (Tanz, Musik, Lied), seine Etymologie, die historische Entwicklung in verschiedenen Phasen, die sozialen Bedingungen in Buenos Aires während der Entstehung des Tangos, die Einflüsse verschiedener Musikstile (Candombe, Milonga, Habanera, Tango Andaluz), die Rolle von Ángel Gregorio Villoldo in der Entwicklung des Tangos, der Tango als soziales Produkt und Ausdruck der Immigrantenerfahrung und die Debatte um den Ruf des Tangos als „Kind des Bordells“.
Wer ist Ángel Gregorio Villoldo und welche Rolle spielt er im Text?
Ángel Gregorio Villoldo wird im Text als „papá del tango criollo“ (Vater des criollo-Tangos) bezeichnet und als zentraler Vertreter der Alten Garde des Tangos präsentiert. Der Text beleuchtet sein Leben, sein Wirken als Pionier in Schallplatten- und Filmaufnahmen und seine herausragende Rolle in der Entwicklung des Tangos. Seine Bedeutung für die Entwicklung des Genres wird ausführlich dargestellt.
Welche Einflüsse hatten andere Musikstile auf den Tango?
Der Text beschreibt detailliert den Einfluss von Candombe, Milonga, Habanera und Tango Andaluz auf die Entwicklung des Tangos. Er analysiert, wie diese musikalischen und tänzerischen Stile in den Tango integriert wurden und zu seinem einzigartigen Charakter beitrugen. Die Verschmelzung verschiedener kultureller Elemente und deren Einfluss auf die Identität des Tangos wird untersucht.
Wie wird der soziale Kontext der Entstehung des Tangos dargestellt?
Der Text beleuchtet die sozialen Bedingungen in Buenos Aires während der Entstehung des Tangos, insbesondere die starke Bevölkerungsexplosion durch Einwanderung, den wirtschaftlichen Aufstieg Argentiniens und die Zusammensetzung der Einwanderungswellen. Er zeigt den Tango als Spiegelbild der sozialen und kulturellen Realitäten, besonders im Hafenviertel von Buenos Aires.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es jeweils?
Der Text ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung (Einführung in das Thema), Was ist der Tango? (Definition und Etymologie), Historische Entwicklung des Tango (Entstehung und verschiedene Phasen), Einflüsse während der Entwicklung zum Tango (detaillierte Beschreibung der Einflüsse anderer Stile), Die Alte Garde und Ángel G. Villoldo (Einführung in die Alte Garde und Villoldos Bedeutung), Der 'papá del tango criollo': Ángel G. Villoldo (ausführliche Darstellung von Villoldos Leben und Werk) und Tango im Hafenviertel von Buenos Aires (Zusammenhang zwischen Tango und Hafenviertel).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text am besten?
Schlüsselwörter, die den Text beschreiben, sind: Tango, Alte Garde, Ángel Gregorio Villoldo, Buenos Aires, Argentinien, Einwanderung, soziale Bedingungen, Musikeinflüsse, Candombe, Milonga, Habanera, Tango Andaluz, Entwicklung des Tango, soziale Geschichte.
- Quote paper
- Jasmin Deufel (Author), 2010, Die Geschichte des Tango, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164342