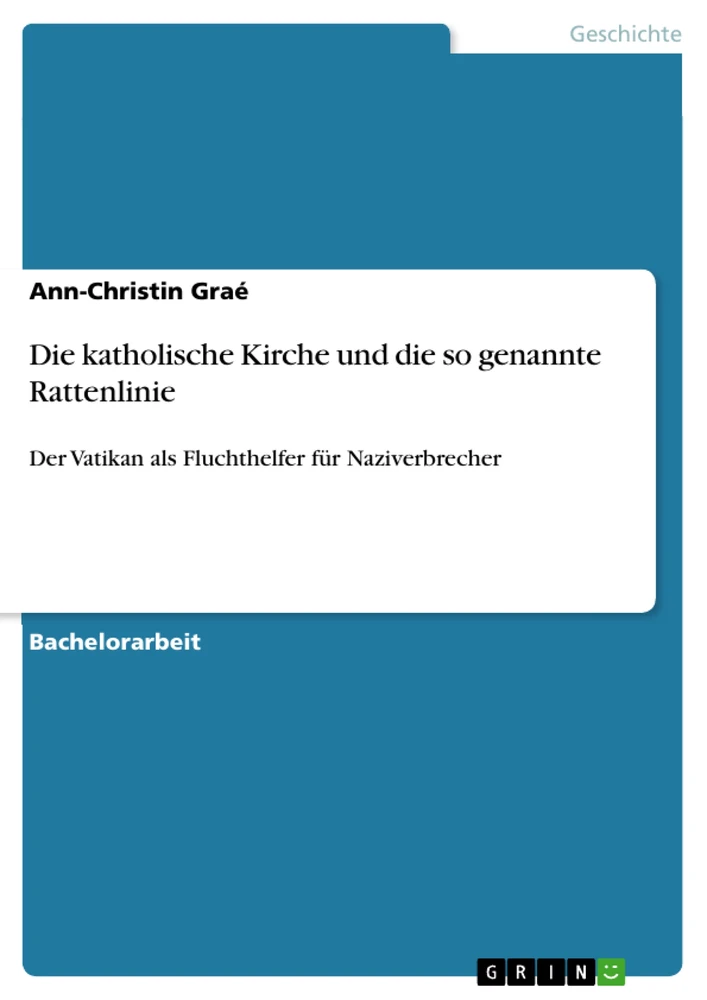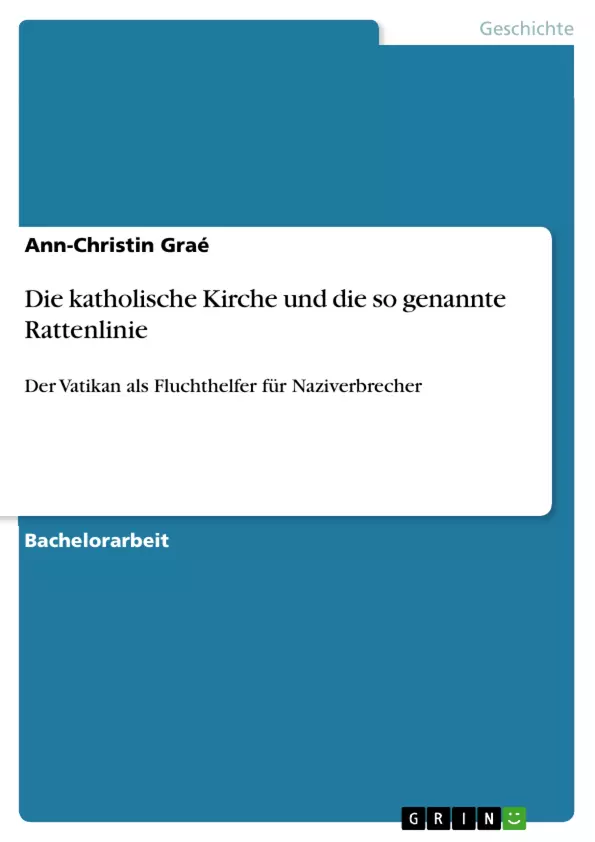Der Begriff Rattenlinie bezeichnet allgemein im Spionagejargon einen präparierten Weg, über welchen Flüchtlinge oder auch Agenten verdeckt in ein Land hinein oder aus einem Land herausgeschleust werden. Die Fluchtrouten der Nazis, die ebenso Rattenlinien oder auch Klosterrouten genannt wurden, verliefen vordergründig über Italien nach Nord- und Südamerika, v.a. nach Argentinien, aber auch in den Nahen Osten, wie Syrien und Ägypten. Entlang dieser Routen existierten gleichnamige Unterschlupfmöglichkeiten, die so genannten „Rattenhäuser“. Die Rattenlinie wurde auch als Klosterroute oder Vatikanlinie bezeichnet, da sich unter der Bezeichnung „Rattenhäuser“ nicht nur öffentliche Gasthäuser und Unterkünfte bei Privatleuten subsumieren, sondern eben auch Unterschlupfmöglichkeiten in Klöstern.
Die geleistete Fluchthilfe entwickelte sich von einer zunächst improvisierten Hilfe Einzelner zu einem umfassenden, länderübergreifenden Fluchthilfegefüge. Die transnationalen Hilfestellungen zur Flucht waren weit gefächert und unterschiedlich motiviert. Argentinien zum Beispiel bemühte sich deutsche Fachkräfte für Militär und Technik anzuwerben und nutzte nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Staatspräsidenten JUAN PERÓN auch diesen illegalen Weg für sich aus, um Argentinien zum führenden Industrieland zu machen.
Inhalt dieser Arbeit soll nicht nur die Skizzierung der Fluchthilfe sein, sondern auch eine Betrachtung moralisch-ethischer Aspekte. Es muss die Frage untersucht werden, ob das Verhalten der katholischen Kirche in dieser konkreten Situation angemessen war, d.h. ob sie gemäß ihres Auftrages als Institution Kirche agiert hat oder ob sie den ethischen Ansprüchen, die an sie gestellt werden, nicht gerecht werden konnte. Bereits die Forschungspositionen, die sich ein Urteil über das Verhalten der katholischen Kirche im Nationalsozialismus allgemein gebildet haben, divergieren sehr stark: Sie reichen von weitgehender Anpassung bis zu einem durchaus durchgehaltenen Widerstandscharakter der Kirche. Dementsprechend wird eine ethische Konklusion in diesem spezifischen Fall vermutlich auch ambivalent ausfallen und sowohl die Verhaltensweise des Vatikans scharf kritisieren als auch mögliche Gründe zu seiner Entschuldigung anführen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Flucht auf der Rattenlinie…
- 2.1 Akteure der Rattenlinie
- 2.1.1 Mythos Odessa
- 2.1.2 Flüchtlingsland Argentinien
- 2.1.3 Internationales Rotes Kreuz
- 2.1.4 Katholische Kirche und Vatikan
- 2.1.4.1 Kroatischer Franziskaner-Priester Krunoslav Draganovic
- 2.1.4.2 Österreichischer Bischof Alois Hudal
- 2.1.4.3 Papst Pius XII und Giovanni Montini
- 2.2 Moralisch-ethische Bewertung dieser Fluchthilfe
- 3 Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Fluchthilfe für nationalsozialistische Kriegsverbrecher nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere die sogenannten „Rattenlinien“. Die Zielsetzung ist eine umfassende Darstellung der Fluchtrouten und der beteiligten Akteure, sowie eine moralisch-ethische Bewertung der Fluchthilfe, insbesondere der Rolle der katholischen Kirche.
- Die „Rattenlinien“ als Fluchtrouten nationalsozialistischer Kriegsverbrecher.
- Die Rolle verschiedener Akteure bei der Fluchthilfe (z.B. Argentinien, das Internationale Rote Kreuz, die katholische Kirche).
- Die moralisch-ethische Bewertung der Fluchthilfe.
- Die Herausforderungen bei der Rekonstruktion der Ereignisse und der Ermittlung der wahren Zahl der flüchtigen NS-Verbrecher.
- Die Frage der Verantwortung der katholischen Kirche im Kontext der Fluchthilfe.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung skizziert den historischen Kontext der NS-Verbrechen und des Zweiten Weltkriegs, hebt die Bedeutung der NS-Täterforschung hervor und betont den vergleichsweise geringen Umfang an Publikationen zur Flucht von Kriegsverbrechern. Sie führt in die Thematik der Rattenlinien ein und beschreibt die Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion der Ereignisse aufgrund der erst späten Zugänglichkeit amerikanischer Geheimdienstarchive. Die Einleitung verdeutlicht die Notwendigkeit der Untersuchung der Fluchthilfe und ihrer moralischen Implikationen.
2 Flucht auf der Rattenlinie: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Fluchtrouten der Nazis, die als „Rattenlinien“ oder „Klosterrouten“ bekannt sind. Es beleuchtet die Akteure der Fluchthilfe, von Argentinien, das deutsche Fachkräfte anwarb, über das Internationale Rote Kreuz, das Reisepapiere ausstellte, bis hin zur katholischen Kirche und dem Vatikan, deren Rolle kritisch hinterfragt wird. Das Kapitel analysiert die verschiedenen Motive und Strategien der Fluchthilfe und die Herausforderungen bei der Ermittlung der genauen Anzahl der flüchtigen NS-Verbrecher. Es wird beispielhaft auf einige bekannte flüchtige Nationalsozialisten hingewiesen. Die Entwicklung der Fluchthilfe von improvisierten Einzelaktionen zu einem umfassenden, länderübergreifenden Netzwerk wird dargestellt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Flucht auf der Rattenlinie..."
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Fluchthilfe für nationalsozialistische Kriegsverbrecher nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere über die sogenannten „Rattenlinien“. Sie beleuchtet die Fluchtrouten, die beteiligten Akteure und bietet eine moralisch-ethische Bewertung der Fluchthilfe, mit besonderem Fokus auf die Rolle der katholischen Kirche.
Welche Akteure werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt eine Vielzahl von Akteuren, darunter Argentinien (als Zielland), das Internationale Rote Kreuz (bei der Ausstellung von Reisepapieren), die katholische Kirche und den Vatikan (deren Rolle kritisch hinterfragt wird), sowie einzelne Personen wie den kroatischen Franziskaner-Priester Krunoslav Draganovic, den österreichischen Bischof Alois Hudal und Papst Pius XII. und Giovanni Montini. Der "Mythos Odessa" wird ebenfalls thematisiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die „Rattenlinien“ als Fluchtrouten, die Rolle verschiedener Akteure bei der Fluchthilfe, die moralisch-ethische Bewertung der Fluchthilfe, die Herausforderungen bei der Rekonstruktion der Ereignisse und die Ermittlung der wahren Zahl der flüchtigen NS-Verbrecher, sowie die Verantwortung der katholischen Kirche.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Flucht auf der Rattenlinie…") mit Unterkapiteln zu den Akteuren und der moralisch-ethischen Bewertung, und eine Schlussbemerkung. Das Hauptkapitel beschreibt detailliert die Fluchtrouten und analysiert die Motive und Strategien der Fluchthilfe.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist eine umfassende Darstellung der Fluchtrouten und der beteiligten Akteure sowie eine moralisch-ethische Bewertung der Fluchthilfe, insbesondere der Rolle der katholischen Kirche. Die Arbeit hebt die Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion der Ereignisse aufgrund der späten Zugänglichkeit amerikanischer Geheimdienstarchive hervor.
Welche Kapitelzusammenfassungen bietet die Arbeit?
Die Einleitung skizziert den historischen Kontext und die Herausforderungen der Forschung. Das Hauptkapitel ("Flucht auf der Rattenlinie") beschreibt detailliert die Fluchtrouten, die beteiligten Akteure und ihre Motive, und analysiert die Entwicklung der Fluchthilfe von Einzelaktionen zu einem umfassenden Netzwerk. Die Schlussbemerkung wird im Vorschautext nicht näher beschrieben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind unter anderem: Rattenlinien, Fluchthilfe, nationalsozialistische Kriegsverbrecher, Zweiter Weltkrieg, Argentinien, Internationales Rotes Kreuz, Katholische Kirche, Vatikan, Papst Pius XII., Alois Hudal, Krunoslav Draganovic, moralisch-ethische Bewertung, NS-Täterforschung.
- Quote paper
- B.A. Ann-Christin Graé (Author), 2010, Die katholische Kirche und die so genannte Rattenlinie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164367