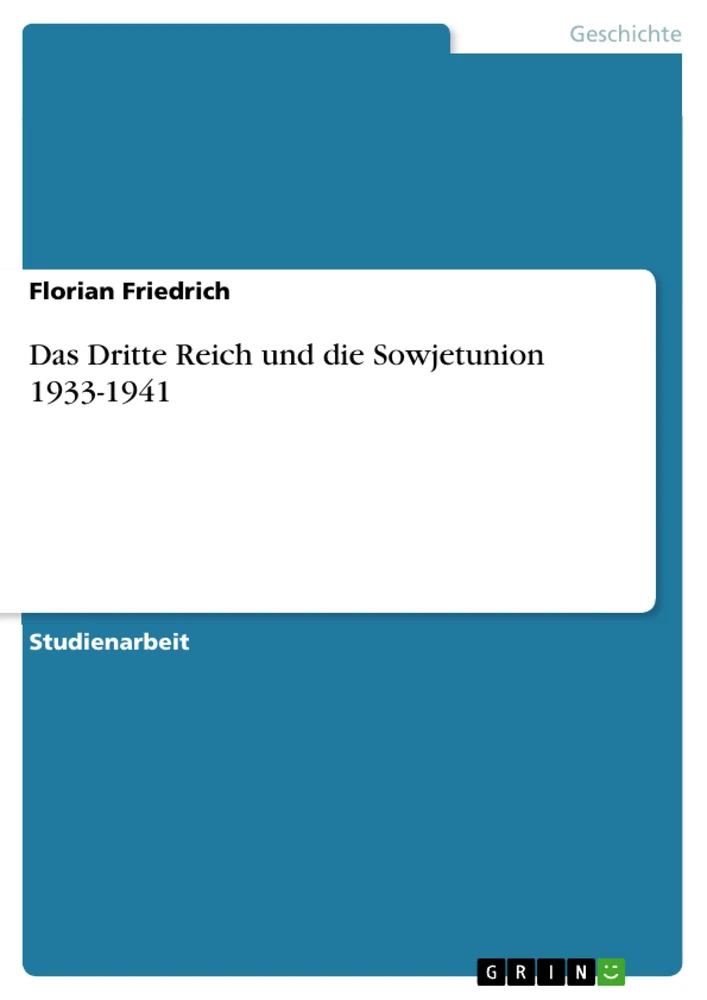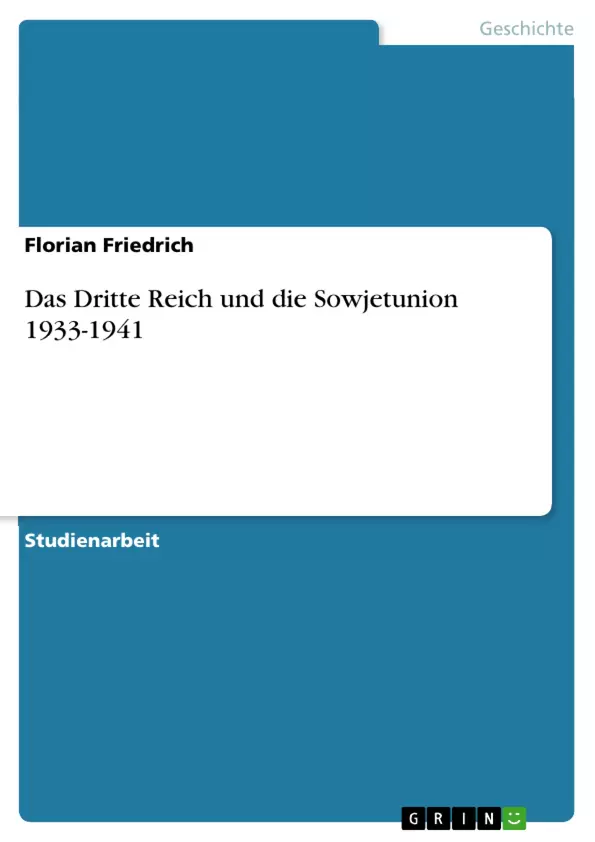Als am 30. Januar 1933 Adolf Hitler die Macht an sich gerissen hatte, glaubten viele Kritiker seinerzeit, es würde sich erneut um eine kurzweilige Regierungsperiode handeln, so wie bei seinen Vorgängern. Solche Stimmen ertönten nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch aus dem Ausland. Dabei hatte Hitler im Vorfeld häufig erklärt, dass die seine Macht, wenn er sie erlangt hatte, nicht freiwillig wieder aus der Hand geben werde. Mit dem sich konsolidierenden nationalsozialistischen Deutschland einerseits und der kommunistischen Sowjetunion andererseits, standen sich auf dem europäischen Kontinent fortan zwei Mächte gegenüber, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Die Ideologie des Nationalsozialismus war u.a. durch einen fanatischen Antimarxismus, Antibolschewismus und Antisemitismus geprägt. Bereits in den 20er Jahren des 20. Jh. erklärte Hitler seine außenpolitischen Absichten bezüglich Russlands in seiner Programmschrift „Mein Kampf“. Der Osten sollte durch einen Krieg erobert und anschließend rücksichtslos germanisiert werden, um Lebensraum für deutsche Siedler zu schaffen. Diese Pläne waren der sowjetischen Führung im Januar 1933 wohl bekannt, schließlich hatte Stalin Hitlers „Werk“ ausführlich gelesen. Um so erstaunlicher scheint die Reaktion jener Jahre zu sein. Anstatt einer eindeutigen Distanzierung beider Regierungen, kam es zu einer Annäherung der eigentlichen Todfeinde. Ende August 1939 beherrschte nur eine Schlagzeile die Weltpresse: der Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes.
Im Mittelpunkt dieser Seminararbeit stehen die Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion im Zeitraum der Machtergreifung 1933 bis zum Unternehmen „Barbarossa“ am 22. Juni 1941. Einen Schwerpunkt hierbei bildet der Hitler-Stalin-Pakt von 1939. Wie kam es trotz der erheblichen ideologischen Gegensätze zu einer Zusammenarbeit und sogar zum Abschluss des Nichtangriffspaktes kurz vor Kriegsbeginn? Wer ergriff die Initiative? Wie verliefen die Verhandlungen, und vor allem, welche Folgen hatte der Pakt bzw. wie wurde er in den Folgemonaten umgesetzt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die deutsch-sowjetischen Beziehungen in den Zwischenkriegsjahren
- Anfängliche deutsch-russische Beziehungen
- Vertrag von Rapallo (16. April 1922)
- Berliner Vertrag (24. April 1926)
- Das Dritte Reich und die Sowjetunion 1933-1939
- Die Rolle Russlands in Hitlers Ideologie
- Die Situation nach der Machtergreifung
- Deutsch-polnisches Abkommen (26. Januar 1934)
- Zuspitzung der Krise
- Hitler-Stalin-Pakt
- Die Verhandlungen
- Inhalt des Abkommens
- Folgen des Paktes
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die deutsch-sowjetischen Beziehungen zwischen 1933 und 1941, mit besonderem Fokus auf den Hitler-Stalin-Pakt von 1939. Die Arbeit analysiert die Hintergründe der Zusammenarbeit beider Staaten trotz ideologischer Gegensätze, den Verlauf der Verhandlungen und die Folgen des Paktes. Der Kontext der Beziehungen in den Zwischenkriegsjahren wird ebenfalls beleuchtet.
- Deutsch-sowjetische Beziehungen in den Zwischenkriegsjahren
- Hitlers Ideologie und Russlandbild
- Die außenpolitische Entwicklung nach Hitlers Machtergreifung
- Der Hitler-Stalin-Pakt: Verhandlungen, Inhalt und Folgen
- Zusammenarbeit trotz ideologischer Gegensätze
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Gründen für die Zusammenarbeit zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der Sowjetunion trotz erheblicher ideologischer Differenzen. Sie skizziert den Kontext, die Forschungslücken und die Gliederung der Arbeit, welche sich auf die Zeit von Hitlers Machtergreifung bis zum Unternehmen Barbarossa konzentriert. Die Einleitung hebt die Aktualität des Themas im Hinblick auf das Wiederaufleben rechtsextremer Ideologien hervor und benennt die Herausforderungen der Quellenlage.
Die deutsch-sowjetischen Beziehungen in den Zwischenkriegsjahren: Dieses Kapitel beleuchtet die anfänglichen deutsch-russischen Beziehungen nach dem Ersten Weltkrieg, die trotz ideologischer Unterschiede durch pragmatische Erwägungen geprägt waren. Der Fokus liegt auf dem Vertrag von Rapallo (1922) und dem Berliner Vertrag (1926), die eine Annäherung zwischen der Weimarer Republik und der Sowjetunion markierten, trotz der unterschiedlichen politischen Systeme. Das Kapitel betont die schwierige innenpolitische Lage beider Staaten und die Bedeutung der Handelsabkommen für die jeweilige Stabilisierung.
Das Dritte Reich und die Sowjetunion 1933-1939: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der deutsch-sowjetischen Beziehungen nach Hitlers Machtergreifung 1933. Es untersucht Hitlers Ideologie und sein Russlandbild, das von Plänen der Eroberung und Germanisierung des Ostens geprägt war. Der Abschnitt beleuchtet die anfänglichen Schritte der deutschen Außenpolitik gegenüber der Sowjetunion und den Wandel hin zu einem Kurswechsel, der sich im deutsch-polnischen Abkommen von 1934 manifestierte. Dieses Abkommen führte zu einer Zuspitzung der Krise mit der Sowjetunion, die erst 1939 mit dem Hitler-Stalin-Pakt eine Wende erfuhr.
Hitler-Stalin-Pakt: Dieses Kapitel untersucht den Hitler-Stalin-Pakt als zentralen Punkt der Arbeit. Es analysiert die Verhandlungen, den Inhalt des Nichtangriffspaktes und seine Folgen in den ersten Kriegsmonaten bis zum Überfall auf die Sowjetunion. Die Analyse beleuchtet die Motive beider Seiten für den Abschluss des Paktes, trotz ihrer grundlegend unterschiedlichen Ideologien, und bewertet dessen Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Geschichte.
Schlüsselwörter
Hitler-Stalin-Pakt, Deutsch-sowjetische Beziehungen, Nationalsozialismus, Sowjetunion, Zwischenkriegszeit, Außenpolitik, Ideologie, Antisemitismus, Antibolschewismus, Lebensraum, Vertrag von Rapallo, Berliner Vertrag, Unternehmen Barbarossa.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Deutsch-Sowjetische Beziehungen 1933-1941
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die deutsch-sowjetischen Beziehungen zwischen 1933 und 1941, mit besonderem Fokus auf den Hitler-Stalin-Pakt von 1939. Sie analysiert die Hintergründe der Zusammenarbeit beider Staaten trotz ideologischer Gegensätze, den Verlauf der Verhandlungen und die Folgen des Paktes. Der Kontext der Beziehungen in den Zwischenkriegsjahren wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Deutsch-sowjetische Beziehungen in den Zwischenkriegsjahren, Hitlers Ideologie und Russlandbild, die außenpolitische Entwicklung nach Hitlers Machtergreifung, den Hitler-Stalin-Pakt (Verhandlungen, Inhalt und Folgen) und die Zusammenarbeit trotz ideologischer Gegensätze.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und eine Schlussbetrachtung. Die Einleitung formuliert die Forschungsfrage und skizziert den Kontext. Das erste Hauptkapitel beleuchtet die deutsch-sowjetischen Beziehungen in den Zwischenkriegsjahren, inklusive der Verträge von Rapallo und Berlin. Das zweite Kapitel analysiert die Entwicklung der Beziehungen nach 1933, Hitlers Ideologie und den Wandel der deutschen Außenpolitik. Das dritte Kapitel fokussiert auf den Hitler-Stalin-Pakt: Verhandlungen, Inhalt und Folgen. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hitler-Stalin-Pakt, Deutsch-sowjetische Beziehungen, Nationalsozialismus, Sowjetunion, Zwischenkriegszeit, Außenpolitik, Ideologie, Antisemitismus, Antibolschewismus, Lebensraum, Vertrag von Rapallo, Berliner Vertrag, Unternehmen Barbarossa.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Gründe für die Zusammenarbeit zwischen nationalsozialistischem Deutschland und der Sowjetunion trotz ideologischer Differenzen zu untersuchen. Sie analysiert die Hintergründe, den Verlauf und die Folgen des Hitler-Stalin-Paktes im Kontext der deutsch-sowjetischen Beziehungen der Zwischenkriegszeit.
Welche Quellen wurden wahrscheinlich verwendet?
Die Arbeit erwähnt die Herausforderungen der Quellenlage, ohne konkrete Quellen zu nennen. Es ist jedoch anzunehmen, dass sowohl Primärquellen (z.B. Dokumente zum Hitler-Stalin-Pakt) als auch Sekundärliteratur zur deutsch-sowjetischen Geschichte und zum Nationalsozialismus verwendet wurden.
Welche Bedeutung hat die Arbeit im Kontext heutiger Debatten?
Die Arbeit hebt die Aktualität des Themas im Hinblick auf das Wiederaufleben rechtsextremer Ideologien hervor. Die Analyse der deutsch-sowjetischen Beziehungen in dieser Zeit kann somit dazu beitragen, heutige Entwicklungen besser zu verstehen und zu bewerten.
- Arbeit zitieren
- Florian Friedrich (Autor:in), 2006, Das Dritte Reich und die Sowjetunion 1933-1941, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164425