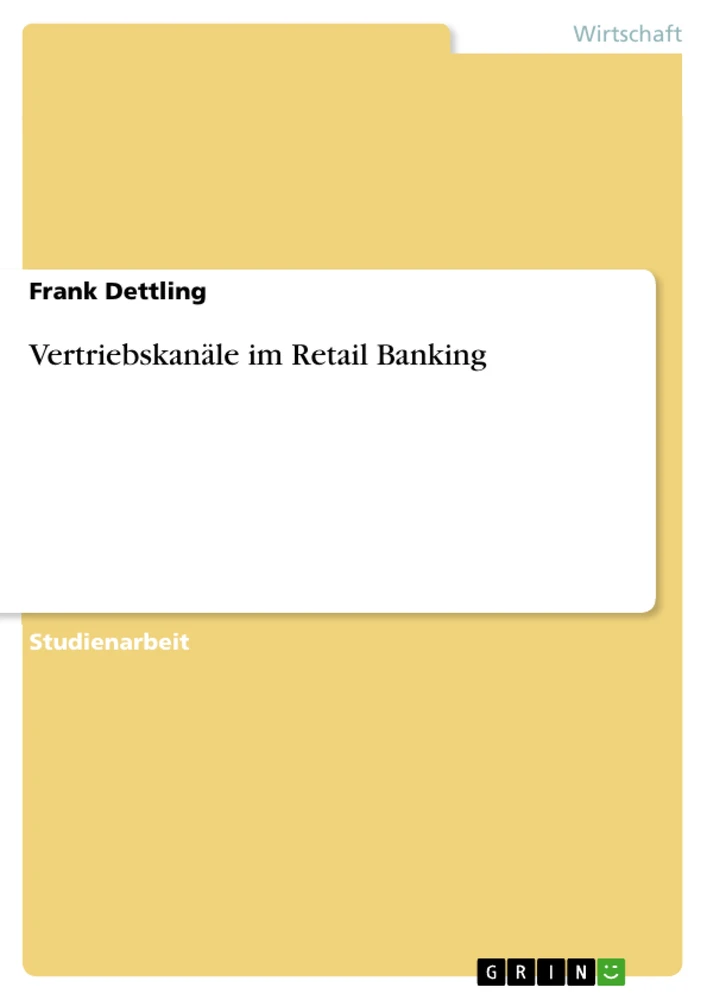In den 90er Jahren zogen sich viele deutsche Filialbanken aus dem für sie unattraktiven Massenkundengeschäft, dem Retail Banking, zurück. Gründe hierfür waren die stark wachsenden Erträge im Investmentbereich, das höhere Kreditvolumen bei Unternehmenskunden und Provisionserlöse durch neue Geschäftsfelder wie z. B. Vermögensverwaltung oder Corporate Finance Produkte. Aufgrund von negativen Börsenentwicklungen, Wirtschaftflaute und Finanzkrise haben die Banken das Geschäftsfeld Retail Banking als stabile Ertragsquelle wiederentdeckt.
Neue Telekommunikationstechnologien haben den Wettbewerbsdruck radikal verschärft. Non- und Near-Banks dringen sehr schnell und vor allem preis- und kostengünstiger in die Märkte vor. Gleichzeitig hat sich auch das Kundenverhalten stark geändert. Der klassische Kundentyp hatte stets ein auf Vertrauen und persönlicher Bindung basierendes Kaufverhalten und war dadurch leichter berechenbar. In der Bevölkerung setzt sich jedoch immer mehr der „Hybride“ Kunde durch und bereitet dem Handel und auch den Banken schweres Kopfzerbrechen. "Hybride" Kunden entwickeln keine Bindung zu Ihrem Anbieter und wechseln auch wegen geringster Differenzbeträge ihre Einkaufsquelle. Diese Kunden legen wenig Wert auf einen persönlichen Kontakt, kaufen gerne im Internet und dort auch von ständig wechselnden Quellen. „Hybride“ Kunden nutzen viele Informationsquellen, bilden sich ihr Endurteil aber trotzdem oft spontan.
Diese Marktentwicklung hat dazugeführt, dass bei den deutschen Retail Banken ein Umdenken erforderlich ist und dass sie die bisherigen Vertriebsstrategien gravierend ändern müssen.
Die vorliegende Studienarbeit gibt einen Überblick über die möglichen Vertriebskanäle einer Retail Bank. Es wird erklärt, was sich genau hinter jedem Vertriebsweg verbirgt, welche neuen Vertriebsformen es in der Zukunft geben und was aus den klassischen Vertriebswegen wird.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Vertriebskanäle im Retail Banking
2.1 Der stationäre Vertrieb
2.1.1 Die klassische Bankfiliale
2.1.2 SB-Filiale
2.1.3 Kompetenzcenter
2.1.4 Innovative Filialkonzepte der Zukunft
2.2 Der mobile Vertrieb
2.2.1 Bankaußendienst
2.2.2 Fahrbare Filiale
2.2.3 Container Filiale
2.2.4 Mobile SB-Geräte
2.3 Der Direktvertrieb
2.3.1 Telefon-Banking / Call-Center
2.3.2 Internet
2.3.3 Mobile-Banking
2.3.4 VideoBanking
3. Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Retail Banking?
Retail Banking bezeichnet das Standardgeschäft der Banken mit Privatkunden (Massenkundengeschäft), im Gegensatz zum Investmentbanking oder Firmenkundengeschäft.
Wer oder was ist ein „hybrider“ Bankkunde?
Ein hybrider Kunde nutzt verschiedene Kanäle (Filiale, Internet, Mobile) spontan und wechselhaft. Er ist wenig loyal, preisbewusst und wechselt den Anbieter auch bei geringen Differenzbeträgen.
Welche stationären Vertriebskanäle gibt es neben der klassischen Filiale?
Dazu gehören SB-Filialen (reine Selbstbedienung), Kompetenzcenter für spezialisierte Beratung und innovative Filialkonzepte wie Flagship-Stores.
Was zählt zum mobilen Vertrieb im Bankwesen?
Zum mobilen Vertrieb gehören der Bankaußendienst (Beraterbesuche beim Kunden), fahrbare Filialen (Busse) und Container-Filialen für temporäre Standorte.
Welche Rolle spielt das Video-Banking in der Zukunft?
Video-Banking ermöglicht eine persönliche Beratung über digitale Kanäle und verbindet so die Effizienz des Direktvertriebs mit der Qualität des persönlichen Gesprächs.
- Citation du texte
- Frank Dettling (Auteur), 2009, Vertriebskanäle im Retail Banking, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164427