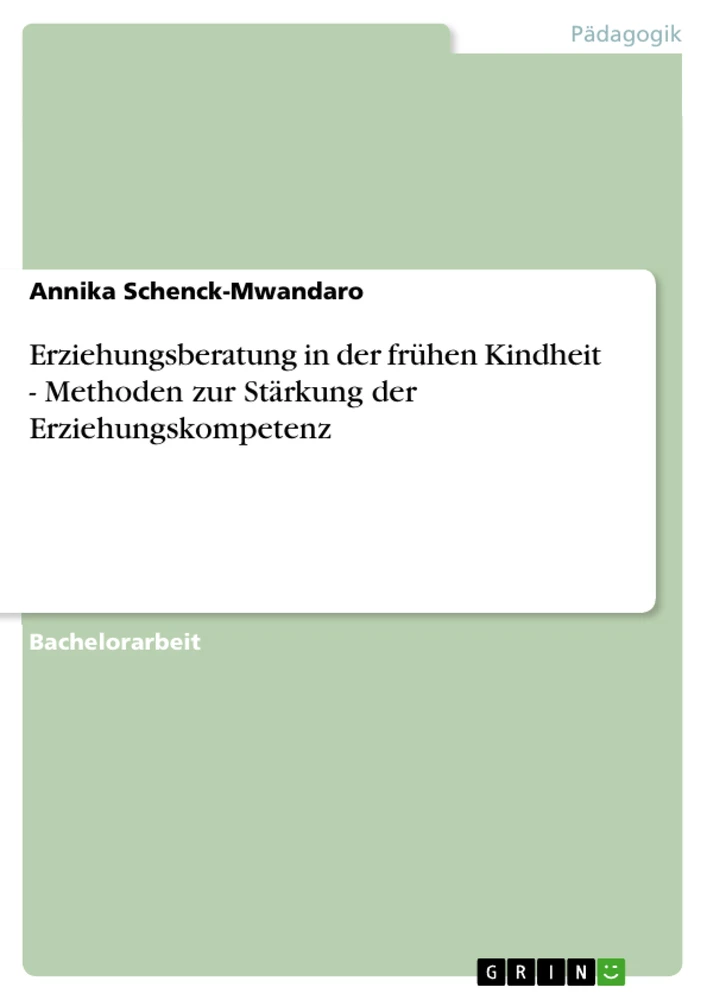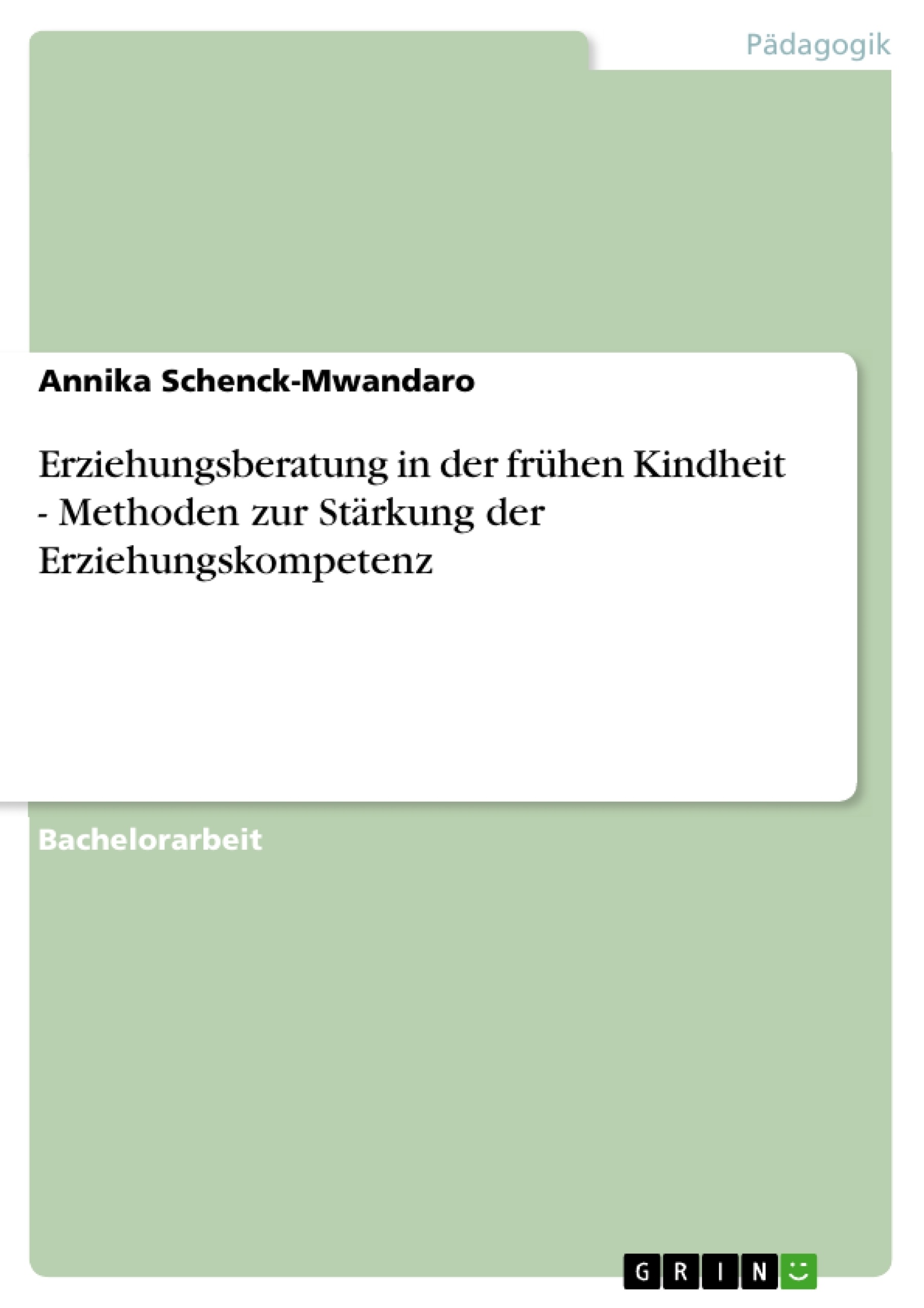In der vorliegenden Bachelorarbeit wird der Frage nachgegangen, mit welchen Methoden die Erziehungskompetenz von Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern gestärkt werden kann.
Warum aber ist es gerade in der jetzigen Zeit wichtiger denn je, die Fähigkeit zu einer kompetenten Erziehung zu fördern? Nicht nur die zahlreichen Fälle von Kindesvernach-lässigung und Kindesverwahrlosung, sondern vor allem die zunehmende Verunsicherung vieler Eltern, hervorgerufen durch zahlreiche gesellschaftliche Veränderungen, könnten darauf eine Antwort geben.
Eltern sind der Schlüssel für alle Erziehungsprozesse und ihnen wird heute eine enorme Verantwortung hinsichtlich der optimalen Entwicklung ihrer Kinder zugewiesen. Viele Eltern fühlen sich den gesellschaftlichen Anforderungen nicht gewachsen, zweifeln an ihrer eigenen Kompetenz und empfinden ihre Elternschaft als zunehmend schwierig und negativ belastet. (vgl. Henry-Huthmacher, 2010, S. 8)
Um den heutigen Erziehungsansprüchen gerecht zu werden, brauchen Eltern Unterstützung, denn nur starke Eltern können auch starke Kinder erziehen. Wie und mit welchen Methoden Eltern bei ihrer Aufgabe begleitet werden können, untersucht die vorliegende Arbeit.
Um die Thematik zu vertiefen wird zunächst der Begriff der Erziehungskompetenz genauer beleuchtet.
Im darauf folgenden Kapitel erfolgt eine Auseinandersetzung mit der Thematik, inwiefern sich Eltern und Familie in einem Wandel befinden. Dazu werden sowohl die gesellschaftlichen als auch die psychologischen Veränderungen näher beschrieben. Im weiteren Verlauf wird der Frage nachgegangen, ob die viel zitierte „Erziehungskatastrophe“ wirklich existiert.
Im Anschluss daran wird die Erziehung in der frühen Kindheit erläutert. Dazu gehören die Erziehungsaufgaben, die gängigen Regulationsstörungen, die Bindungstheorie sowie eine Beschreibung der unterschiedlichen Erziehungsstile. Auch der Prozess der Elternwerdung wird hier thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Aufbau der Arbeit
- Begriffsdefinition Erziehungskompetenz
- Familie im Wandel
- Gesellschaftliche und psychologische Veränderungen der Elternrolle
- Gibt es die ,,Erziehungskatastrophe“?
- Erziehung in der frühen Kindheit
- ,,Die Geburt der Eltern“
- Erziehungsaufgaben
- Regulationsstörungen
- Bindungstheorie
- Erziehungsstile
- Erziehungsberatung in der frühen Kindheit
- Neue Ansprüche an die Erziehungsberatung
- Methoden
- Entwicklungspsychologische Beratung
- Grundsätze
- Ziele
- Vorgehensweise
- Der systemische Ansatz
- Marte Meo
- Grundsätze
- Ziele
- Vorgehensweise
- Das Steep-Programm
- Schreiambulanzen
- Die praktische Umsetzung an dem fiktiven Beispiel des exzessiven Schreiens
- Ausgangssituation
- Der Beratungsprozess
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit setzt sich zum Ziel, die Methoden zur Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern zu erforschen und zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen der heutigen Elternrolle und die Bedeutung von Unterstützung für Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe.
- Die Bedeutung von Erziehungskompetenz für die Entwicklung von Kindern
- Veränderungen in der Familienstruktur und deren Auswirkungen auf die Erziehung
- Analyse verschiedener Erziehungsberatungsmethoden und deren Wirksamkeit
- Die praktische Anwendung von Erziehungsberatungstechniken in einer fiktiven Fallstudie
- Die Bedeutung von Unterstützung und Begleitung für Eltern in der frühen Kindheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung präsentiert die Problemstellung der Arbeit, beleuchtet die Bedeutung von Erziehungskompetenz und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- Das Kapitel "Familie im Wandel" befasst sich mit den Veränderungen der Elternrolle in der heutigen Gesellschaft und untersucht, ob die viel zitierte "Erziehungskatastrophe" tatsächlich existiert.
- Das Kapitel "Erziehung in der frühen Kindheit" beleuchtet wichtige Themen wie Erziehungsaufgaben, Regulationsstörungen, die Bindungstheorie und verschiedene Erziehungsstile.
- Das Kapitel "Erziehungsberatung in der frühen Kindheit" stellt verschiedene Methoden der Erziehungsberatung vor, analysiert ihre Grundsätze, Ziele und Vorgehensweisen.
- Das Kapitel "Die praktische Umsetzung an dem fiktiven Beispiel des exzessiven Schreiens" veranschaulicht die Anwendung von Erziehungsberatungstechniken in einem fiktiven Fallbeispiel.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der Erziehungskompetenz, Erziehungsberatung, Elternrolle, Familie, Säuglinge, Kleinkinder, Entwicklungspsychologie, Regulationsstörungen, Bindungstheorie, Erziehungsstile, systemische Beratung, Marte Meo, Steep-Programm, Schreiambulanzen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Anwendung von Methoden zur Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern in der frühen Kindheit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Erziehungsberatung in der frühen Kindheit?
Das Ziel ist die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern, um sie in ihrer Rolle zu unterstützen und die kindliche Entwicklung zu fördern.
Welche Methoden der Erziehungsberatung werden vorgestellt?
Vorgestellt werden unter anderem die Entwicklungspsychologische Beratung, Marte Meo, das Steep-Programm und die Arbeit von Schreiambulanzen.
Warum fühlen sich viele Eltern heute verunsichert?
Gesellschaftliche Veränderungen, steigende Anforderungen an die Elternrolle und psychologische Umbrüche führen dazu, dass viele Eltern an ihrer eigenen Kompetenz zweifeln.
Welche Rolle spielt die Bindungstheorie in der Beratung?
Die Bindungstheorie ist eine zentrale Grundlage, um die Interaktion zwischen Eltern und Kind zu verstehen und eine sichere Bindung als Basis für gesunde Erziehung zu fördern.
Was sind typische Regulationsstörungen in der frühen Kindheit?
Dazu gehören Probleme wie exzessives Schreien, Schlafstörungen oder Fütterprobleme, die im Rahmen der Beratung thematisiert und behandelt werden.
- Quote paper
- Annika Schenck-Mwandaro (Author), 2010, Erziehungsberatung in der frühen Kindheit - Methoden zur Stärkung der Erziehungskompetenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164543