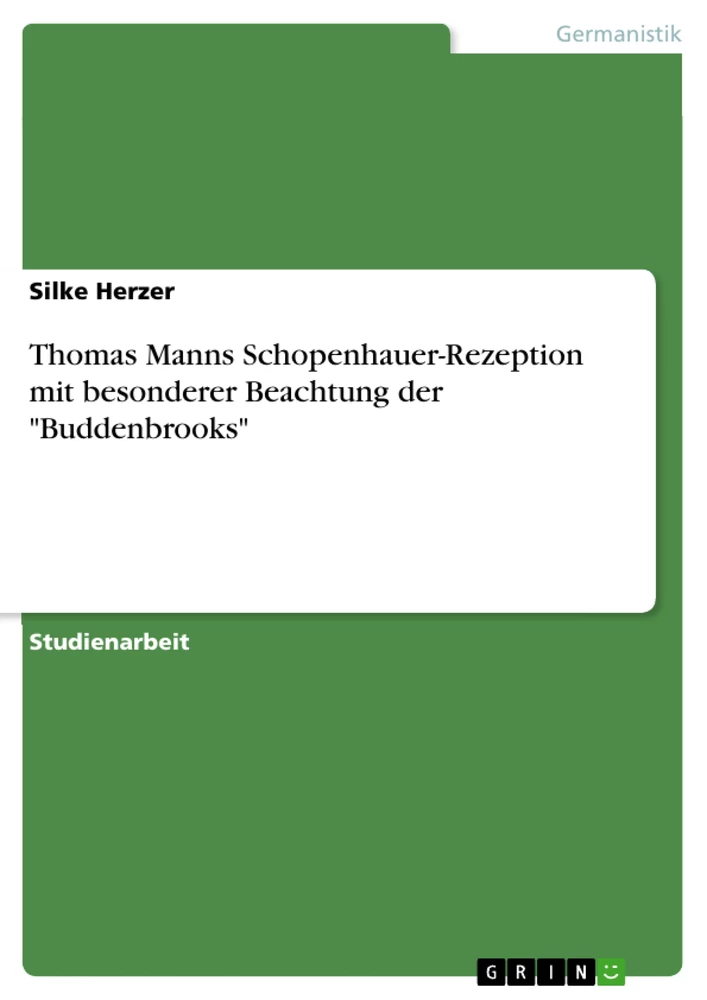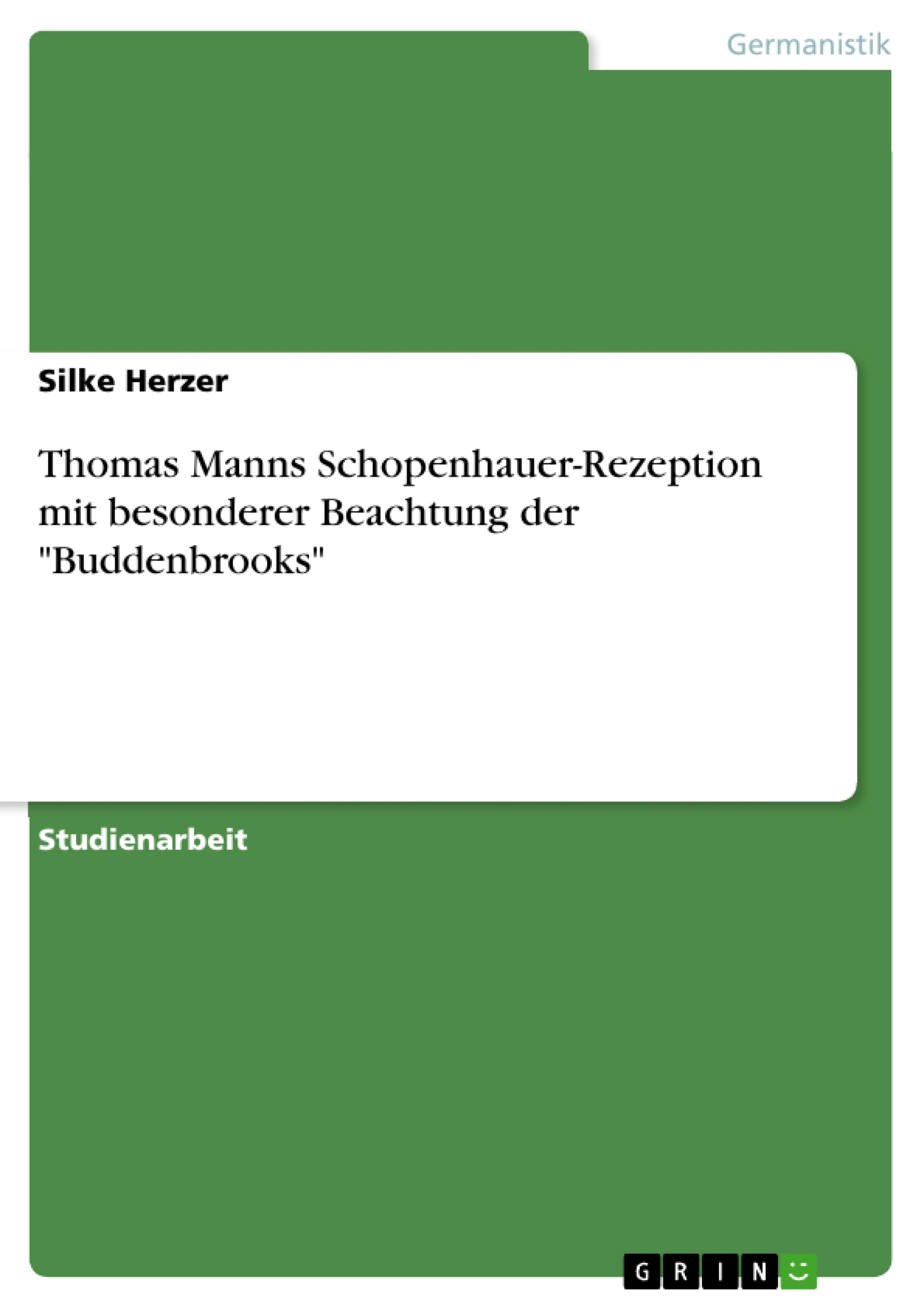Schriftstellerische Werke sind neben der Phantasie und dem autobiographischen Einfluss des Autors immer auch Produkte der Zeit und ihrer Wechselwirkung mit dem Autor. Auf Thomas Mann hat in jungen Jahren auch die Philosophie Einfluss gehabt, die er selbst rezipierte. Prägend war seine Auseinandersetzung mit Friedrich Nietzsche aber auch mit Arthur Schopenhauer.
Diese Einflüsse sind auch in seinen frühen Werken nachweisbar. In den Buddenbrooks gibt es beispielsweise eine Stelle, an der die Hauptfigur Thomas Buddenbrook selbst Schopenhauer liest. Diese Arbeit macht es sich zur Aufgabe, Arthur Schopenhauers Philosophie anhand des so genannten Schopenhauer-Essays von Thomas Mann darzustellen, zu betrachten und anschließend an Textbelegen in den Buddenbrooks zu zeigen, wie Schopenhauers Philosophie auf das Nobelpreiswerk wirkte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Arthur Schopenhauers Philosophie aus der Sicht von Manns Schopenhauer-Essay
- Platon als Grundlage
- Kant als Vorgänger
- Synthese von Kant und Platon durch Schopenhauer
- Thomas Mann trifft auf Schopenhauer
- Das Schopenhauer-Erlebnis von Thomas Buddenbrook
- Thomas Buddenbrooks „Nacht der Erkenntnis“
- Schopenhauer im Verhältnis zum Gesamtwerk „Buddenbrooks“
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Thomas Manns Rezeption von Arthur Schopenhauers Philosophie, insbesondere in Bezug auf den Roman „Buddenbrooks“. Der Essay soll die philosophischen Grundlagen von Schopenhauers Denken anhand des von Mann verfassten Schopenhauer-Essays darstellen und zeigen, wie diese Philosophie in Manns Werk zum Ausdruck kommt.
- Schopenhauers Philosophie im Kontext der Geschichte des Denkens
- Der Einfluss von Platon und Kant auf Schopenhauer
- Der Wille als zentraler Begriff in Schopenhauers Philosophie
- Die Rolle der Kunst in der Philosophie Schopenhauers
- Die Rezeption von Schopenhauers Philosophie in Thomas Manns „Buddenbrooks“
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und erklärt die Bedeutung der Rezeption von Schopenhauers Philosophie durch Thomas Mann.
- Arthur Schopenhauers Philosophie aus der Sicht von Manns Schopenhauer-Essay: Dieses Kapitel untersucht die zentralen Elemente von Schopenhauers Philosophie, wie sie von Thomas Mann in seinem Schopenhauer-Essay dargestellt werden. Es beleuchtet den Einfluss von Platon und Kant auf Schopenhauers Denken und fokussiert auf den Willen als Grundprinzip des Seins.
- Thomas Mann trifft auf Schopenhauer: Dieses Kapitel beleuchtet Manns Begegnung mit Schopenhauer und die Auswirkungen dieser Begegnung auf seinen eigenen Werdegang als Schriftsteller.
- Das Schopenhauer-Erlebnis von Thomas Buddenbrook: Hier wird die Rolle von Schopenhauers Philosophie im Roman „Buddenbrooks“ untersucht, insbesondere im Hinblick auf die Figur von Thomas Buddenbrook.
- Schopenhauer im Verhältnis zum Gesamtwerk „Buddenbrooks“: Dieses Kapitel betrachtet den Einfluss von Schopenhauers Philosophie auf das gesamte Werk „Buddenbrooks“ und seine Auswirkungen auf die zentralen Themen und Figuren des Romans.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen und Begriffen der Philosophie Arthur Schopenhauers, insbesondere mit dem Willen, der Kunst und der Rezeption von Schopenhauer in Thomas Manns Werk „Buddenbrooks“. Weitere Schlüsselbegriffe sind Platon, Kant, Künstlerphilosophie, „Nacht der Erkenntnis“ und die Rolle der Philosophie in der Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte Arthur Schopenhauer auf Thomas Mann?
Schopenhauer prägte Thomas Manns Denken in jungen Jahren tiefgreifend, was sich besonders in seinen frühen Werken wie den „Buddenbrooks“ widerspiegelt.
Wo taucht Schopenhauers Philosophie in den „Buddenbrooks“ auf?
In einer Schlüsselszene des Romans liest die Hauptfigur Thomas Buddenbrook selbst in Schopenhauers Werk, was zu seiner so genannten „Nacht der Erkenntnis“ führt.
Was ist der „Wille“ in Schopenhauers Philosophie?
Der Wille ist bei Schopenhauer das zentrale Grundprinzip des Seins, eine blinde, rastlose Urkraft, die hinter allen Erscheinungen der Welt steht.
Welche Rolle spielt die Kunst laut Schopenhauer?
Die Kunst ermöglicht laut Schopenhauer eine zeitweilige Erlösung vom Leiden des Willens, indem sie eine rein kontemplative Betrachtung der Welt erlaubt.
Auf welchen Philosophen baute Schopenhauer auf?
Schopenhauers Denken ist eine Synthese aus den Lehren Platons (Ideenlehre) und Immanuel Kants (Unterscheidung zwischen Ding an sich und Erscheinung).
- Quote paper
- M. A. Silke Herzer (Author), 2010, Thomas Manns Schopenhauer-Rezeption mit besonderer Beachtung der "Buddenbrooks", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164568