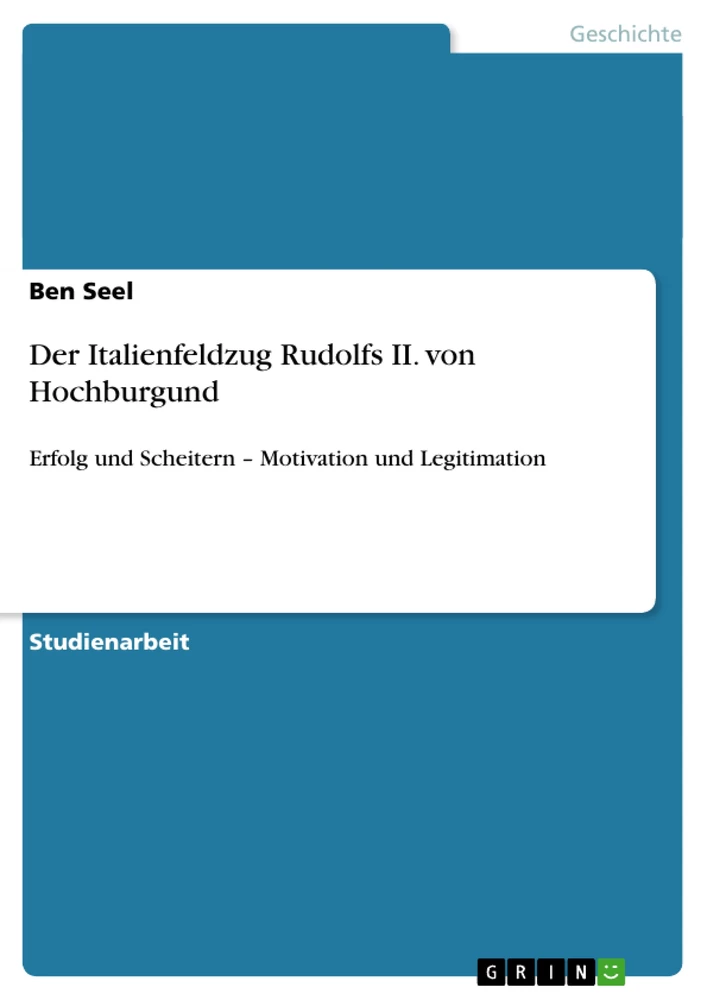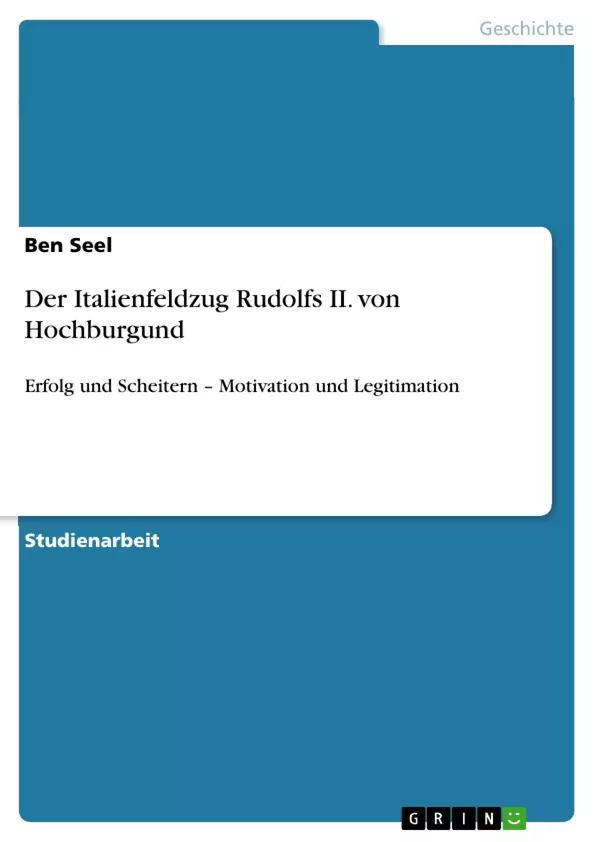Im Jahr 922 zog Rudolf II., König von Hochburgund, nach Italien, um dort die ihm von den italienischen Großen angetragene Königskrone zu übernehmen und den Kaiser Berengar I. in der Herrschergewalt über Italien abzulösen. Für die welfischrudolfingische Herrschaft in Hochburgund bedeutete diese Unternehmung das größte Ausgreifen. Hatte der Dynastiegründer Rudolf I. mühsam aus den Splittern des Karolingerreiches ein stabiles Königreich aufbauen können, so suchte sein Sohn Rudolf II. als einziger der vier Rudolfingerkönige mit einigem Einsatz die Ausweitung des väterlichen Herrschaftsbereichs.
In dieser Arbeit werde ich den Fragen nachgehen, wieso es Rudolf II. als Exponent einer noch sehr jungen Dynastie eines mehr oder weniger provinziellen Alpenkönigtums nach Italien zog und warum es ihm gelingen konnte, gegen den Widerstand des 915 zum Kaiser gekrönten Berengar I. immerhin für drei Jahre König von Italien zu werden. Außerdem gilt es nach den Gründen für sein Scheitern an der Alleinherrschaft nach dem Tode Berengars und seine Vertreibung in den Wirren der Jahre 925/6 zu suchen. Dazu ist es nötig die Legitimationsgrundlagen beider Herrscher zu hinterfragen und die historischen Umstände, die ausschlaggebend dafür waren, dass
keinem der beiden Potentaten eine Unterstützung zuteil wurde, die ausgereicht hätte, um eine langfristige Herrschaft zu erhalten.
Gliederung:
1. Einleitung
2. Zeiten des Umbruchs - Historische Umstände
3. Das Erscheinen Rudolfs auf der italienischen Bühne - Ziele und Begründung
3.1 Gründe der Hinwendung nach Hochburgund
3.2 Ziele Rudolfs in Italien
4. Legitimation der Herrschaft Rudolfs II. im Gegenbild zu Berengar I
5. Versuch der Herrschaftskontinuität unter Rudolf in Italien - Gründe des Scheiterns
6. Fazit
7. Quellen und Literaturverzeichnis
7.1 Quellen
7.2 Literatur
1. Einleitung
Im Jahr 922 zog Rudolf II., König von Hochburgund, nach Italien, um dort die ihm von den italienischen Großen angetragene Königskrone zu übernehmen und den Kaiser Berengar I. in der Herrschergewalt über Italien abzulösen. Für die welfisch- rudolfingische Herrschaft in Hochburgund bedeutete diese Unternehmung das größte Ausgreifen. Hatte der Dynastiegründer Rudolf I. mühsam aus den Splittern des Karolingerreiches ein stabiles Königreich aufbauen können, so suchte sein Sohn Rudolf II. als einziger der vier Rudolfingerkönige mit einigem Einsatz die Ausweitung des väterlichen Herrschaftsbereichs.1
In dieser Arbeit werde ich den Fragen nachgehen, wieso es Rudolf II. als Exponent einer noch sehr jungen Dynastie eines mehr oder weniger provinziellen Alpenkönigtums nach Italien zog und warum es ihm gelingen konnte, gegen den Widerstand des 915 zum Kaiser gekrönten Berengar I. immerhin für drei Jahre König von Italien zu werden. Außerdem gilt es nach den Gründen für sein Scheitern an der Alleinherrschaft nach dem Tode Berengars und seine Vertreibung in den Wirren der Jahre 925/6 zu suchen. Dazu ist es nötig die Legitimationsgrundlagen beider Herrscher zu hinterfragen und die historischen Umstände, die ausschlaggebend dafür waren, dass keinem der beiden Potentaten eine Unterstützung zuteil wurde, die ausgereicht hätte, um eine langfristige Herrschaft zu erhalten.
Die wichtigste Quelle für diesen Zeitraum ist die „Antapodosis“ des italienischen Bischofs Liudprand von Cremona, der in bunten Erzählungen lebensnah die Geschichte des norditalienischen Raums im 9. und 10. Jahrhundert niederschreibt. Dabei erwähnt er recht ausführlich den Italienfeldzug Rudolfs und schildert weitläufig und blumig die Umstände und Beziehungsgeschichten, die zu Rudolfs Scheitern führen. Durch die sehr enge räumliche und zeitliche Nähe Liudprands zu den Ereignissen - er wuchs am Hofe Hugos v. d. Provence in Pavia auf und diente Berengar II. von Ivrea und Otto I. - stellen seine Schriften eine sehr direkte, wenn auch recht subjektive Quelle dar. Diese Hauptquelle wird ergänzt durch die Königsurkunden Italiens, die zeitgenössische Herrscherhuldigung „Gesta Berengarii“ für Kaiser Berengar aus der Hand eines unbekannten Dichters und die Abhandlung des Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos „De Administrando Imperii“, in der dieser unter anderem über Hugo v. d. Provence und seine Vorgänger (darunter ja Rudolf II.) schreibt. Leider ist noch festzustellen, dass zu diesem Thema eine außerordentliche Armut an Sekundärliteratur herrscht, neben den Monographien von Bernd Schneidmüller über das Geschlecht der Welfen und Laetitia Boehm über Burgund beschreibt vor allem Rudolf Hiestand sehr nützlich die Verhältnisse im Italien des 10. Jahrhunderts.
2. Zeiten des Umbruchs - Historische Umstände
Die historische Kulisse für die Ereignisse um das Königtum Rudolfs II. in Italien bildet die Welt des einstigen karolingischen Frankenreiches. Dieses war zwar seit dem Vertrag von Verdun 843 - von der kurzen Zeit unter Karl III. abgesehen - de facto in mehrere, getrennt regierte Teile zerfallen, der Rahmen und Anspruch der Reichseinheit blieb jedoch bestehen.2 Mit Ausnahme von Arnulf, der in Ostfranken bereits zu Lebzeiten Karls die Macht ergriffen hatte, begannen nach dem Tod Karls III. im Jahr 888 die einzelnen Reichsteile eigene Könige zu wählen. So entstanden aus dem ehemaligen Mittelreich Lothars I. die Königreiche Niederburgund (seit 879), Hochburgund (888) und das Regnum Italicum, umkämpft zwischen Wido von Spoleto (Kaiser 891) und Berengar von Friaul (888 König in Pavia).
In Hochburgund hatte es Rudolf I. nach ersten vergeblichen Versuchen, den Nordteil des Mittelreiches, das sogenannte Lotharingien, zu gewinnen, vermocht ein Kerngebiet um den Genfer See und die Westalpen bis nach Besançon gegen die Angriffe Arnulfs zu verteidigen und dort eine stabile Königsherrschaft zu errichten.3 Die Stabilität ist vor allem daran zu erkennen, dass es entgegen dem fränkischen Brauch gelang, den ältesten Sohn Rudolf als - so weit bekannt - unumstrittenen und einzigen Nachfolger einzusetzen. Rudolf II. suchte nun, sein Einflussgebiet zu vergrößern: Nach einem erfolglosen Ausgreifen nach Schwaben, aus dem eine Bündnisehe Rudolfs mit der Tochter des schwäbischen Herzogs Burchhardt hervorging,4 sollten sich seine Blicke gen Italien wenden.
In Italien konnte sich seit dem Tod Karls des Dicken keine beständige Dynastie etablieren. Nach Wido und seinem Sohn Lambert, die einen recht erfolgreichen Ansatz einer Dynastiebildung begonnen hatten,5 vermochte weder Ludwig III. von der Provence noch Berengar von Friaul eine dauerhafte Herrschaft zu errichten. Durch den ständigen Königswechsel ergab sich dann auch im Jahre 922 für Rudolf II. von Burgund die Möglichkeit, nach der Italienischen Krone zu greifen.
Der vor ihm herrschende Berengar war nämlich, obwohl es ihm im zweiten Anlauf 915 gelungen war, die Kaiserkrone zu erhalten, bei den italienischen Großen in wachsendem Maße unbeliebt, was auf seine Misserfolge im Umgang mit den seinen Untertanen und den Ungarn zurückzuführen war. Zwar hatte er laut Liudprand von Cremona6 ein Bündnis mit den heidnischen Ungarn schließen können, doch die militärische Rückendeckung nützte ihm weniger, als ihm das Bündnis in der Anerkennung durch die vorherrschenden Schichten schadete. Auch in den anderen Teilen des Frankenreichs konnte Berengar, der sich auf seine direkte Abstammung von Karl dem Großen und Ludwig dem Frommen berief, nicht die nötige Anerkennung finden. Wie später noch zu zeigen sein wird, reichte seine auf karolingische Tradition ausgerichtete Legitimationsstrategie nicht aus. Durch die Unzufriedenheit großer Adelsschichten des Regnum Italicum war für das Erscheinen Rudolfs II. die Bühne bereitet, als eine Gesandtschaft, angeführt von Giselbert von Bergamo, nach Hochburgund aufbrach, um ihm die Königskrone anzubieten.
3. Das Erscheinen Rudolfs auf der italienischen Bühne - Ziele und Begründung
In Italien ereignete sich im Jahr 921 ein Aufstand gegen Berengar, den dieser nur mit Hilfe der Ungarn erfolgreich bekämpfen konnte.7 Bei Liudprand von Cremona finden schon während der Rebellion Verhandlungen der Gegner Berengars mit Rudolf statt, wenn auch vorerst nur durch Boten. Nach der Niederlage der Rebellen begab sich auf Anregung des Adalbert von Ivrea eine Gesandtschaft unter Giselbert von Bergamo zu ihm. Dieser bewegte Rudolf dazu, binnen 30 Tagen in Italien zu erscheinen.8
[...]
1 Als überblickende Darstellungen über das Hochburgund der Rudolfinger vgl. Bernd Schneidmüller, Die Welfen, Herrschaft und Erinnerung (819-1252) (Kohlhammer-Urban-Taschenbücher Bd. 465), Stuttgart 2000, S. 74-105 [Im Folgenden zitiert als: Schneidmüller, Welfen] und Laetitia Boehm, Geschichte Burgunds, Politik - Staatsbildungen - Kultur, Stuttgart 1979, S.87-122 [Im Folgenden zitiert als: Boehm, Burgund].
2 Dies lässt sich an den Strategien der Kaisererhebung nach 888 erkennen. So berief sich z.B. Berengar I. 915 auf die Abstammung von Karl dem Großen und erhob so Anspruch auf die Herrschaft des gesamten Frankenreiches; ähnlich auf den größeren Zusammenhang bedacht waren auch seine Vorgänger Wido und Ludwig III. Vgl. Rudolf Hiestand, Byzanz und das Regnum Italicum im 10. Jahrhundert, Ein Beitrag zur ideologischen und machtpolitischen Auseinandersetzung zwischen Osten und Westen, Zürich 1964, S. 55-60 89f, 119-124 [Im Folgenden zitiert als: Hiestand, Byzanz und Regnum Italicum].
3 Vgl. Schneidmüller, Welfen, S. 74-82.
4 Rudolf heiratete, nachdem er in der Schlacht von Wintherthur 919 gegen Burchhardt unterlegen war, dessen Tochter Berta, vgl. Liudprand von Cremona, Antapodosis II, 60.
5 So hatte es Wido von Spoleto vollbracht, 892 bereits seinen Sohn Lambert zum Mitkaiser zu erheben. Doch obwohl die Machtübergabe an den Sohn gelang und Lambert zu Beginn seiner Regierungszeit durchaus erfolgreich war, wurde die Macht der Spoletiner durch den frühen und überraschenden Tod Lamberts zunichte gemacht. Liudprand von Cremona trauert Lambert dann auch in höchsten Worten nach und sagt sogar, dass Lambert, wäre er nicht zu Tode gekommen, sich den gesamten Erdkreis unterworfen hätte: Quod si non cita mors hunc reparet, is esset, qui post Romanorum potentiam totum sibi orbem viriliter subiugaret. Liudprand von Cremona, Antapodosis I 44; vgl. auch Hiestand, Byzanz und Regnum Italicum, S. 75-82.
6 Liudprand von Cremona, Antapodosis II, 61.
7 Nach der Beschreibung bei Liudprand von Cremona entzündete sich der Konflikt, als Berengar Geldzahlungen für die Besetzung des Erzbischofstuhls von Mailand durch Lambert von Tuszien fordert. Der Aufstand konnte nur durch Hilfe der Ungarn beendet werden, doch konnte der rebellische Adalbert, Markgraf von Ivrea, entkommen. Vgl. Liudprand von Cremona, Antapodosis II, 57-62.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments über Rudolf II. und Italien?
Dieses Dokument ist ein Einblick in eine wissenschaftliche Arbeit über Rudolf II., König von Hochburgund, und seine Rolle in Italien im 10. Jahrhundert. Es beinhaltet eine Gliederung, eine Einleitung, in der die Ziele der Arbeit und die verwendeten Quellen erläutert werden, sowie Auszüge aus den Kapiteln, die historische Umstände und Rudolfs Motivationen und Ziele in Italien beleuchten.
Welche zentralen Fragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht, warum Rudolf II. nach Italien zog, wie es ihm gelang, König von Italien zu werden, und warum seine Herrschaft scheiterte. Es werden die Legitimationsgrundlagen von Rudolf II. und Berengar I. analysiert und die historischen Umstände untersucht, die zu ihrem jeweiligen Erfolg oder Misserfolg führten.
Welche Quellen werden für die Arbeit verwendet?
Die wichtigste Quelle ist die "Antapodosis" des Liudprand von Cremona. Ergänzt wird diese durch Königsurkunden Italiens, die "Gesta Berengarii" und die Abhandlung des Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos "De Administrando Imperii".
Welche historischen Umstände werden im Zusammenhang mit Rudolfs Italienfeldzug betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die Zergliederung des karolingischen Frankenreichs nach dem Vertrag von Verdun (843) und das Entstehen verschiedener Königreiche, darunter Hochburgund, unter Rudolf I. Die politischen Instabilitäten in Italien nach dem Tod Karls des Dicken, die zu einem ständigen Wechsel der Herrscher führten, werden ebenfalls dargestellt.
Warum zogen italienische Große Rudolf II. Berengar I. vor?
Berengar I. hatte an Beliebtheit bei den italienischen Großen verloren, was auf seine Misserfolge im Umgang mit seinen Untertanen und den Ungarn zurückzuführen war. Ein Bündnis Berengars mit den Ungarn schadete seiner Anerkennung bei den vorherrschenden Schichten. Die Unzufriedenheit der Adelsschichten im Regnum Italicum bereitete den Boden für das Erscheinen Rudolfs II.
Welche Ziele verfolgte Rudolf II. mit seinem Einmarsch in Italien?
<Nach der Beschreibung bei Liudprand von Cremona entzündete sich der Konflikt, als Berengar Geldzahlungen für die Besetzung des Erzbischofstuhls von Mailand durch Lambert von Tuszien fordert. Der Aufstand konnte nur durch Hilfe der Ungarn beendet werden, doch konnte der rebellische Adalbert, Markgraf von Ivrea, entkommen. Vgl. Liudprand von Cremona, Antapodosis II, 57-62.
- Quote paper
- Ben Seel (Author), 2010, Der Italienfeldzug Rudolfs II. von Hochburgund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164671