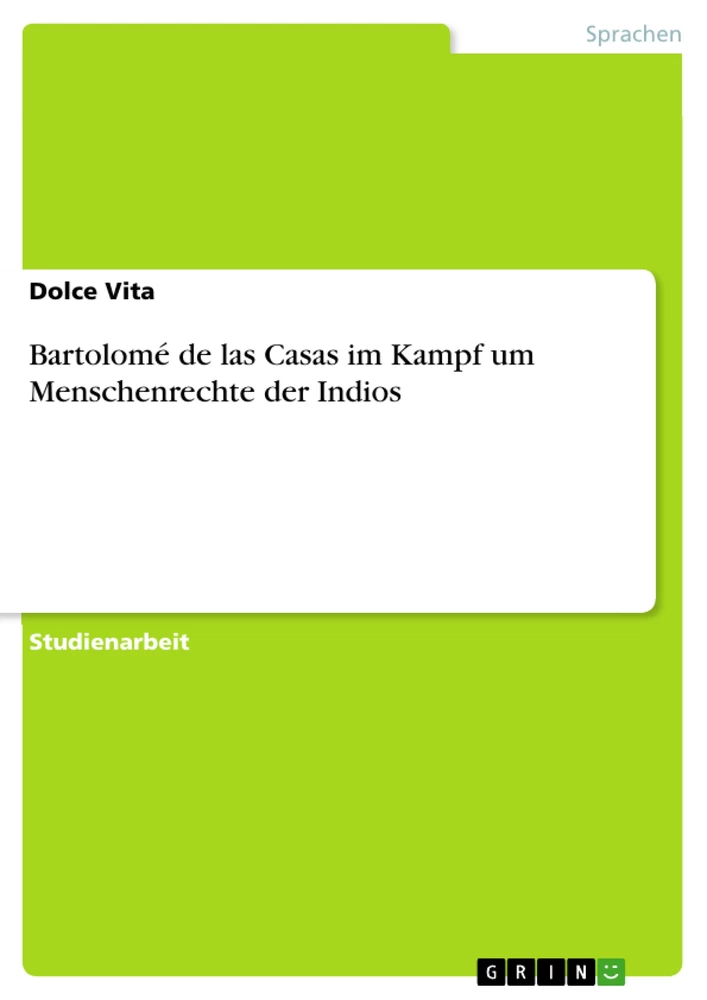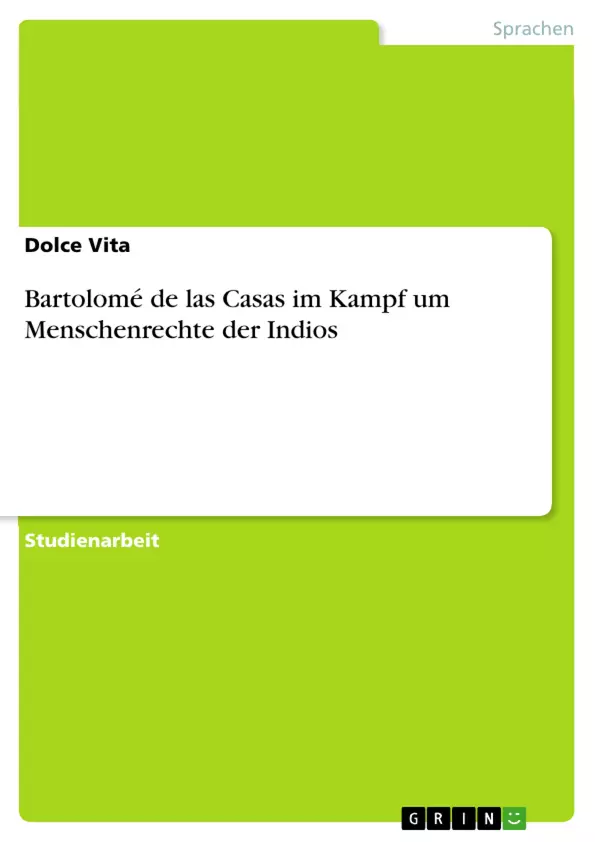Bartolomé de las Casas wird oft als Vorkämpfer der Menschenrechte der Indios genannt. In dieser Arbeit soll bewiesen werden, ob diese Bezeichnung rechtmäßig ist oder nicht. Deshalb ist als erstes zu definieren, was überhaupt Menschenrechte sind. Die Biographie von Bartolomé de las Casas ist nur im Zusammenhang der politischen und ideologischen Umbrüche seiner Zeit zu verstehen. Deshalb werde ich eine kurze Einführung in die Geschichte Spaniens zur Zeit der Entdeckung von Amerika machen. Andererseits stehen seine Werke in enger Verbindung mit seiner Biographie, sind sogar oft direkte Auslegung der persönlichen Erlebnisse. Aus diesem Grunde werde ich seinen Lebenslauf vorstellen, wobei ich bei den im Kampf um Menschenrechte entscheidenden Momenten Argumente aus seinen Schriften anbringen werde.
Inhaltsverzeichnis
- I. Spanien zum Zeitpunkt der Entdeckung
- II. Vom Encomendero zum Verteidiger der Indios
- 1. Das Encomienda-System
- 2. Zwei schicksalsbewegende Predigten
- a. Die Predigt von Antonio Montesina
- b. Die Predigt von Bartolomé de las Casas
- III. Der Kampf um Menschenrechte
- 1. Die Verhandlungen mit Jiménez de Cisneros
- 2. Leyes Nuevas
- 3. Der Disput mit Juan Ginés de Sepúlveda
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rechtmäßigkeit der Bezeichnung Bartolomé de las Casas als Vorkämpfer der Menschenrechte der Indios. Sie analysiert Las Casas' Verständnis des Naturrechts im Kontext seiner Zeit und verfolgt die Entwicklung seiner Ansichten, von seinen frühen Arbeiten, die die spanische Präsenz in Amerika rechtfertigen, bis hin zu seinen späteren Schriften, die sich verstärkt auf rationalistische und juristisch-philosophische Argumente stützen. Die Arbeit beleuchtet zudem den historischen Kontext, indem sie die politische und soziale Situation Spaniens zur Zeit der Entdeckung Amerikas beschreibt.
- Das Naturrechtsverständnis Bartolomé de las Casas und dessen Entwicklung
- Das Encomienda-System und seine Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung
- Las Casas' Kampf für die Menschenrechte der Indios und seine Strategien
- Der Einfluss der politischen und religiösen Situation Spaniens auf Las Casas' Wirken
- Die Bedeutung von Las Casas' Schriften für die Diskussion um die Menschenrechte
Zusammenfassung der Kapitel
I. Spanien zum Zeitpunkt der Entdeckung: Das Kapitel beschreibt die politische und soziale Situation Spaniens zu Beginn des 15. Jahrhunderts, gekennzeichnet durch innerstaatliche Rivalitäten und die noch bestehende maurische Herrschaft in Granada. Die erfolgreiche Reconquista, die Eroberung Granadas im Jahr 1491, und die damit einhergehende Stärkung der katholischen Monarchie werden detailliert dargestellt. Die ökonomischen Auswirkungen der Reconquista, der Aufschwung des Handels und das Streben nach neuen Handelswegen, werden im Kontext des Goldfiebers und der Entdeckung Amerikas im Jahr 1492 erläutert. Die Kapitel beschreibt auch den Aufstieg Spaniens zur europäischen Großmacht durch die Heirat Johanns mit einem Habsburger und die daraus folgende religiöse und politische Bedeutung im Kampf gegen die aufsteigenden Protestanten. Die Entdeckung Amerikas wird als ein geographischer, aber auch kultureller und ideologischer Umbruch dargestellt, der den Renaissance-Humanismus und die Herausforderungen an die Macht der katholischen Kirche mit sich brachte.
II. Vom Encomendero zum Verteidiger der Indios: Dieses Kapitel skizziert das Leben von Bartolomé de las Casas, von seiner Jugend in Sevilla bis zu seinem Aufenthalt in Hispaniola. Der Fokus liegt auf seinem Wandel vom Conquistador und Encomendero zum Verteidiger der Indios. Das Encomienda-System, das die Ausbeutung der indigenen Bevölkerung legalisierte, wird als Ausgangspunkt für Las Casas’ spätere Kritik an der spanischen Kolonialpolitik dargestellt. Der Kapitel erwähnt seine Ausbildung, den Beginn seiner Karriere als Conquistador und seine Erfahrung mit dem Encomienda-System.
Schlüsselwörter
Bartolomé de las Casas, Menschenrechte, Naturrecht, Encomienda-System, Reconquista, Hispaniola, Indios, Spanische Kolonialpolitik, Katholische Könige, Renaissance-Humanismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bartolomé de las Casas – Vom Encomendero zum Verteidiger der Indios
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rechtmäßigkeit der Bezeichnung Bartolomé de las Casas als Vorkämpfer der Menschenrechte der Indios. Sie analysiert Las Casas' Verständnis des Naturrechts, die Entwicklung seiner Ansichten und den historischen Kontext seines Wirkens, inklusive der politischen und sozialen Situation Spaniens zur Zeit der Entdeckung Amerikas.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt Las Casas' Naturrechtsverständnis und dessen Entwicklung, das Encomienda-System und seine Auswirkungen, Las Casas' Kampf für die Menschenrechte der Indios und seine Strategien, den Einfluss der spanischen politischen und religiösen Situation auf sein Wirken und die Bedeutung seiner Schriften für die Diskussion um die Menschenrechte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel I beschreibt Spanien zur Zeit der Entdeckung Amerikas, Kapitel II zeichnet den Wandel von Las Casas vom Conquistador zum Verteidiger der Indios nach und Kapitel III behandelt den Kampf um die Menschenrechte der Indios.
Was wird im ersten Kapitel ("Spanien zum Zeitpunkt der Entdeckung") beschrieben?
Dieses Kapitel beschreibt die politische und soziale Situation Spaniens zu Beginn des 15. Jahrhunderts, die Reconquista, die ökonomischen Auswirkungen, den Aufstieg Spaniens zur europäischen Großmacht und die Entdeckung Amerikas als geographischen, kulturellen und ideologischen Umbruch.
Was ist der Inhalt des zweiten Kapitels ("Vom Encomendero zum Verteidiger der Indios")?
Dieses Kapitel skizziert Las Casas' Leben, seinen Wandel vom Conquistador zum Verteidiger der Indios, das Encomienda-System und dessen Auswirkung auf die indigene Bevölkerung, sowie seine frühen Erfahrungen mit dem System.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Bartolomé de las Casas, Menschenrechte, Naturrecht, Encomienda-System, Reconquista, Hispaniola, Indios, Spanische Kolonialpolitik, Katholische Könige, Renaissance-Humanismus.
Welche konkreten Ereignisse oder Personen werden im Text erwähnt?
Der Text erwähnt unter anderem die Predigten von Antonio Montesina und Bartolomé de las Casas, die Verhandlungen mit Jiménez de Cisneros, die Leyes Nuevas und den Disput mit Juan Ginés de Sepúlveda.
Welche Quellen werden in dieser Arbeit vermutlich verwendet?
Die Arbeit stützt sich vermutlich auf die Schriften von Bartolomé de las Casas selbst und auf historische Quellen, die die politische und soziale Situation Spaniens und die spanische Kolonialpolitik in Amerika beleuchten. Die genauen Quellen werden im Haupttext aufgeführt sein.
- Arbeit zitieren
- Dolce Vita (Autor:in), 2010, Bartolomé de las Casas im Kampf um Menschenrechte der Indios, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164672