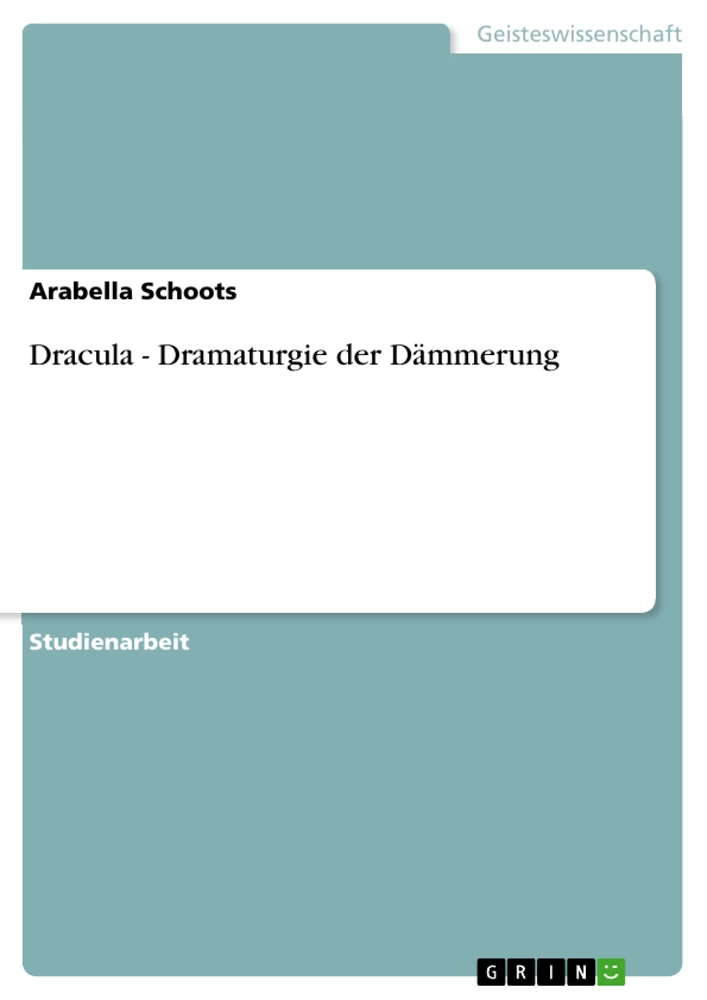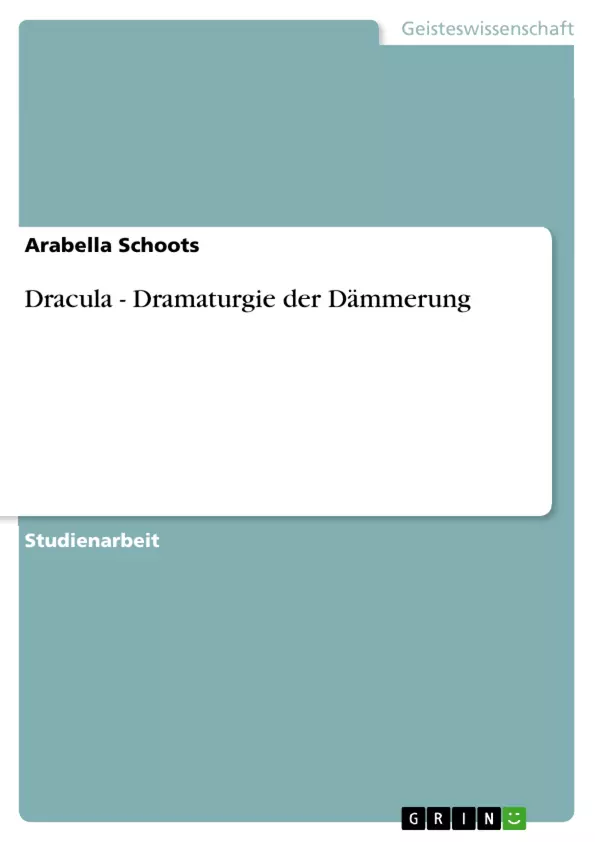„der Cörper ausser den Nasen, welche etwas abgefallen, gantz frisch; Haar und Bart, ja auch die Nägel [...] an ihme gewachsen; die alte Haut [...] hat sich hinweg geschellet, und eine frische neue darunter hervor gethan; das Gesicht, Hände und s.v. Füsse, und der gantze Leib waren beschaffen, daß sie zu Lebzeiten nicht hätten vollkommener seyn können. In seinem Mund hab nicht ohne Erstaunen einiges frisches Blut erblickt, welches, der gemeinen Aussag nach, er von denen, durch ihme umgebrachte, gesogen“
(Siehe: Ruthner, Clemens: Sexualitaet Macht Tod-t – Vampir. Prolegomena zu einer Literaturgeschichte desVampirismus.)
Diese Arbeit umfasst ein breit gefächertes Wissen in Theaterwissenschaft, Philosophie, Theologie, Geschichte, Filmwissenschaft, Medienwissenschaft sowie Literatur. Sie werden über Aristoteles, Brecht, das Konzept der Figur in McKee’s Story lesen sowie über Maria Theresia und ihren Leibarzt VanSwieten lesen. Am Ende werden 3 Vampirfilme miteinander verglichen, in denen auf die Inszenierungsart geachtet wurde. (Wie wird Licht inszeniert, welche Rolle spielen Sonne, Mond, Dämmerung etc.)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vampire in Europa, Maria Theresia und Van Swieten
- Hat Dracula vor Sherlock Holmes Angst? Oder Sherlock Holmes vor Dracula?
- Glaube/Aberglaube
- Vampiristische Aspekte in Religionen/Glaubensrichtungen
- Leben nach dem Tod?
- Brecht's episches Vampirstück als flüssige Angelegenheit
- Aristoteles und die Poetik
- Aristoteles über die Nachahmung
- Aristoteles über Mythos
- Aristoteles über das Schaudererregende und Jammervolle
- Aristoteles über die Handlung
- Aristoteles über Gut und Böse
- Aristoteles über das Wunderbare
- Das Konzept der Figur in McKee's Story
- Die Enthüllung des Charakters
- Die Spannung des Figurbogens
- Drei Filmszenen im Vergleich
- Tanz der Vampire (Roman Polánski, US/GB 1967)
- Bram Stoker's Dracula (Francis Ford Coppola, USA, 1992)
- Interview mit einem Vampir (Neil Jordan, USA 1994)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Dramaturgie des Vampirs, insbesondere im Kontext von Bram Stokers "Dracula". Die Analyse untersucht die historischen Wurzeln des Vampirismus in Europa, die Entwicklung des Vampirmotivs in der Literatur und im Film sowie die Anwendung dramaturgischer Prinzipien in der Darstellung von Vampiren.
- Historische Aspekte des Vampirismus in Europa
- Dramaturgische Prinzipien in der Literatur und im Film
- Die Entwicklung des Vampirmotivs in der Literatur und im Film
- Die Darstellung des Vampirs in unterschiedlichen Filmen
- Die Rolle des Aberglaubens und der Religion im Kontext des Vampirismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die persönliche Erfahrung der Autorin mit dem Vampirmotiv und führt in die Thematik der Arbeit ein. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der historischen Entwicklung des Vampirismus in Europa, mit besonderem Fokus auf die Zeit Maria Theresias und die Untersuchungen von Gerard van Swieten. Das dritte Kapitel stellt die Frage nach der Beziehung zwischen Dracula und Sherlock Holmes, wobei die Charaktere als Vertreter unterschiedlicher Kulturen und Zeitepochen betrachtet werden. Das vierte Kapitel behandelt die Rolle des Aberglaubens und der Religion im Zusammenhang mit dem Vampirismus. Das fünfte Kapitel analysiert Brecht's episches Vampirstück als flüssige Angelegenheit. Das sechste Kapitel untersucht die Anwendung von Aristoteles' Poetik auf das Vampirmotiv. Das siebte Kapitel beschäftigt sich mit der Figur des Vampirs in McKee's Story. Das achte Kapitel analysiert drei Filmszenen im Vergleich, um die Dramaturgie des Vampirs in unterschiedlichen Filmen zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Vampirismus, Dramaturgie, Literatur, Film, Geschichte, Maria Theresia, Van Swieten, Glaube, Aberglaube, Religion, Aristoteles, Poetik, McKee's Story, Filmszenen, Tanz der Vampire, Bram Stoker's Dracula, Interview mit einem Vampir.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Arbeit zum Thema „Dracula“?
Die Arbeit analysiert die Dramaturgie des Vampirs in Geschichte, Literatur und Film, von historischen Wurzeln bis hin zu modernen Verfilmungen.
Welche Rolle spielten Maria Theresia und Van Swieten für den Vampirglauben?
Gerard van Swieten, Leibarzt von Maria Theresia, untersuchte im 18. Jahrhundert Berichte über Vampire in Europa und trug zur wissenschaftlichen Aufklärung über dieses Phänomen bei.
Wie wird Aristoteles' Poetik auf Vampire angewandt?
Die Arbeit nutzt aristotelische Prinzipien wie Nachahmung (Mimesis), Mythos und das Schaudererregende, um die dramaturgische Wirkung von Vampirerzählungen zu erklären.
Welche Filme werden in der Analyse verglichen?
Es werden Szenen aus "Tanz der Vampire" (Polánski), "Bram Stoker's Dracula" (Coppola) und "Interview mit einem Vampir" (Jordan) hinsichtlich ihrer Inszenierung verglichen.
Was wird unter der „Dramaturgie der Dämmerung“ verstanden?
Dies bezieht sich auf die gezielte Inszenierung von Licht, Sonne, Mond und Dämmerung, um die Atmosphäre und die Figur des Vampirs filmisch darzustellen.
- Quote paper
- Arabella Schoots (Author), 2009, Dracula - Dramaturgie der Dämmerung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164704