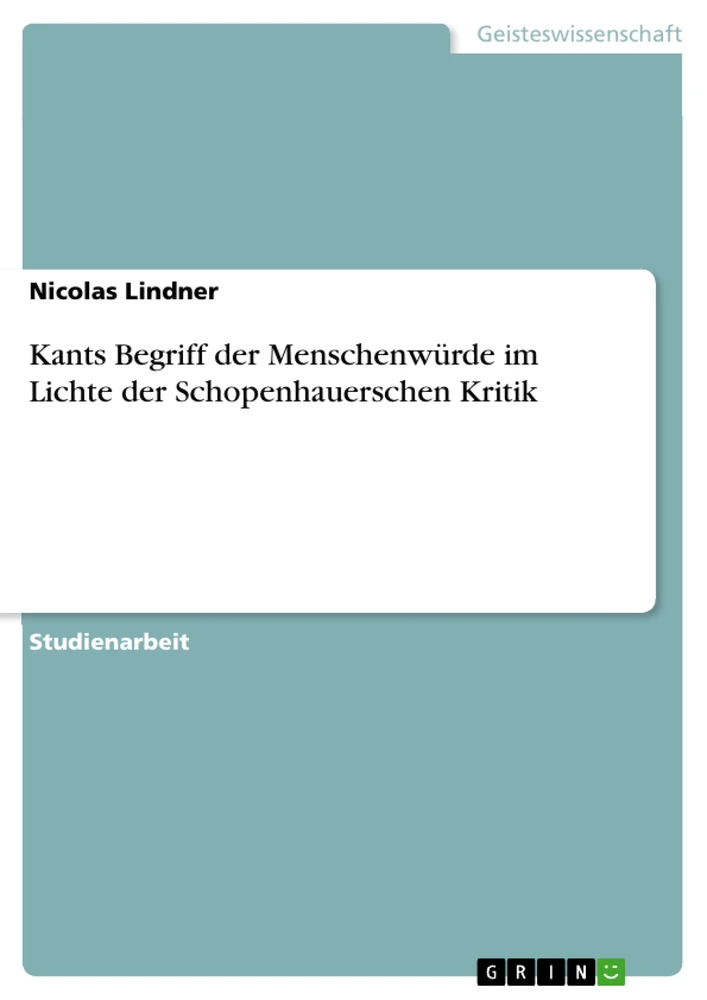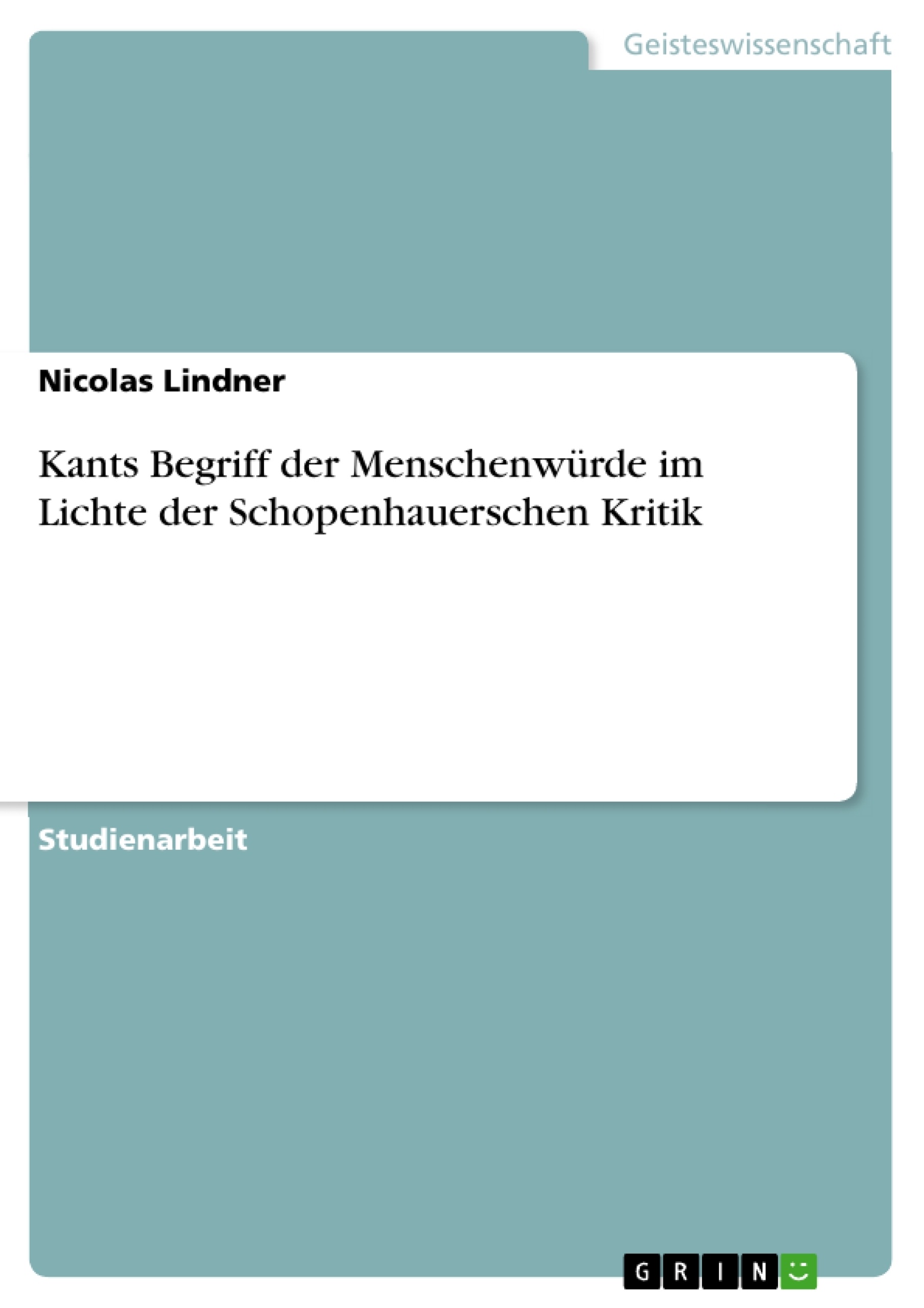“Würde des Menschen
Nichts mehr davon, ich bitt euch. Zu essen gebt ihm, zu wohnen,
Habt ihr die Blöße bedeckt, gibt sich die Würde von selbst.“
(Friedrich Schiller)
Der Begriff der Menschenwürde ist ein in der Ethik vieldiskutierter und ebenso vielschichtiger Begriff. Vor allem in der deutschsprachigen Forschung nimmt er sowohl in den traditionellen als auch in neueren Debatten der angewandten Ethik einen wichtigen Platz ein. Diesen Stellenwert beweist auch sein Platz an der Spitze der rechtlichen Normenpyramide in Artikel 1 des Grundgesetzes. Wie jedoch die vorangestellten Worte Schillers zeigen, bietet die Diskussion um die Menschenwürde stets Anlass für unterschiedlichste inhaltliche Bestim-mungen dieses Begriffs. Während ihm auf der einen Seite ein hoher Status in der Ethik beigemessen wird, lehnt man ihn andernorts gänzlich ab. Eine we-sentliche Bestimmung und Konturierung des Begriffes hat Immanuel Kant in seiner Moralphilosophie vorgenommen. Seine Überlegungen zum Begriff der menschlichen Würde und zu dessen Status haben die Diskussion zum Thema seit der Aufklärung wesentlich geprägt und mitgestaltet. Auch das grundgesetz-liche Verständnis der Menschenwürde trägt in weiten Teilen die Züge der kan-tischen Auffassung. Ein prominenter und gleichsam drastischer Kritiker jener Auffassung findet sich in Arthur Schopenhauer. Dieser lehnt die Würdekon-zeption Kants aus unterschiedlichen Gründen ab und entwickelt im Gegenzug eine Position, welche den Begriff des Mitleids in den Mittelpunkt der Moral rückt.
Im Folgenden möchte ich zunächst Grundzüge der Würdekonzeption Kants darlegen und im Rahmen seiner praktischen Philosophie systematisch verorten. Anschließend daran soll die Kritik Schopenhauers an diesen Überlegungen vorgestellt und kritisch überprüft werden. In einem letzten Schritt werde ich dann im Fazit diskutieren, welche Konsequenzen sich für Kants Überlegungen aus der Kritik Schopenhauers ergeben. Hierbei soll der Schwerpunkt auf der Frage liegen, ob aus der kritischen Einschätzung Schopenhauers eine umfas-sende Ablehnung der kantischen Überlegungen folgt oder ob jene als Aus-gangspunkt für eine Neugestaltung des Ansatzes fruchtbar gemacht werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kants Konzeption der Menschenwürde
- Die Menschheit-als-Selbstzweck-Formel
- Zweck an sich und Autonomie
- Menschheit
- Das Reich der Zwecke
- Die Würde des Menschen
- Schopenhauers Kritik an der Kantischen Idee der Menschenwürde
- Semantische Kritik am Begriff der Menschenwürde
- Inhaltliche Kritik am Begriff der Menschenwürde
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit Kants Konzeption der Menschenwürde im Lichte der Schopenhauerschen Kritik. Das Ziel der Arbeit ist es, die zentralen Elemente von Kants Würdekonzeption zu erläutern und deren systematische Einordnung in seine praktische Philosophie aufzuzeigen. Darüber hinaus soll die Kritik Schopenhauers an diesen Überlegungen vorgestellt und kritisch analysiert werden. Letztlich soll die Frage geklärt werden, inwieweit Schopenhauers Kritik zu einer Ablehnung von Kants Konzeption führt oder ob sie als Ausgangspunkt für eine Neugestaltung des Ansatzes dienen kann.
- Kants Konzeption der Menschenwürde als "innerer Wert" und ihre Ableitung aus dem kategorischen Imperativ
- Die Rolle der Autonomie und Selbstgesetzgebung in Kants Verständnis der Menschenwürde
- Schopenhauers Kritik an der semantischen und inhaltlichen Bedeutung von Kants Menschenwürdekonzeption
- Die Bedeutung des Mitleids in Schopenhauers Moralphilosophie im Vergleich zu Kants Konzeption
- Die Relevanz der Kritik Schopenhauers für die Weiterentwicklung der Konzeption der Menschenwürde
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Begriff der Menschenwürde als einen vieldiskutierten und vielschichtigen Begriff in der Ethik vor. Sie erläutert den Stellenwert dieses Begriffs in der deutschsprachigen Forschung und im Grundgesetz. Weiterhin wird die Bedeutung von Kants Philosophie für die Entwicklung des Menschenwürde-Begriffs hervorgehoben und Schopenhauer als prominenter Kritiker Kants vorgestellt.
2. Kants Konzeption der Menschenwürde
Dieses Kapitel erläutert die wichtigsten Aspekte von Kants Konzeption der Menschenwürde. Es wird die Menschheit-als-Selbstzweck-Formel als zentrales Element von Kants Ethik vorgestellt und die Verbindung zwischen Selbstzweck und Autonomie des Menschen herausgearbeitet. Zudem wird der Begriff "Menschheit" im Kontext der Menschheit-als-Selbstzweck-Formel analysiert.
3. Schopenhauers Kritik an der Kantischen Idee der Menschenwürde
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Schopenhauers Kritik an Kants Menschenwürdekonzeption. Es werden sowohl die semantische Kritik an dem Begriff der Menschenwürde als auch die inhaltliche Kritik an Kants Konzeption von Schopenhauer vorgestellt und analysiert. Die Bedeutung des Mitleids in Schopenhauers Ethik wird im Vergleich zu Kants Konzeption diskutiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Menschenwürde, kategorischer Imperativ, Autonomie, Selbstzweck, Mitleid, Kant, Schopenhauer, Ethik, Moral, Grundgesetz.
- Arbeit zitieren
- Nicolas Lindner (Autor:in), 2010, Kants Begriff der Menschenwürde im Lichte der Schopenhauerschen Kritik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164725