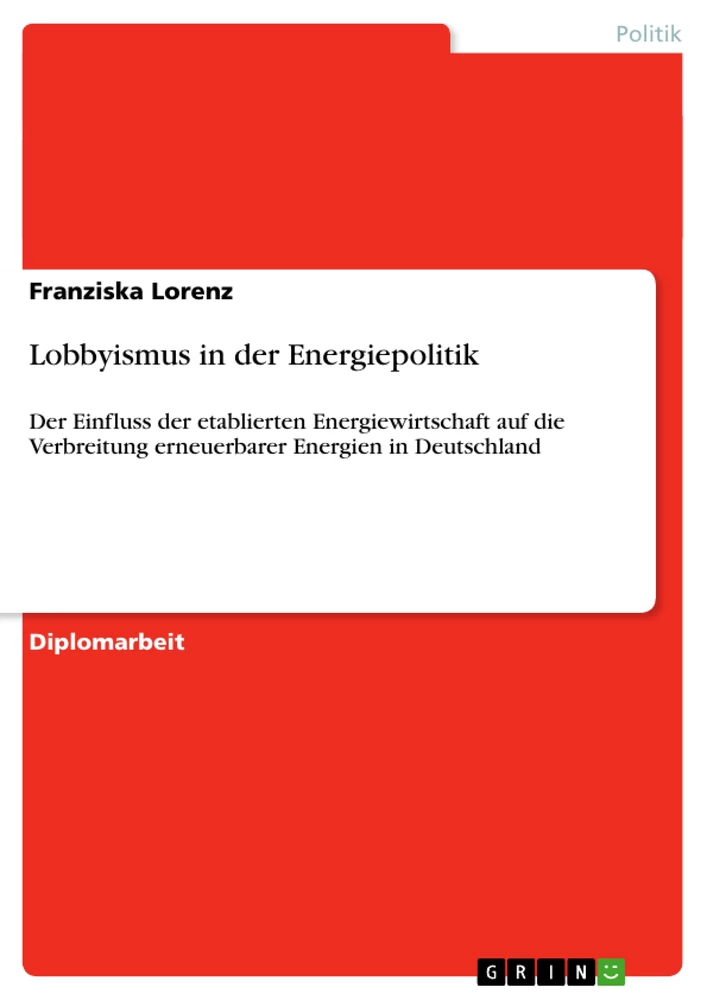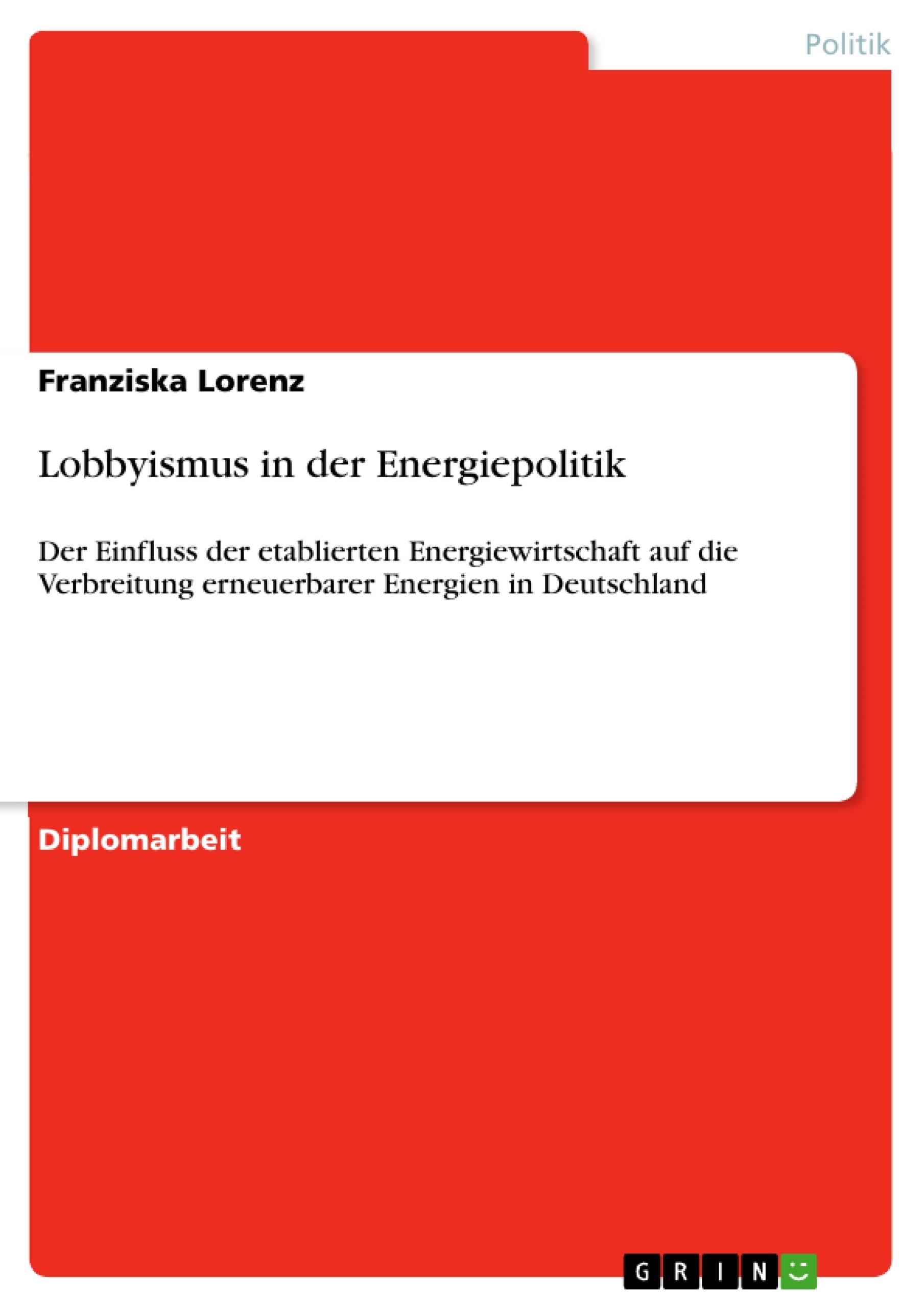Inwieweit erneuerbare Energiequellen von den Akteuren der Energiewirtschaft als Alternative wahrgenommen und umgesetzt werden, ist Bestandteil der vorliegenden Arbeit. Grundsätzlich ist festzustellen, dass im Feld der Energieversorgung zu den etablierten Akteuren mit dem Einzug der erneuerbaren Energien viele neue Akteure auf den Markt getreten sind. Die regenerativen Energien entwickeln sich teilweise unabhängig, also ohne Beteiligung der etablierten Energiewirtschaft. Die meist zentralen Großkraftwerke auf Basis von Kohle und Atomkraft bekommen durch viele, zum Teil kleine Marktakteure Konkurrenz. Abgesehen von einigen Großprojekten gestaltet sich die regenerative Stromversorgung überwiegend dezentral. Diese Konkurrenzsituation soll nun Gegenstand der vorliegenden Analyse sein. Durch das Aufkommen regenerativer Energien, welche seit 2000 durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)Vorrang bei der Einspeisung in das Stromnetz genießen, werden die konventionellen Energien schrittweise zurückgedrängt. Der sich anbahnende Strukturwandel in der Energiewirtschaft zieht somit auch einen „Wechsel von Marktanteilen“(Fechner 2009) mit sich. Die großen Energieversorger wie E.ON, RWE und Vattenfall sind aufgefordert, viele Milliarden in die umweltfreundlichen Technologien zu investieren. Doch die alten Technologien beginnen gerade rentabel zu werden. Die meisten Kraftwerke sind bereits abgeschrieben und bringen gute Gewinne ein. Der Ausbau der erneuerbaren Energien schreitet voran, jedoch verhältnismäßig langsam. Offenbar besteht ein Konflikt zwischen den trägen Grundlastkraftwerken (Atom- und Kohlekraftwerke) und den flexiblen, schwankenden Ökostromquellen. Während die einen für längere Laufzeiten der bestehenden Atomkraftwerke und den Bau neuer Kohlekraftwerke kämpfen, agieren die anderen gegen eine massive Kürzung der Solarförderung. Es scheint so, als existieren zwei rivalisierende Seiten, welche um die Stromversorgungen der Zukunft wetteifern.
Die Untersuchung soll folgende Leitfragen beantworten:
- Welche Akteure treiben die Entwicklung der erneuerbaren Energien voran?
- Gibt es Gegner der neuen Energiequellen und können diese auf deren Entwicklung einwirken?
- Wer wirkt an Entscheidungen bezüglich der Umstrukturierung des Energiesystems mit und wie können die Beteiligten ihre Interessen im Entscheidungsprozess einbringen und durchsetzen?
- Wie groß ist die Bedeutung der staatlichen Akteure?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problematik: Wachsender Energiebedarf und Klimawandel
- Die Fragestellung
- Forschungsstand
- Methode und Aufbau der Arbeit
- Die Netzwerkanalyse in der Policy-Forschung
- Die Politikfeldanalyse
- Der Advocacy-Koalitionsansatz
- Begriffserklärungen und Rahmenbedingungen
- Etablierte Energiewirtschaften
- Erneuerbare Energien
- Das Stromversorgungssystem in Deutschland
- Energiepolitik und Klimaschutzziele
- Akteure der Stromversorgung in Deutschland
- Die Bundesregierung
- Politische Parteien
- Energieversorgungsunternehmen
- Stromerzeugung
- Stromübertragung
- Stromvertrieb
- Branchenverbände
- Gewerkschaften
- Umweltschutzverbände
- Bürgerinitiativen
- Stromverbraucher und Verbraucherschutzverbände
- Lobbyismus und die Macht der fossil-atomaren Energiewirtschaft
- Interessen der etablierten Energiewirtschaft
- Möglichkeiten der Einflussnahme
- Koalitionsbildung zur Interessendurchsetzung
- Verflechtungen zwischen Politik und Energiewirtschaft
- Argumente gegen erneuerbare Energien
- Kostenanalyse
- Versorgungssicherheit
- Umweltschutz als Lobby-Vorwand
- Zwischenfazit: gegenläufige Ansichten und Positionen
- Der Machtkampf der Energiekonzerne
- Optimierung konventioneller Energieerzeugungsmethoden
- CO2-Abscheidung und -Speicherung
- Kernfusion
- Machtstabilisierung durch EE-Großprojekte
- Offshore-Windkraft-Anlagen
- Sonnenenergie aus der Sahara
- Visionen einer dezentralen Energieversorgung
- Erneuerbare-Energien-Projekte in Kommunen
- Gebäudeintegrierte Energieproduktion
- Systemkonflikt zwischen erneuerbaren Energien und konventionellen Großkraftwerken
- Zwischenfazit: zentrale und/oder dezentrale Stromproduktion?
- Staatliche Förderpolitik
- Staatliche Förderung der konventionellen Energieträger
- Instrumente zur Förderung der erneuerbaren Energien
- Zwischenfazit: Das Fehlen eines Energieprogramms?
- Erneuerbare Energien um jeden Preis?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss der etablierten Energiewirtschaft auf die Verbreitung erneuerbarer Energien in Deutschland. Sie analysiert die Interessen der verschiedenen Akteure im Energiebereich und deren Einflussnahme auf die Politikgestaltung. Dabei stehen die Herausforderungen des Klimawandels und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Energieversorgung im Fokus.
- Die Interessen und Strategien der etablierten Energiewirtschaft
- Die Rolle von Lobbyismus und Interessenvertretung in der Energiepolitik
- Die Auswirkungen des Lobbyismus auf die Entwicklung der erneuerbaren Energien
- Die Herausforderungen der Energiewende und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Energieversorgung
- Die Bedeutung von staatlicher Förderpolitik und Regulierung im Energiebereich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problematik des wachsenden Energiebedarfs und des Klimawandels beleuchtet. Anschließend werden die Netzwerkanalyse und der Advocacy-Koalitionsansatz als methodische Werkzeuge zur Analyse von Policy-Feldern vorgestellt. Im dritten Kapitel werden wichtige Begriffserklärungen und Rahmenbedingungen der Energiepolitik erläutert, darunter die etablierte Energiewirtschaft, erneuerbare Energien und das Stromversorgungssystem in Deutschland.
Kapitel 4 stellt die wichtigsten Akteure der Stromversorgung in Deutschland vor, darunter die Bundesregierung, politische Parteien, Energieversorgungsunternehmen, Branchenverbände, Gewerkschaften, Umweltschutzverbände, Bürgerinitiativen und Stromverbraucher. Im fünften Kapitel wird der Einfluss der etablierten Energiewirtschaft auf die Energiepolitik untersucht, wobei die Interessen der Branche, die Möglichkeiten der Einflussnahme und die Argumente gegen erneuerbare Energien beleuchtet werden.
Kapitel 6 analysiert den Machtkampf der Energiekonzerne und die unterschiedlichen Strategien zur Sicherung ihrer Marktmacht. Dabei werden sowohl die Optimierung konventioneller Energieerzeugungsmethoden als auch die Förderung von EE-Großprojekten betrachtet. Im siebten Kapitel wird die staatliche Förderpolitik im Energiebereich untersucht, wobei sowohl die Förderung konventioneller Energieträger als auch die Förderung der erneuerbaren Energien beleuchtet werden.
Das achte Kapitel befasst sich mit der Frage, ob erneuerbare Energien um jeden Preis gefördert werden sollten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss der etablierten Energiewirtschaft auf die Verbreitung erneuerbarer Energien in Deutschland. Dabei stehen Themen wie Lobbyismus, Interessenvertretung, Energiepolitik, Klimaschutz, Energiewende, fossile Brennstoffe, erneuerbare Energien, Stromversorgung, Netzwerkanalyse, Advocacy-Koalitionsansatz, staatliche Förderung und Regulierung im Vordergrund.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die Hauptakteure der Energiewirtschaft in Deutschland?
Zu den etablierten Akteuren gehören große Energieversorger wie E.ON, RWE und Vattenfall. Ihnen gegenüber stehen neue Akteure aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, Branchenverbände und Umweltschutzorganisationen.
Wie beeinflussen Lobbyisten die Energiepolitik?
Lobbyisten versuchen durch Koalitionsbildung, Verflechtungen mit der Politik und Argumente wie Versorgungssicherheit oder Kostenanalysen, Entscheidungen über Laufzeiten von Kraftwerken oder Förderkürzungen zu beeinflussen.
Warum gibt es einen Konflikt zwischen konventionellen und erneuerbaren Energien?
Es besteht ein Systemkonflikt zwischen trägen Grundlastkraftwerken (Atom/Kohle) und flexiblen Ökostromquellen. Zudem fürchten etablierte Konzerne den Verlust von Marktanteilen durch die dezentrale Einspeisung von Solar- und Windstrom.
Welche Rolle spielt das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)?
Das EEG gibt erneuerbaren Energien seit 2000 Vorrang bei der Einspeisung. Dies führt zu einem schrittweisen Strukturwandel und zwingt etablierte Versorger zur Umstellung ihrer Geschäftsmodelle.
Was ist der Advocacy-Koalitionsansatz?
Dies ist ein methodisches Werkzeug der Politikfeldanalyse, um zu untersuchen, wie sich verschiedene Interessengruppen (Advocacy-Koalitionen) zusammenschließen, um ihre Visionen des Energiesystems durchzusetzen.
- Arbeit zitieren
- Franziska Lorenz (Autor:in), 2010, Lobbyismus in der Energiepolitik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164740