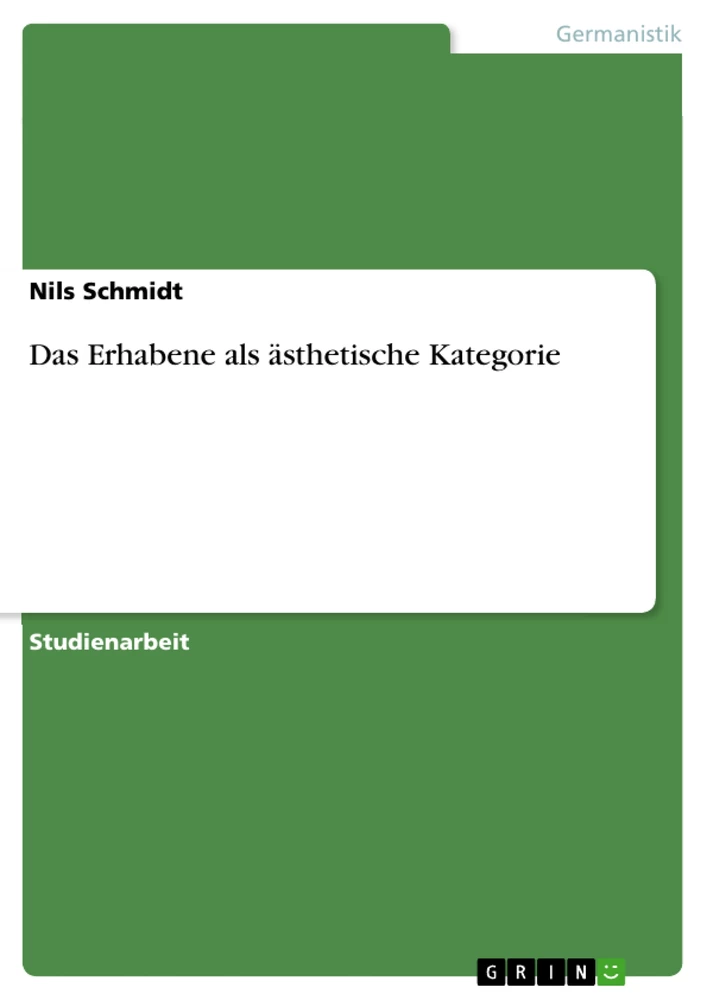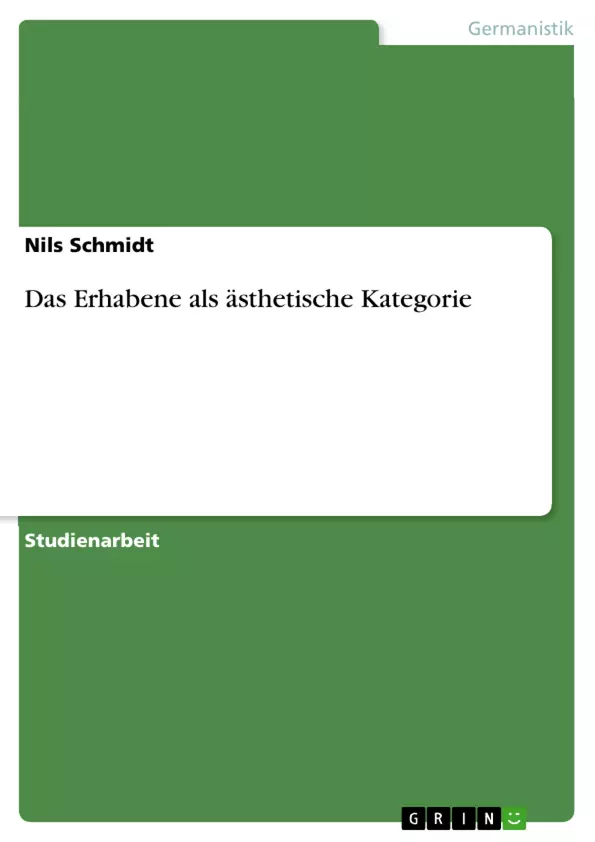Die vorliegende Arbeit stellt die Kategorie des Erhabenen anhand zweier literarischer Texte vor: Zunächst behandelt die Interpretation des Gedichts Das Firmament von Barthold Heinrich Brockes aus dem Jahr 1721 einen lyrischen Umgang mit einer überwältigenden Naturerfahrung in Form eines Blickes in den Himmel, bevor durch die Analyse der Sternwartenszene aus Johann Wolfgang von Goethes Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden (Erstausgabe: 1821) gezeigt werden kann, dass ein vergleichbares Szenario hundert Jahre später zwar eine ähnliche Brisanz für das menschliche Selbstverständnis besitzt, die in beiden Texten angelegte Synthese jedoch unterschiedlich ausfällt. Es folgt eine theoretische Auseinandersetzung mit der ästhetischen Kategorie des Erhabenen. Auch einige Aspekte der antiken Tragödientheorie Aristoteles’ werden in diesem Kontext beleuchtet. Eine Abgrenzung des Erhabenen gegenüber der Kategorie des Schönen macht deutlich, dass das Erhabene eine geistige Verfeinerung und Erhöhung des rein Sinnlichen darstellt, gleichzeitig aber im Gegenteil des Schönen wurzelt und somit eine Vorstufe der Ästhetik des Hässlichen darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Erhabene
- Barthold Heinrich Brockes: Das Firmament
- Johann Wolfgang von Goethe: Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden - Die Sternwartenszene
- Theoretische Fundierung des Erhabenen
- Das Erhabene in Abgrenzung zum Schönen
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ästhetische Kategorie des Erhabenen im 18. Jahrhundert anhand zweier literarischer Texte: Barthold Heinrich Brockes' "Das Firmament" und die Sternwartenszene aus Goethes "Wilhelm Meisters Wanderjahre". Die Zielsetzung besteht darin, die Darstellung des Erhabenen in diesen Texten zu analysieren und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in ihrer Synthese aufzuzeigen. Weiterhin wird die theoretische Fundierung des Erhabenen beleuchtet und eine Abgrenzung zum Schönen vorgenommen.
- Das Erhabene als ästhetische Kategorie im 18. Jahrhundert
- Darstellung des Erhabenen in der Lyrik (Brockes)
- Darstellung des Erhabenen in der Prosa (Goethe)
- Theoretische Auseinandersetzung mit dem Erhabenen (Kant, Schiller, Aristoteles)
- Abgrenzung des Erhabenen zum Schönen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Erhabenen als zentrale ästhetische Kategorie des 18. Jahrhunderts ein und stellt die Bedeutung dieser Kategorie für die Weltanschauung und Literatur der Zeit heraus. Sie erwähnt die antiken Ursprünge des Begriffs und dessen erneute Bedeutung in der Aufklärung durch Denker wie Kant und Schiller. Die Einleitung betont die andauernde Relevanz der Auseinandersetzung mit der Ästhetik der Natur, wobei der Unterschied zwischen der subjektiven Wahrnehmung und der objektiven Beschaffenheit der Natur betrachtet wird. Der Begriff der Ästhetik wird in seinem umfassenderen Sinne als Theorie des sinnlichen Wahrnehmens erläutert, nicht nur als Synonym für Schönheit. Die Arbeit selbst wird kurz vorgestellt, wobei die Struktur und die behandelten Texte skizziert werden.
Das Erhabene: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse des Erhabenen anhand zweier literarischer Texte. Es untersucht, wie das Erhabene in den Werken von Barthold Heinrich Brockes und Johann Wolfgang von Goethe dargestellt wird, um die unterschiedlichen Ausprägungen und Interpretationen dieser Kategorie aufzuzeigen. Das Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Erhabenen, unter Einbezug antiker Ansätze wie der Tragödientheorie des Aristoteles und vergleicht diese mit den literarischen Beispielen. Abschließend wird das Erhabene vom Schönen abgegrenzt, um die spezifischen Merkmale und die geistige Dimension des Erhabenen herauszuarbeiten. Der Fokus liegt auf dem Vergleich und der Kontrastierung der beiden literarischen Beispiele, sowie der Erläuterung der theoretischen Hintergründe der ästhetischen Kategorie.
2.1 Barthold Heinrich Brockes: Das Firmament: Die Analyse von Brockes' Gedicht "Das Firmament" (1721) untersucht dessen lyrischen Umgang mit einer überwältigenden Naturerfahrung. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Gefühls des Verlustes und der existentiellen Bedrohung, die vom lyrischen Ich zunächst erlebt wird, bevor diese Erfahrung am Ende des Gedichts in eine heilsame Gotteserfahrung transformiert wird. Die Analyse untersucht die verschiedenen Ebenen des Verlustes: den Verlust der Orientierung, das Versagen der Sinneswahrnehmung und die Bedrohung der Seele. Die Struktur des Gedichts und die verwendeten sprachlichen Mittel, wie Metaphern und das Motiv der Abwärtsbewegung, werden detailliert untersucht. Der Bezug zu Platons Höhlengleichnis und die Bedeutung der "Ewigkeiten" werden erläutert. Die Zäsur im neunten Vers und der Übergang von der anfänglichen Angst zu einem befreienden Gefühl werden analysiert. Die theologische Gesamtausrichtung des Gedichts im Kontext der Physikotheologie wird ebenfalls behandelt, wobei die apophatische Gottesbegründung im Zentrum steht. Die unio mystica-Erfahrung des lyrischen Ichs und die Symbolik des Meeres als Leitmetapher werden ausführlich besprochen.
Schlüsselwörter
Erhabenes, Schönes, Ästhetik, 18. Jahrhundert, Brockes, Goethe, Naturerfahrung, Literaturanalyse, Physikotheologie, Gotteserfahrung, Subjektivität, Wahrnehmung, Tragödientheorie, Aristoteles, Kant, Schiller.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des Erhabenen bei Brockes und Goethe
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die ästhetische Kategorie des Erhabenen im 18. Jahrhundert anhand von Barthold Heinrich Brockes' "Das Firmament" und der Sternwartenszene aus Goethes "Wilhelm Meisters Wanderjahre". Sie untersucht die Darstellung des Erhabenen in diesen Texten, vergleicht ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten und beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Erhabenen, insbesondere im Vergleich zum Schönen.
Welche Texte werden analysiert?
Die Haupttexte der Analyse sind Barthold Heinrich Brockes' Gedicht "Das Firmament" (1721) und die Sternwartenszene aus Johann Wolfgang von Goethes "Wilhelm Meisters Wanderjahre".
Welche theoretischen Ansätze werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf theoretische Fundierungen des Erhabenen, darunter antike Ansätze wie die Tragödientheorie des Aristoteles sowie die Aufklarungsphilosophie von Kant und Schiller. Der Begriff der Ästhetik wird umfassend als Theorie des sinnlichen Wahrnehmens erläutert, nicht nur als Synonym für Schönheit.
Wie wird das Erhabene in Brockes' "Das Firmament" dargestellt?
Die Analyse von Brockes' Gedicht untersucht den lyrischen Umgang mit überwältigender Naturerfahrung. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Gefühls des Verlustes und der existentiellen Bedrohung, die in eine heilsame Gotteserfahrung transformiert wird. Die Analyse betrachtet die Struktur des Gedichts, sprachliche Mittel, den Bezug zu Platons Höhlengleichnis und die theologische Gesamtausrichtung im Kontext der Physikotheologie mit der apophatischen Gottesbegründung.
Wie wird das Erhabene in Goethes "Wilhelm Meisters Wanderjahre" dargestellt (Sternwartenszene)?
Die Arbeit analysiert die Sternwartenszene aus Goethes Roman, um die Darstellung des Erhabenen in der Prosa zu untersuchen und diese mit der lyrischen Darstellung bei Brockes zu vergleichen. Konkrete Details zur Analyse dieser Szene sind in der bereitgestellten Zusammenfassung nicht explizit aufgeführt.
Wie werden das Erhabene und das Schöne abgegrenzt?
Die Arbeit grenzt das Erhabene vom Schönen ab, um die spezifischen Merkmale und die geistige Dimension des Erhabenen herauszuarbeiten. Diese Abgrenzung ist ein zentraler Bestandteil der theoretischen Auseinandersetzung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur Analyse des Erhabenen (einschließlich der Einzelanalysen von Brockes' "Das Firmament" und der Goetheschen Sternwartenszene) und einem Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erhabenes, Schönes, Ästhetik, 18. Jahrhundert, Brockes, Goethe, Naturerfahrung, Literaturanalyse, Physikotheologie, Gotteserfahrung, Subjektivität, Wahrnehmung, Tragödientheorie, Aristoteles, Kant, Schiller.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Darstellung des Erhabenen in den ausgewählten Texten zu analysieren und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Sie beleuchtet die theoretische Fundierung des Erhabenen und grenzt es vom Schönen ab.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für die akademische Nutzung bestimmt und dient der Analyse von Themen im Bereich der Literaturwissenschaft und Ästhetik.
- Citar trabajo
- Nils Schmidt (Autor), 2010, Das Erhabene als ästhetische Kategorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164798