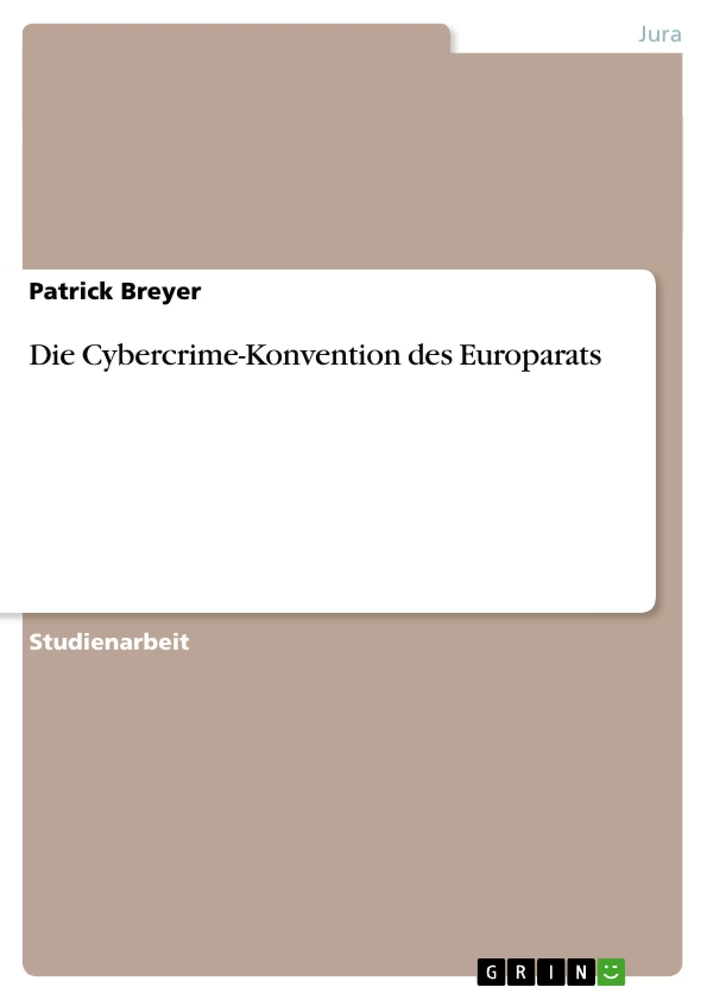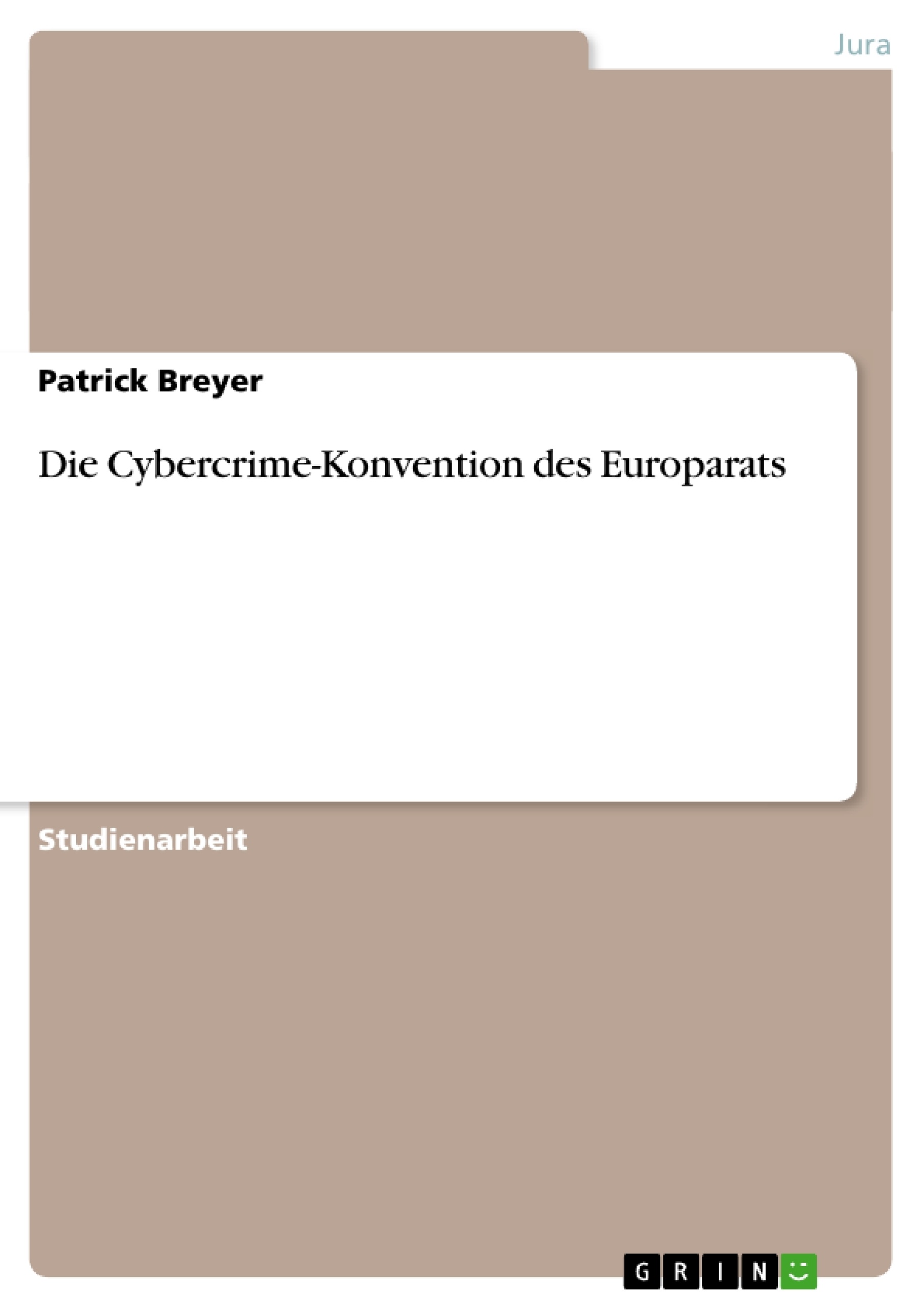I. Allgemeine Diskussion der Überwachung
Ziel der geplanten Cybercrime-Konvention des Europarats1, die nunmehr in der endgültigen, 28.
Entwurfsfassung vom 29.06.20012 vorliegt, ist die Effektuierung der Strafverfolgung im
Computerbereich. Da die weitreichendste Verfolgung dieses Ziels, die Totalüberwachung der
Kommunikation der Bürger, einen unverhältnismäßigen Eingriff in deren allgemeines
Persönlichkeitsrecht darstellen würde, soll zunächst einmal dargelegt werden, welche
Argumente für und gegen staatliche Eingriffsbefugnisse im Bereich der
Kommunikationsüberwachung vorgebracht werden können.
1. Interessen der Staaten
Wie die Cybercrime-Konvention in ihrer Präambel zum Ausdruck bringt, dient die
Effektuierung der Strafverfolgung zunächst einmal dem Schutz des Bürgers oder wenigstens der
Stärkung dessen subjektiven Sicherheitsgefühls. Als Vorteile der Überwachung lassen sich auch
die sonstigen Strafzwecke wie Prävention und Besserung anführen.
Zuvörderst steht aus staatlicher Sicht allerdings der Strafanspruch des Staates, dessen
Verwirklichung im Computerbereich bisher aus verschiedenen Gründen erschwert ist. Die
Beweissicherung im Bereich von Computerdaten gestaltet sich oftmals schwierig, und
Wirtschaftsunternehmen verzichten oft auf Anzeigen, um das Vertrauen ihrer Kunden nicht zu
erschüttern. Es ist jedoch nicht eindeutig, ob sich diese Schwierigkeiten alleine auf den
Computerbereich beschränken und somit erhöhte Eingriffsbefugnisse rechtfertigen können.
Als weiteres Argument für eine verstärkte Strafverfolgung im Internetbereich lässt sich
anführen, dass die effektive Verfolgung von Straftaten nicht nur wegen der dadurch erhöhten
Sicherheit im Sinne der Bevölkerung ist, sondern auch, weil dadurch die gleichmäßige Ahndung
von Straftaten gefördert wird: Ohne die erforderlichen technischen Kenntnisse der Beteiligten wird es nur selten gelingen, einen Computerkriminellen zu stellen. [...]
1 Internetadresse des Europarats: http://www.coe.int. Kontaktmöglichkeit für Eingaben bezüglich der
Cybercrime-Konvention (CDPC): dmitri.marchenkov@coe.int, sabine.zimmer@coe.int oder allgemein
daj@coe.int. Zuständiges Referat beim Bundesjustizministerium: Abteilung II A 4, Fax 030-20259525.
2 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/projets/FinalCybercrime.htm. Die jeweils aktuelle Fassung ist über
http://conventions.coe.int abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
- Entwurf einer Cybercrime-Konvention
- Allgemeine Diskussion der Überwachung
- Interessen der Staaten
- Interessen der Wirtschaft
- Interessen der Bürger/innen
- Rechtsstaatliche Anforderungen an Eingriffsbefugnisse
- Das Verfahren zur Ausarbeitung des aktuellen Entwurfs einer Cybercrime-Konvention
- Überblick über den Inhalt des Vertragsentwurfs
- Problematiken einzelner Bestimmungen
- Artikel 6: Missbrauch von Vorrichtungen
- Artikel 10: Straftaten in Bezug auf Verstöße gegen Urheber- und verwandte Rechte
- Artikel 14 bis 21: Strafprozessuale Befugnisse
- Artikel 15: Bedingungen und Gewährleistungen
- Internationale Grund- und Menschenrechte
- Stellungnahme der Parlamentarischen Versammlung zu Artikel 15
- Artikel 15 n.F. und eigene Stellungnahme dazu
- Datenschutz
- Weitere Ausnahmeklauseln
- Eigene Stellungnahme
- Artikel 23 bis 35: Internationale Zusammenarbeit
- Umfang der Verpflichtung zu Amtshilfe
- Art. 25 Abs. 4
- Art. 27 Abs. 4
- Art. 28: Vertraulichkeit und Beschränkung der Nutzung
- Lösungsmöglichkeiten
- Änderungsanträge der Parlamentarischen Versammlung
- Gefahr der Entstehung "internationaler Ermittlungsoasen"
- Kritik der Artikel 29-Datenschutzgruppe
- Eigene Stellungnahme
- Abschließende Beurteilung
- Ergänzung des Europaratsabkommens zum Datenschutz
- Artikel 1
- Artikel 2
- Ergebnis
- Empfehlung zum Schutz des Privatlebens im Internet
- Informationen für Internetnutzer
- Informationen für Internet Service Provider
- Ergebnis
- Interessenkonflikte bei der Überwachung im Internet
- Rechtsstaatliche Anforderungen an Eingriffsbefugnisse
- Strafprozessuale Befugnisse in der Cybercrime-Konvention
- Internationale Zusammenarbeit im Bereich der Cybercrime-Bekämpfung
- Datenschutz und Schutz des Privatlebens im Internet
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Cybercrime-Konvention des Europarats zielt darauf ab, die Strafverfolgung im Computerbereich zu effektivieren. Das Dokument untersucht dabei die Problematik der Überwachung im Internet und die daraus resultierenden Interessenkonflikte zwischen den Staaten, der Wirtschaft und den Bürgern.
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer allgemeinen Diskussion der Überwachung im Internet und beleuchtet die Interessen der Staaten, der Wirtschaft und der Bürger. Es werden Argumente für und gegen staatliche Eingriffsbefugnisse im Bereich der Kommunikationsüberwachung vorgestellt. Der Entwurfsprozess der Cybercrime-Konvention wird im zweiten Kapitel erläutert. Das dritte Kapitel bietet einen Überblick über den Inhalt des Vertragsentwurfs. Die Problematiken einzelner Bestimmungen werden im vierten Kapitel behandelt, wobei besonderes Augenmerk auf Artikel 6 (Missbrauch von Vorrichtungen), Artikel 10 (Straftaten in Bezug auf Urheberrechtsverletzungen) und Artikel 14-21 (Strafprozessuale Befugnisse) gelegt wird. In diesem Kapitel werden auch die Datenschutzbedenken, die mit der Konvention verbunden sind, sowie die Stellungnahme der Parlamentarischen Versammlung und des Autors zum Artikel 15 diskutiert. Der fünfte und letzte Abschnitt analysiert die internationalen Kooperationsmechanismen, die in der Konvention vorgeschlagen werden, sowie die damit verbundenen Probleme wie die Gefahr der Entstehung von "internationalen Ermittlungsoasen".
Schlüsselwörter
Cybercrime-Konvention, Europarat, Überwachung, Datenschutz, Strafverfolgung, Internet, Kommunikation, Interessenkonflikte, Strafprozessuale Befugnisse, Internationale Zusammenarbeit, Ermittlungsoasen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Cybercrime-Konvention des Europarats?
Ziel ist die Effektuierung der grenzüberschreitenden Strafverfolgung bei Computerkriminalität durch harmonisierte Gesetze und verbesserte internationale Zusammenarbeit.
Welche Konflikte gibt es zwischen Überwachung und Datenschutz?
Staatliche Eingriffsbefugnisse zur Strafverfolgung können das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Bürger verletzen, weshalb rechtsstaatliche Anforderungen an die Überwachung gestellt werden.
Was regelt Artikel 6 der Konvention?
Artikel 6 befasst sich mit dem „Missbrauch von Vorrichtungen“, also der Herstellung oder dem Vertrieb von Software oder Hardware, die primär für Straftaten im Computerbereich gedacht sind.
Was sind „internationale Ermittlungsoasen“?
Es besteht die Sorge, dass Kriminelle in Länder ausweichen, die die Konvention nicht unterzeichnen oder in denen der Datenschutz und die Strafverfolgung lückenhaft sind.
Welche Rolle spielen Internet Service Provider (ISPs) in der Konvention?
ISPs können zur Zusammenarbeit mit Behörden verpflichtet werden, etwa bei der Herausgabe von Verkehrsdaten oder der Sicherung von Beweismitteln.
- Quote paper
- Patrick Breyer (Author), 2001, Die Cybercrime-Konvention des Europarats, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16484