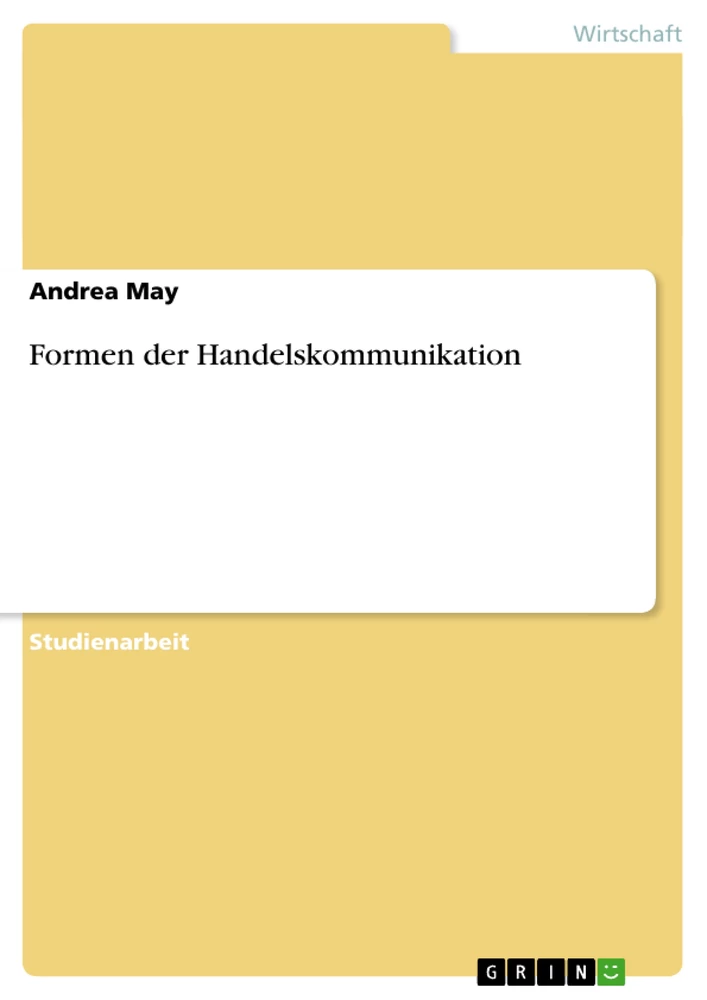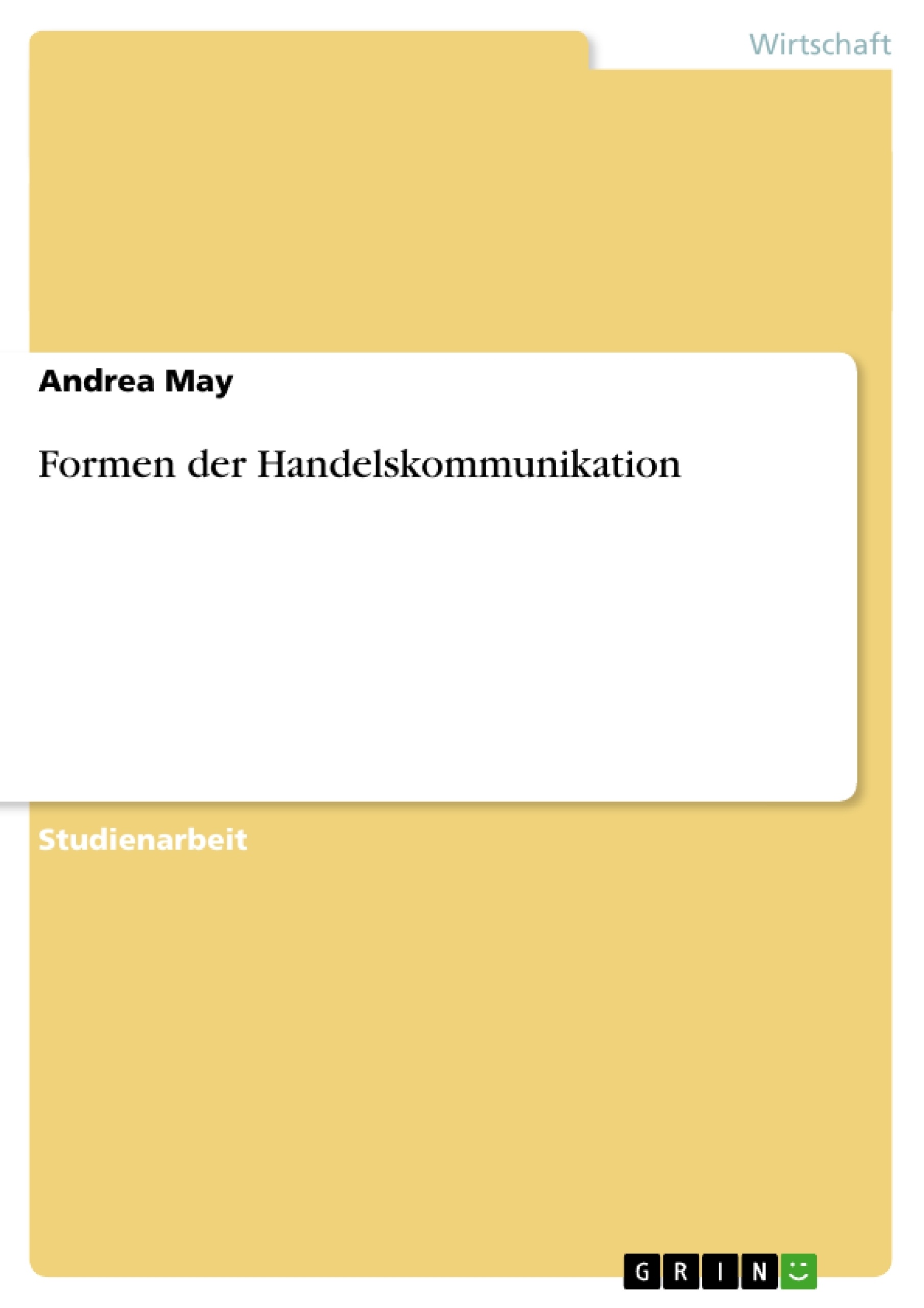Der Handel ist „der Austausch von Waren und Diensten zwischen Wirtschaftspartnern“.
„Als Handel bezeichnet man den Warenaustausch zwischen Handelsbetrieben oder mit
Lieferanten und Abnehmern, die nicht Handelsbetriebe sind.“1
Müller-Hagedorn unterscheidet den Begriff Handel im funktionellen als auch im
institutionellen Sinn, aufbauend auf den Definitionen des Ausschusses für
Begriffsdefinitionen.
Handel im funktionellen Sinn liegt vor, wenn Marktteilnehmer Güter, die sie i.d.R. nicht
selbst be- oder verarbeiten von anderen Marktteilnehmern beschaffen und an Dritte
verkaufen. „Handelt es sich um Betriebe, die ausschließlich oder überwiegend Waren
beschaffen, um sie ohne Be- oder Verarbeitung weiterzuveräußern, so spricht man von
Handel im institutionellen Sinn“.2
Der Handel von Waren und Dienstleistungen wird notwendig durch die Entwicklung von
Bedürfnissen und der Befriedigung dieser. Steht hinter dem Wunsch der
Bedürfnisbefriedigung auch die nötige Kaufkraft entsteht Nachfrage. Die Nachfrage richtet
sich an der Nutzenstiftung der Güter und Dienstleistungen aus. Damit nun ein Güter- bzw.
Dienstleistungstransfer entsteht, kommt der Gegenpart zu den Nachfragern ins Spiel, der
Anbieter. Dieser bietet den Nachfragern Güter und Dienstleistungen an, die einen
bestimmten, für den Nachfrager subjektiv empfundenen, Nutzen bieten. Der Ort an dem
Angebot und Nachfrage zusammentreffen wird als Markt bezeichnet. 3
Es gibt unterschiedliche Marktformen, die durch die verschiede Anzahl von Anbietern und
Nachfragern geprägt sind, wie z.B. das Monopol, in dem einem Anbieter viele Nachfrager
gegenüber stehen, oder dem Polypol, in dem sich viele Anbieter und viele Nachfrager
gegenüber stehen. Das Polypol ist in der heutigen Zeit die verbreitetste Marktform neben
dem Oligopol, wenige Anbieter wenige Nachfrager. Durch die große Anzahl der Anbieter
entsteht eine hohe Konkurrenz unter ihnen. Das Konkurrenzdenken wird noch verstärkt
durch die immer homogener werdenden Produkte, d.h. jedes produzierende Unternehmen
bzw. jedes Handelsunternehmen vertreibt ähnliche Produkte. Der Markt wird also immer
kompakter.4 [...]
1 Tietz, B., Handelsbetrieb, S.4.
2 Müller-Hagedorn, L., Handel, S.15-20
3 Vgl. Pepels, W., Absatzkanalmanagement, S.88.
4 MKT-C Aufzeichnungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der Handel
- 2. Definitionen
- 2.1. Handelsmarketing
- 2.2. Kommunikation
- 2.3. Kommunikationsprozess
- 2.4. Kommunikation im Handel
- 2.5. Ziele der Kommunikation
- 3. Kommunikationsinstrumente
- 3.1. Externe Kommunikationsinstrumente
- 3.1.1. Klassische Werbung
- 3.1.2. Verkaufsförderung
- 3.1.3. Persönlicher Verkauf
- 3.1.4. Public Relation
- 3.1.5. Sponsoring
- 3.1.6. Product Placement
- 3.1.7. Direktkommunikation
- 3.2. Profil-Marketing
- 3.2.1. Das Unternehmsymbol
- 3.2.2. Das Unternehmensumfeld
- 3.2.3. Die Unternehmensfassade
- 3.2.4. Die Schaufenster des Unternehmens
- 3.2.5. Der Verkaufsraum des Unternehmens
- 3.2.6. Die Warenpräsentation im Handelsunternehmen
- 3.2.7. Die Mitarbeiter des Unternehmens
- 3.2.8. Der Service des Unternehmens
- 3.3. Erfolgreich kommunizierte Marketing-Konzepte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Formen der Handelskommunikation. Sie untersucht die Bedeutung des Handels im Kontext von Bedürfnissen und Nachfrage und beleuchtet die verschiedenen Kommunikationsinstrumente, die Unternehmen im Handel einsetzen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Unterscheidung zwischen klassischem Industrie-Marketing und dem eigenständigen Handelsmarketing.
- Definition des Handels und seiner Bedeutung
- Die Rolle der Kommunikation im Handel
- Externe und interne Kommunikationsinstrumente
- Das Konzept des Profil-Marketings
- Erfolgreiche Marketing-Konzepte im Handel
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der Handel
Der Handel ist ein essentieller Bestandteil der Wirtschaft, der die Vermittlung von Waren und Dienstleistungen zwischen Produzenten und Verbrauchern ermöglicht. Die Arbeit erläutert die Funktionsweise des Handels und seine Rolle in der Befriedigung von Bedürfnissen. Es werden verschiedene Marktformen wie das Monopol und das Polypol vorgestellt und die Auswirkungen der wachsenden Konkurrenz im Handel dargestellt.
2. Definitionen
Dieses Kapitel behandelt die Definitionen von Handelsmarketing und Kommunikation im Handel. Es beleuchtet die Gründe für die Entwicklung eines eigenständigen Handelsmarketings, das sich von den Marketingstrategien der Industrie unterscheidet. Die verschiedenen Elemente des Marketing-Mix im Handelsmarketing, wie Produktpolitik, Distributionspolitik und Kommunikationspolitik, werden erläutert.
3. Kommunikationsinstrumente
Hier werden die verschiedenen Kommunikationsinstrumente im Handel vorgestellt. Es werden sowohl externe Instrumente wie klassische Werbung, Verkaufsförderung, persönlicher Verkauf, Public Relation, Sponsoring und Product Placement als auch interne Instrumente wie das Profil-Marketing behandelt. Der Fokus liegt auf der effizienten Nutzung der jeweiligen Kommunikationsmittel zur Gewinnung und Bindung von Kunden.
Schlüsselwörter
Handel, Kommunikation, Handelsmarketing, Marketing-Mix, externe Kommunikationsinstrumente, interne Kommunikationsinstrumente, Profil-Marketing, Bedürfnisbefriedigung, Nachfrage, Marktformen, Konkurrenz, Unternehmenskommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Handel im funktionellen Sinne definiert?
Handel im funktionellen Sinne liegt vor, wenn Marktteilnehmer Güter beschaffen und an Dritte weiterverkaufen, ohne diese Güter wesentlich zu be- oder verarbeiten.
Was unterscheidet Handelsmarketing vom Industriemarketing?
Handelsmarketing konzentriert sich auf die Vermittlung zwischen Anbieter und Nachfrager am Verkaufsort. Es umfasst spezifische Instrumente wie die Warenpräsentation, das Serviceangebot und die Gestaltung des Verkaufsraums, die über das klassische Produktmarketing hinausgehen.
Welche externen Kommunikationsinstrumente nutzt der Handel?
Zu den externen Instrumenten zählen die klassische Werbung, Verkaufsförderung (Sales Promotion), persönlicher Verkauf, Public Relations, Sponsoring, Product Placement und Direktkommunikation.
Was ist Profil-Marketing im Handel?
Profil-Marketing umfasst interne Instrumente, die dem Handelsunternehmen ein unverwechselbares Gesicht geben. Dazu gehören das Unternehmenssymbol, die Fassadengestaltung, Schaufenster, die Ladengestaltung sowie das Auftreten der Mitarbeiter.
Welche Marktformen sind im heutigen Handel verbreitet?
Die verbreitetsten Marktformen sind das Polypol (viele Anbieter, viele Nachfrager) und das Oligopol (wenige Anbieter, wenige Nachfrager). Dies führt zu einer hohen Konkurrenz durch homogene Produkte.
Welche Ziele verfolgt die Kommunikation im Handel?
Zentrale Ziele sind die Information der Kunden, die Profilierung gegenüber Wettbewerbern, die Gewinnung von Neukunden sowie die langfristige Kundenbindung.
- Quote paper
- Andrea May (Author), 2003, Formen der Handelskommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16492